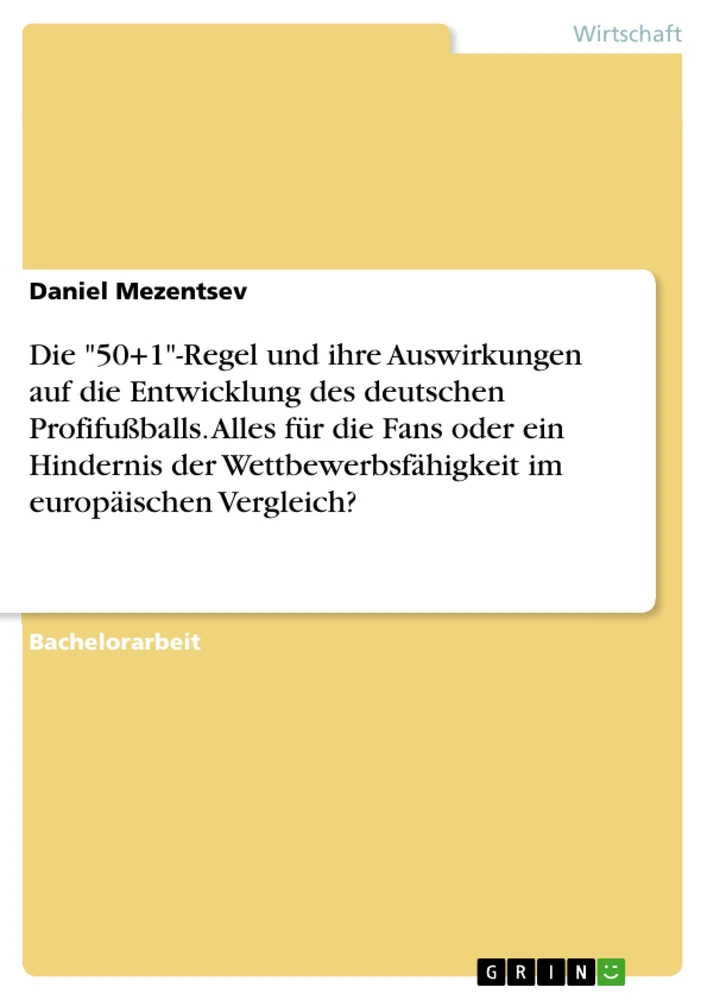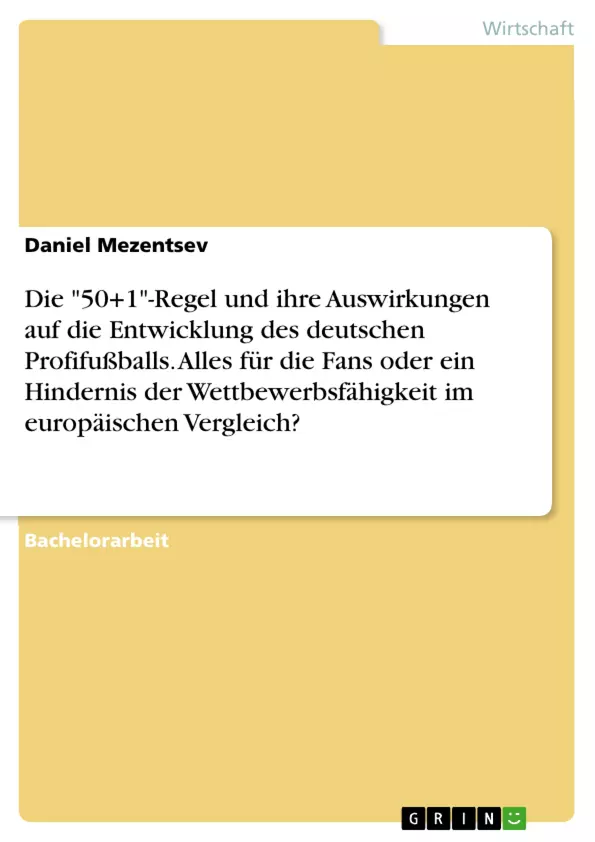Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die (internationale) Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga und deren Clubs zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Analyse der „50+1“-Regel und ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Entwicklung des deutschen Profifußballs. Dabei soll beleuchtet werden, ob diese Regel dafür eher ein Hindernis darstellt oder ob sie im Einklang mit der etablierten Fankultur sogar förderlich für den Wettbewerb sein kann. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu weit zu spannen, wird sich beim Vergleich mit anderen europäischen Top-Ligen insbesondere auf die kapitalstarke englische Premier League fokussiert, da die spanische, italienische und französische höchste Spielklasse eine ähnliche Ligastruktur aufweisen, wie das englische Pendant.
Die vorliegende Arbeit beginnt mit einer kurzen Einführung in die bestehenden Strukturen des deutschen Profifußballs, gefolgt von einer Auseinandersetzung mit den relevanten Einflüssen des Fußballs auf die Gesellschaft und Wirtschaft. Daran anknüpfend folgt eine Erklärung der grundlegenden Begriffe und Konzepte von Vereinsstrukturen und Eigentümermodellen im deutschen Fußball. Ein besonderes Augenmerk wird weiterhin auf den theoretischen Rahmen der 50+1-Regel gelegt und nachfolgend kurz auf die damit verbundene Kritik eingegangen. Im Anschluss erfolgt ein obligatorischer Blick auf die Eigentümerstrukturen englischer Clubs sowie ein finanzieller und sportlicher Vergleich der Bundesliga mit der höchsten englischen Spielklasse. Ein abschließendes Fazit, in dem die Erkenntnisse besprochen und ein Ausblick in die Zukunft der 50+1-Regel erfolgen soll, rundet diese Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Die grundlegenden Strukturen des deutschen Profifußballs
- Relevanz des Fußballs in Deutschland
- Fußball als Wirtschaftsfaktor
- Gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs
- Vereinsstrukturen und Eigentümermodelle im deutschen Profifußball
- Eingetragener Verein (e.V.)
- GmbH
- KGaA und GmbH & Co. KGaA
- AG
- Die „,50+1\"-Regel
- Ursprünge und Entstehungsgeschichte
- Inhalt, Prinzip und Zweck der „,50+1“-Regel
- Ausnahmen von der „,50+1\"-Regel
- Ausnahme für Förderer des Fußballs
- Der Fall Hannover 96 und Martin Kind
- Der Fall RB Leipzig
- Kritik und Diskussionen im Zusammenhang mit der „50+1\"-Regel
- Wettbewerbs- und kartellrechtliche Kritik
- Rolle der Fans
- Alternativen zur „50+1\"-Regel
- Abschaffung der Regel
- Wettbewerbsöffnende Änderungen mit Restriktionen
- Beibehaltung und ggf. Verschärfung der „50+1“-Regel
- Vergleich mit anderen europäischen Ligen
- Eigentumsstrukturen und Rechtsformen in der Premier League
- Finanzieller Vergleich mit der Premier League
- Vergleich des sportlichen Erfolgs mit der Premier League
- Die „50+1“-Regel als Instrument zur Sicherung der Fanrechte und der Einflussnahme der Mitglieder auf ihre Vereine
- Die Auswirkungen der „50+1“-Regel auf die finanzielle Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs im Vergleich zu anderen europäischen Ligen
- Kritikpunkte und alternative Modelle zur „50+1“-Regel
- Die Rolle der Fans im Kontext der „50+1“-Regel
- Der Einfluss der „50+1“-Regel auf den sportlichen Erfolg deutscher Fußballvereine im internationalen Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der „50+1“-Regel im deutschen Profifußball. Sie untersucht die Ursprünge, Inhalte und Auswirkungen dieser Regel im Kontext der deutschen Fußballkultur und des europäischen Wettbewerbs. Ziel ist es, die „50+1“-Regel kritisch zu analysieren und ihre Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs im internationalen Vergleich zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema der „50+1“-Regel im deutschen Profifußball. Es beleuchtet die Bedeutung des Fußballs in Deutschland und die relevanten Strukturen des deutschen Profifußballs.
Kapitel zwei befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund und analysiert die grundlegenden Strukturen des deutschen Profifußballs sowie die Relevanz des Fußballs in Deutschland. Es werden die Vereinsstrukturen und Eigentümermodelle im deutschen Profifußball detailliert untersucht.
Kapitel drei widmet sich der „50+1“-Regel. Es beleuchtet die Ursprünge und Entstehungsgeschichte der Regel, erläutert ihren Inhalt und Zweck und diskutiert wichtige Ausnahmen. Darüber hinaus werden Kritikpunkte und alternative Modelle zur „50+1“-Regel diskutiert.
Im vierten Kapitel erfolgt ein Vergleich des deutschen Profifußballs mit der Premier League in Bezug auf Eigentumsstrukturen, finanzielle Aspekte und sportlichen Erfolg.
Schlüsselwörter
„50+1“-Regel, deutscher Profifußball, Fanrechte, Wettbewerbsfähigkeit, europäischer Vergleich, Premier League, Eigentumsstrukturen, Finanzielle Aspekte, Sportlicher Erfolg, Kritik, Alternativen
- Quote paper
- Daniel Mezentsev (Author), 2023, Die "50+1"-Regel und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des deutschen Profifußballs. Alles für die Fans oder ein Hindernis der Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Vergleich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1457218