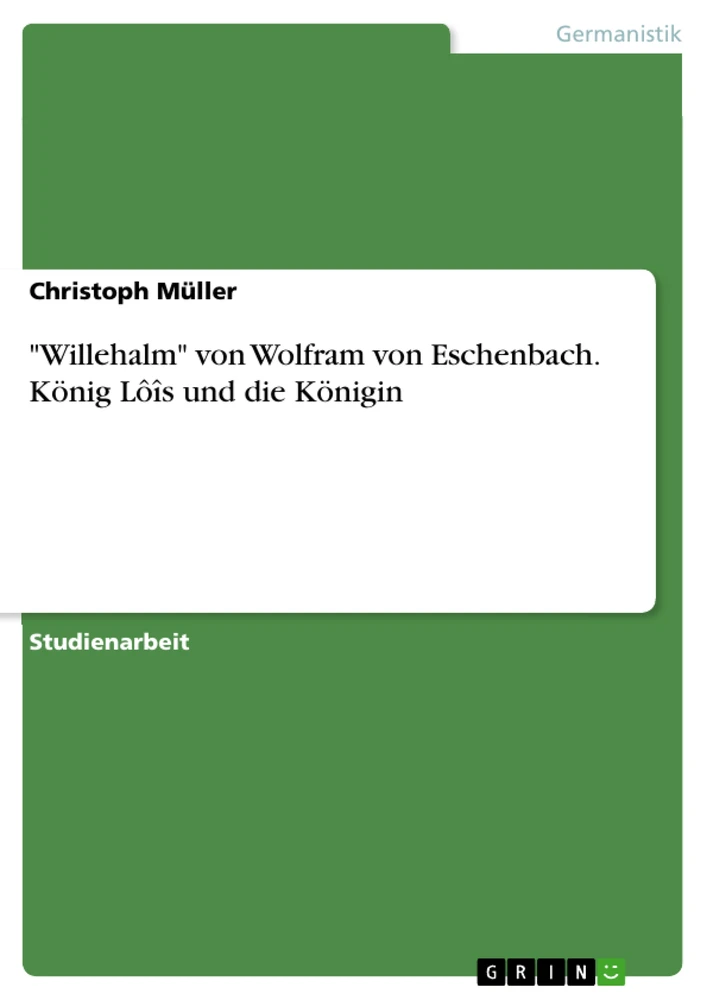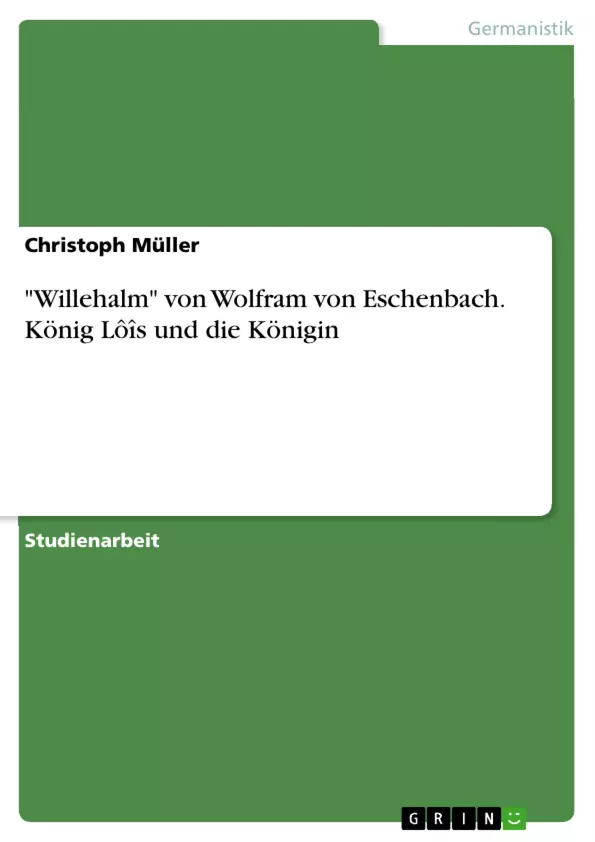In dieser Arbeit sollen neben der textinternen Charakterisierung des Königs Lôîs und seiner Ehefrau die historischen und politischen Aspekte des Willehalm im Vordergrund stehen. Ausgehend von der Figurenanalyse des Königspaares, für die besonders die Szene des Hoftags zu Munleun ausschlaggebend ist, wird der Frage nachgegangen, welchen Stellenwert das Königspaar für den Fortgang der Handlung einnimmt. Außerdem wird untersucht, inwieweit der realhistorische Hintergrund – König Lôîs ist Ludwig der Fromme, Herrscher des Frankenreiches Anfang des 9. Jahrhunderts – von Bedeutung ist und ob beziehungsweise mit welcher Absicht er verändert wurde.
Abschließend drängt sich die Frage auf, wie der Text Wolframs von Eschenbach in den politischen Kontext des frühen 13. Jahrhunderts einzuordnen ist, welches Bild der Autor als scharfsinniger Beobachter seiner Zeit von der Institution des römisch-deutschen Königtums zeichnet, das im Text durch König Lôîs repräsentiert wird und das sich zu Lebzeiten Wolframs offensichtlich in einer Krise befand und mehr als in den Jahrhunderten zuvor von den Verbindungen des Königs zu den Fürsten des Reiches abhängig war. Bezieht Wolfram mit seinem Text darüber hinaus selbst Stellung und vertritt die Interessen der Fürsten im Dualismus mit dem König, wenn man bedenkt, dass Hermann I., Landgraf von Thüringen – einer derjenigen, die den König wählten – Wolframs Auftraggeber war?
In Wolfram von Eschenbachs Willehalm steht der (kriegerische) Konflikt zwischen Christen und Moslems im Mittelpunkt, der angesichts zahlreicher Ereignisse der jüngsten Vergangenheit – etwa der Terroranschlag vom 11. September 2001 – nichts von seiner Aktualität verloren hat und eine Konstante im gesellschaftlich-religiösen Diskurs unserer Tage darstellt. Jedoch ist der Gegensatz zwischen "Okzident" und "Orient" keineswegs das einzige Thema, das die Lektüre des Textes, der bereits vor rund 800 Jahren verfasst worden ist, lohnenswert erscheinen lässt. Es kommt eine Vielzahl an thematischen Schwerpunkten und Spannungsfeldern hinzu – etwa die Topoi Gewalt, Familie und Sippengedanke, Toleranz oder die Frage nach der Rechtfertigung eines Krieges –, die unser gegenwärtiges Denken und in gleichem Maße unsere moderne Literatur zu Gegenständen ihrer Betrachtung machen. Folglich bedarf es keiner Erklärung dafür, warum Wolframs Willehalm stets literaturgeschichtlicher Forschungsgegenstand war und noch immer im Fokus der mediävistischen Forschung steht.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. König Lôîs und die Königin in Wolfram von Eschenbachs „Willehalm“
- 1. Das Königspaar im Text
- 2. Der Hoftag des Königs zu Munleun – die Begegnung mit Willehalm
- 3. Textimmanente Charakterisierung
- 3.1. König Lôîs
- 3.2. Die Königin
- 3.3. Das königliche Heer
- 4. Historischer Hintergrund – König Lôîs als Ludwig der Fromme
- 5. Politische Einordnung
- III. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Figur des Königs Lôîs und seiner Ehefrau in Wolframs von Eschenbachs „Willehalm“. Der Fokus liegt dabei auf der textinternen Charakterisierung des Königspaares, insbesondere in der Szene des Hoftags zu Munleun, sowie auf den historischen und politischen Aspekten des Werkes. Die Arbeit untersucht, welchen Stellenwert das Königspaar für die Handlung einnimmt und inwiefern die reale Figur Ludwig des Frommen als Vorbild für König Lôîs diente.
- Die Bedeutung des Königspaares für die Handlung des „Willehalm“
- Die textinterne Charakterisierung von König Lôîs und seiner Ehefrau
- Die historischen und politischen Aspekte des „Willehalm“, insbesondere die Rolle des Königs Lôîs
- Die Einordnung des Textes in den politischen Kontext des frühen 13. Jahrhunderts
- Das Bild des römischen Königtums, das Wolfram von Eschenbach in seinem Werk zeichnet
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den aktuellen gesellschaftlich-religiösen Diskurs um den Konflikt zwischen Christen und Muslimen und verdeutlicht die zeitlose Relevanz des „Willehalm“ für die heutige Zeit. Darüber hinaus werden die Hauptthemen des Werkes vorgestellt, wie z. B. Gewalt, Familie, Sippengedanke und Toleranz.
Das zweite Kapitel analysiert die Figuren des Königs Lôîs und seiner namenlosen Ehefrau. Es untersucht ihre Rolle im Text, ihre verwandtschaftliche Beziehung zu Willehalm sowie die historische Grundlage für die Figur des Königs Lôîs. Dabei wird auch auf die Unterschiede in der sprachlichen Benennung von Lôîs und seinem Vater, Karl dem Großen, eingegangen, die auf eine unterschiedliche gesellschaftliche Stellung der beiden Figuren hindeuten.
Das Kapitel „Der Hoftag des Königs zu Munleun“ stellt die Begegnung von Willehalm mit dem Königspaar dar und beleuchtet die Konflikte, die sich vor Willehalms Ankunft am Hof ankündigen.
Die textimmanente Charakterisierung des Königs Lôîs und der Königin wird im nächsten Kapitel behandelt. Dabei wird die Rolle des Königs im Konflikt zwischen Christen und Muslimen sowie die Beziehung des Königs zu seinem Heer betrachtet. Darüber hinaus wird die Königin als Figur in ihren Beziehungen zu Lôîs und Willehalm untersucht.
Das Kapitel über den historischen Hintergrund beleuchtet die Frage, inwiefern Ludwig der Fromme, Herrscher des Frankenreiches im frühen 9. Jahrhundert, als Vorbild für die Figur des Königs Lôîs diente. Die politischen Aspekte des „Willehalm“ werden im darauffolgenden Kapitel behandelt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des „Willehalm“ sind: König Lôîs, Königin, Willehalm, Hoftag, Munleun, Konflikt, Christen, Muslime, Gewalt, Familie, Sippengedanke, Toleranz, historischer Hintergrund, Ludwig der Fromme, politischer Kontext, römisch-deutsches Königtum, Fürsten, Dualismus.
- Arbeit zitieren
- Christoph Müller (Autor:in), 2010, "Willehalm" von Wolfram von Eschenbach. König Lôîs und die Königin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1458331