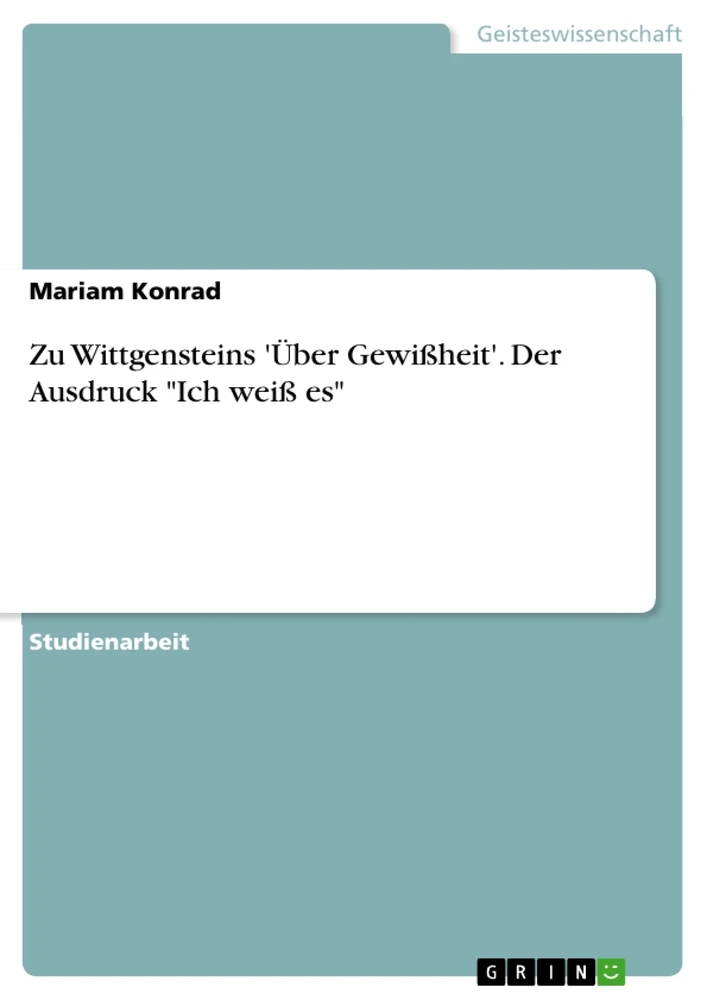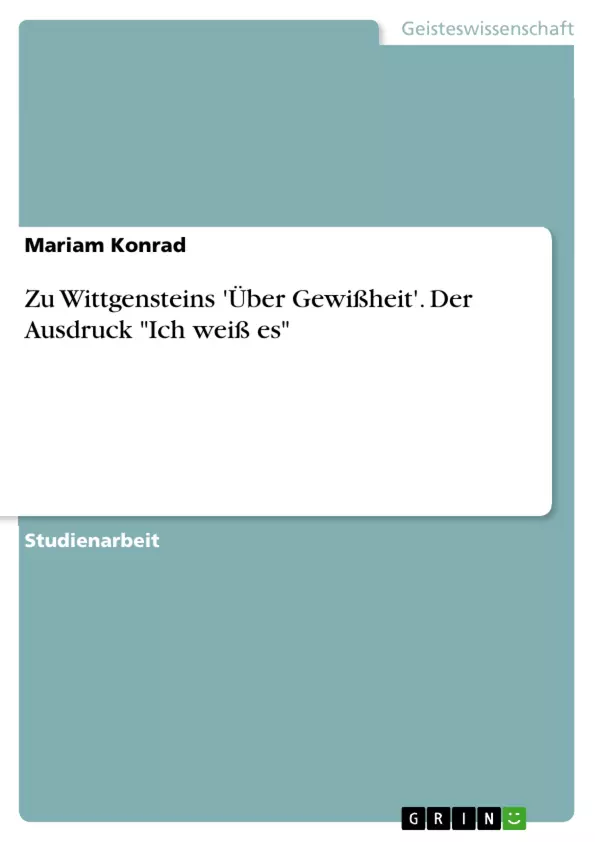Diese Hausarbeit behandelt die Frage, was Wittgenstein an Moore's 'truisms' kritisiert und ob seine Einwände plausibel sind.
Ausgangspunkt von Wittgensteins Werk "Über Gewißheit" bilden G.E. Moores Aufsätze "A Defense of Common Sense" und "Proof of an External World". Wittgensteins ÜG behandelt Themen wie Wissen, Gewissheit, Zweifel, Erfahrung, Begründung, Irrtum und Wahrheit. In der geplanten Hausarbeit wird Wittgensteins Auffassung von Wissen, im Vergleich zu Moore, untersucht. Dabei steht die Analyse der Verwendung von "ich weiß" und der Frage nach sinnvollen Aussagen im Vordergrund. Die Fragestellung lautet demnach: Können Wittgensteins Einwände gegen Moores Wissensbegriff überzeugen? Hierfür werden besonders die Paragraphen 1-65 in ÜG untersucht, da sie sich vornehmlich um den Ausdruck "ich weiß es" drehen.
Im ersten Kapitel dieser Hausarbeit wird festgehalten, was Moore sicher weiß. Nach Moore gibt es einen Körper, seinen menschlichen Körper, der in der Vergangenheit geboren wurde und sich mit der Zeit verändert hat. Für Moore entspricht dieser Satz nicht nur der Wahrheit, sondern er ist sich dessen Wahrheit auch sicher.
Im nächsten Kapitel wird der "Common Sense" von Moore beschrieben. Der "Common Sense" geht davon aus, dass man gewisse Dinge für sicher und wahr halten kann. Somit sind unsere gewöhnlichen, alltäglichen Auffassungen von der Welt im Großen und Ganzen korrekt.
In der Hausarbeit erfolgt ein kurzer Einblick in Wittgensteins ÜG. Die Paragraphen 1–65 befassen sich hauptsächlich mit dem Ausdruck "Ich weiß es" und sind für die Hausarbeit besonders relevant. Zudem wird der Begriff des Sprachspiels kurz erläutert und es wird auf den Skeptizismus eingegangen. Des Weiteren erfolgt ein Einblick in die Debatte von Wittgenstein und Moore. Wittgenstein kritisiert Moores Konzept und erläutert seine eigene Vorstellung von Gewissheit.
In einem großen Kapitel werden dann Wittgensteins Einwände gegen Moores Begriff von "ich weiß" analysiert. Nach Wittgenstein gibt es Unstimmigkeiten von Moores Verwendung des Wissensbegriffs. So kritisiert Wittgenstein die nicht klare Unterscheidung zwischen den Bedeutungen von "ich weiß". Zum Schluss folgt die Beantwortung der Fragestellung und das Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Moores Gewissheiten
- Moores Common Sense
- Wittgensteins Werk „Über Gewissheit“ und (Anti-) Skeptizismus
- Das Sprachspiel
- (Anti-) Skeptizismus
- Wittgenstein und Moore Debatte
- Wittgensteins Einwände gegen Moores Gewissheiten in Paragraph 1,2,3 und 4
- Problematik des „überzeugt sein“ und „ich weiß“
- Evidenz als Beleg
- „Ich weiß\" und die Verwendung psychologischer Wörter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Wittgensteins Werk „Über Gewissheit“ im Kontext von G.E. Moores „A Defense of Common Sense“ und untersucht Wittgensteins Kritik an Moores Wissensbegriff. Dabei wird die Verwendung des Ausdrucks „ich weiß“ und die Frage nach sinnvollen Aussagen im Vordergrund stehen. Die Hauptaugenmerk liegt auf der Analyse der Paragraphen 1-65 von „Über Gewissheit“, die sich mit der Aussage „ich weiß es“ beschäftigen. Die Arbeit zielt darauf ab, herauszufinden, ob Wittgensteins Einwände gegen Moores Wissensbegriff überzeugen können.
- Wittgensteins Kritik an Moores „Common Sense“ und dessen Verständnis von Gewissheit
- Die Bedeutung des Sprachspiels in Wittgensteins Analyse des Wissensbegriffs
- Untersuchung der Verwendung des Ausdrucks „ich weiß“ und die Unterscheidung zwischen „überzeugt sein“ und „wissen“
- Die Rolle von Evidenz und Begründungen in Wittgensteins Konzept von Gewissheit
- Analyse der Beziehung zwischen „ich weiß“ und psychologischen Wörtern
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird Moores Konzept von Gewissheit erläutert, welches auf einer Liste von unumstößlichen Aussagen basiert, die er als wahr und gewiss betrachtet. Moore argumentiert, dass diese Aussagen nicht nur der Wahrheit entsprechen, sondern er sich ihrer Wahrheit auch sicher ist. Das zweite Kapitel beschreibt Moores „Common Sense“-Philosophie, die davon ausgeht, dass gewisse Dinge als wahr und sicher angenommen werden können und dass unsere alltäglichen Auffassungen von der Welt im Großen und Ganzen korrekt sind. Im dritten Kapitel erfolgt eine Einführung in Wittgensteins Werk „Über Gewissheit“ und eine kurze Erläuterung des Sprachspiels. Des Weiteren wird der (Anti-) Skeptizismus in Bezug auf Wittgensteins Philosophie betrachtet. Das vierte Kapitel beleuchtet die Debatte zwischen Wittgenstein und Moore, wobei Wittgensteins Kritik an Moores Konzept von „ich weiß“ im Mittelpunkt steht. Wittgenstein argumentiert, dass es Unstimmigkeiten in Moores Verwendung des Wissensbegriffs gibt und dass eine klare Unterscheidung zwischen den Bedeutungen von „ich weiß“ notwendig ist.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Themen Gewissheit, Wissen, Zweifel, Erfahrung, Begründung, Irrtum und Wahrheit. Im Zentrum stehen die philosophischen Ansätze von G.E. Moore und Ludwig Wittgenstein. Die Arbeit analysiert Moores „Common Sense“ und Wittgensteins Werk „Über Gewissheit“, wobei insbesondere die Verwendung des Ausdrucks „ich weiß“ im Vordergrund steht. Die zentralen Konzepte der Arbeit sind Sprachspiel, Evidenz, (Anti-)Skeptizismus und die Unterscheidung zwischen „überzeugt sein“ und „wissen“. Die Arbeit beleuchtet die Kritik von Wittgenstein an Moores Wissensbegriff und untersucht, ob Wittgensteins Einwände überzeugen können.
- Arbeit zitieren
- Mariam Konrad (Autor:in), 2024, Zu Wittgensteins 'Über Gewißheit'. Der Ausdruck "Ich weiß es", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1458878