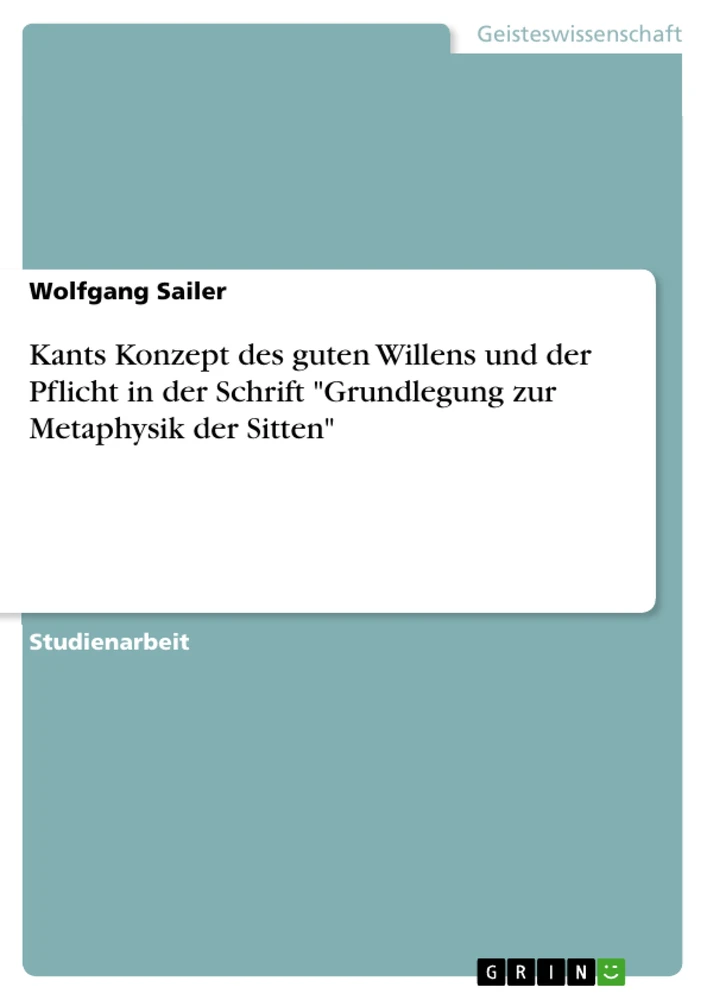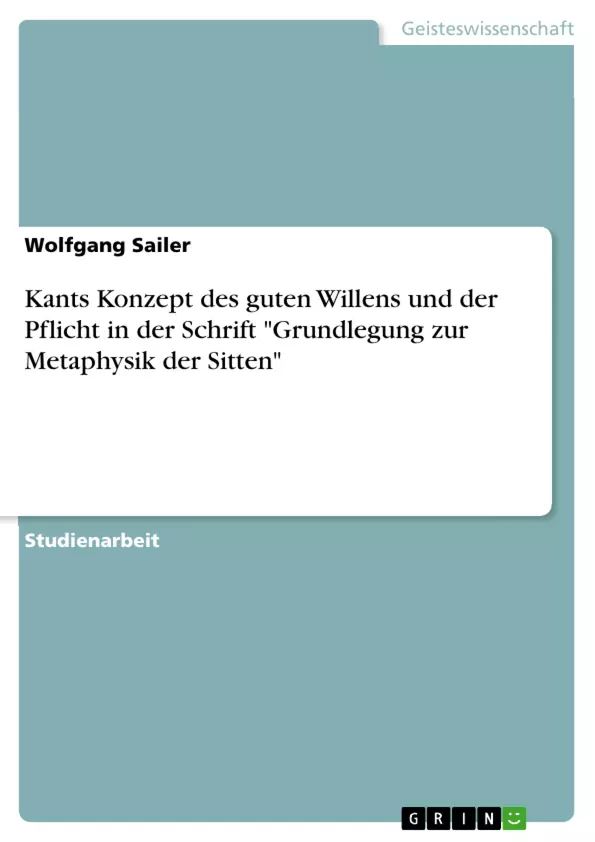In seiner Schrift „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ entwickelt Kant den Grundriss einer reinen Moralphilosophie. Im ersten Abschnitt seiner Schrift beschreibt Kant den Übergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis zur philosophischen. Dabei spielen in seinen Gedankengängen die Begriffe des „guten Willens“ und der „Pflicht“ eine zentrale Rolle beim Aufsuchen des obersten Prinzips der Moralität. Doch welche Vorstellung hat Kant von einem guten Willen? Was ist für ihn im Grunde gut und das Gute? Wie kann sein Verständnis von gut von anderen Formen des Guten unterschieden und das Gute a priori bestimmt werden? Auch stellt sich die Frage, welche Vorstellung Kant von Pflicht hat, wem gegenüber eine Pflicht besteht und was für ihn Handeln aus Pflicht bedeutet? Und schließlich welche Rollen spielen guter Wille und Handeln aus Pflicht in Bezug auf das oberste Prinzip der Moralität?
In seinen Ausführungen geht der Autor auf diese Fragen ein. Anhand einschlägiger Textstellen und ihrer Interpretation sucht er nach Antworten, greift dabei aber auch auf Kommentierungen zurück. Um den Rahmen einer Studienarbeit einzuhalten, beschränkt er sich auf den ersten Abschnitt der Grundlegung, in dem die Begriffe des „guten Willens“ und der „Pflicht“ ohnehin die herausgehobene Stellung einnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des guten Willens.
- Der bedingte Wert von Naturgaben.
- Der eingeschränkte Wert von Glücksgaben
- Tauglichkeit und Wirkung des guten Willens
- Glückseligkeit und guter Wille.
- Der uneingeschränkt gute Wille......
- Der Begriff der Pflicht........
- Der erste Satz zur Pflicht
- Der zweite Satz zur Pflicht
- Der dritte Satz zur Pflicht
- Schlussbemerkung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Kants Schrift „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ zielt darauf ab, das oberste Prinzip der Moralität zu ergründen und zu definieren. Sie strebt eine reine Moralphilosophie an, die sich von empirischen Aspekten und Anwendungen auf konkrete Handlungen löst. Kant kritisiert den damaligen Stand der Ethik, der eine Vermischung empirischer und rationaler Begründungen aufweist. Um diese Verwirrung zu beseitigen, plädiert er für eine reine Moralphilosophie, die sich auf Vernunftprinzipien a priori stützt.
- Der gute Wille als oberstes Prinzip der Moralität
- Das Verhältnis von Naturgaben, Glücksgaben und gutem Willen
- Die Rolle der Pflicht in Kants Moralphilosophie
- Die drei Sätze zur Pflicht
- Der kategorische Imperativ als universelles moralisches Gesetz
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Abschnitt der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ befasst sich mit dem Übergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis zur philosophischen. Kant argumentiert, dass der gute Wille das oberste Prinzip der Moralität sei, da er uneingeschränkt gut sei. Er definiert den guten Willen als den Willen, der das moralische Gesetz befolgt. Die Naturgaben, wie z.B. Verstand, Witz, und Mut, sind für Kant nicht uneingeschränkt gut, da sie für gute wie für böse Zwecke verwendet werden können.
Im zweiten Abschnitt werden die drei Sätze zur Pflicht erörtert. Der erste Satz besagt, dass es immer eine moralische Pflicht gibt, etwas zu tun, das notwendig ist, um andere zu retten. Der zweite Satz besagt, dass es eine moralische Pflicht gibt, die Glückseligkeit anderer zu fördern. Der dritte Satz besagt, dass es eine moralische Pflicht gibt, sich selbst zu respektieren.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe, die im ersten Abschnitt der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ behandelt werden, sind: guter Wille, Pflicht, kategorischer Imperativ, Naturgaben, Glücksgaben, Moralität, Vernunftprinzipien, a priori, objektivierter Begriff der Moral, universelles Sittengesetz.
- Quote paper
- Wolfgang Sailer (Author), 2023, Kants Konzept des guten Willens und der Pflicht in der Schrift "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1458997