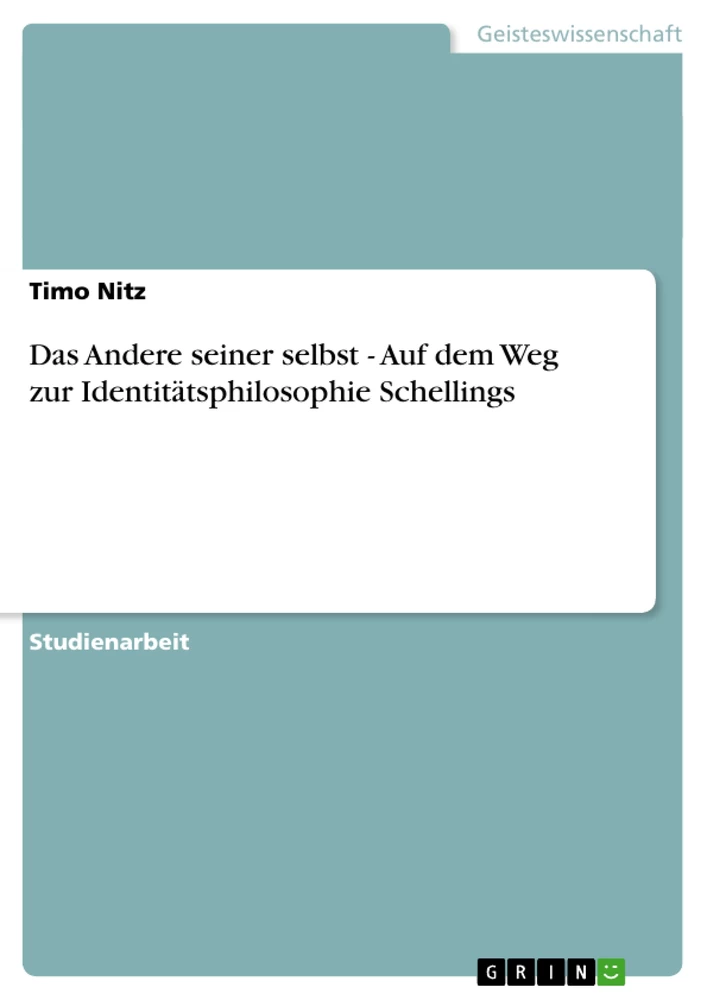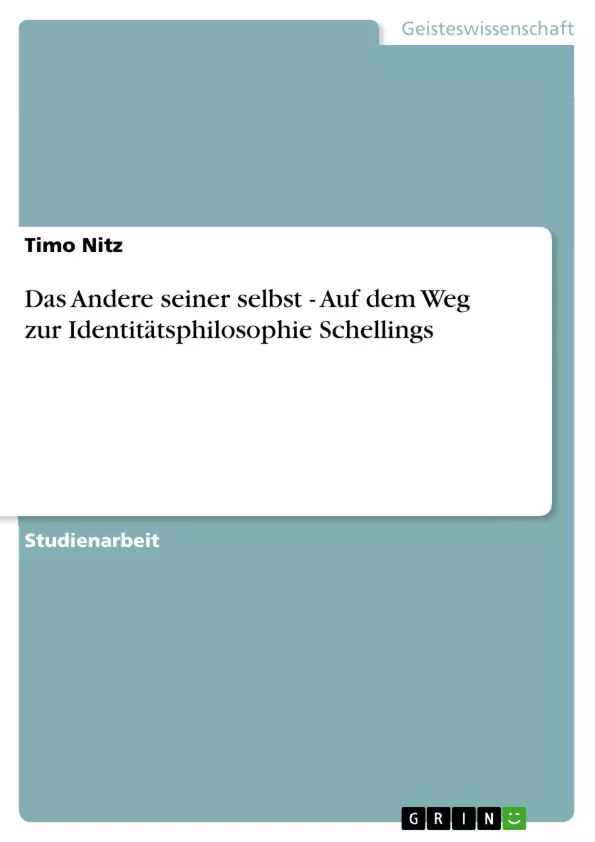In einem Brief an Eschenmayer schrieb Schelling, ihm sei im Jahre 1801 das "Licht in der Philo-sophie aufgegangen".
Doch was sollte Schelling im Jahre 1801 nun erkennen können, was ihm zuvor im Dunklen verborgen war? Seit längerem schon fesselte ihn der Gedanke, man müsse "zur ältesten Philosophie zurückkehren", um zu erkennen, dass es nur Eine absolut-erste Wahrheit gibt, nur Einen Gegenstand, nur Eine Philosophie!
Dieses Bestreben wird vor allem in seinen Betrachtungen zur Natur- und Transzendentalphilosophie deutlich, in dem er bereits betont, dass diese beiden theoretischen Ansätze doch eigentlich nur eine Philosophie sein könnten, die nur aus verschieden Perspektiven betrachtet wird. Das "Licht" von dem Schelling spricht, kann also unmöglich die Idee selbst sein, dass in Wahrheit alles Eines ist. Das, was Schelling jedoch im Jahre 1801 erblickte, war die Philosophie dieser Idee selbst, will heißen: das theoretische Gesamtkonstrukt, das ihn behaupten ließ, dass es nur EINE Wahrheit gibt. Das Licht fiel somit auf die Theorie, ließ ein "System" sichtbar werden, das versprach, alles Bisherige zu vereinigen. Diese neue bzw. durch das "Licht" erweiterte Sicht in der Philosophie bestärkte ihn schließlich in seiner Darstellung meines Systems der Philosophie (1801).
In der vorliegenden Arbeit wollen wir diesem Grundgedanken der "Einen Philosophie" nachgehen und aufzeigen, wie Schelling sich diese absolut-erste Wahrheit vorstellt. Um aus der Dunkelheit emporzusteigen, verläuft unser Weg durch die Schriften Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt (Formschrift) aus dem Jahre 1794), Vom Ich als Princip der Philosophie (Ich-Schrift; 1795) schließlich zur Darstellung meines Systems der Philosophie (Identitätsphilosophie; 1801). Ziel unseres Weges und damit Ergebnis unserer Betrachtung ist demnach die Entfaltung eines philosophischen Systems, das Schelling selbst an anderer Stelle auch einmal als "absolutes Identitätssystem" bezeichnete.
Inhaltsverzeichnis
- Zum einleitenden „Licht in der Philosophie“
- Der Mangel als Ausgangspunkt „unendlicher“ Betrachtungen
- Über das Erste und Eine in der Wissenschaft
- Form und Inhalt
- Die Bedingung der Unbedingtheit
- Der oberste Grundsatz
- Vom ICH zum Absoluten
- Die Identitätsphilosophie Schellings
- Der Indifferenzpunkt
- Die Einheit der Einheit der Gegensätze
- Identität und/oder Indifferenz
- ,,Der wahre Sinn" als eine abschließende Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, Schellings Weg zur Identitätsphilosophie nachzuvollziehen und sein Verständnis der „absolut-ersten Wahrheit“ zu erläutern. Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Schriften Schellings, um die Entwicklung seines Denkens von der frühen „Formschrift“ bis zur „Darstellung meines Systems der Philosophie“ nachzuzeichnen.
- Schellings Suche nach einem obersten philosophischen Prinzip
- Die Kritik an Kant und die Überwindung des Mangels in dessen System
- Die Entwicklung des Konzepts der Identität und des Indifferenzpunkts
- Die Rolle des „Ich“ im Aufbau von Schellings System
- Die Einheit von Natur- und Transzendentalphilosophie in der Identitätsphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Zum einleitenden „Licht in der Philosophie“: Dieses Kapitel beleuchtet Schellings Erleuchtung von 1801, die ihn zu der Überzeugung führte, dass es nur eine einzige, absolut-erste Wahrheit und damit eine einzige Philosophie gibt. Es beschreibt Schellings Bestreben, diese „eine Philosophie“ zu entwickeln, indem er seine früheren Arbeiten zur Natur- und Transzendentalphilosophie integriert. Das „Licht“ wird als die Erkenntnis des theoretischen Gesamtkonstrukts verstanden, das diese Einheit ermöglicht und in der „Darstellung meines Systems der Philosophie“ zum Ausdruck kommt. Die Arbeit selbst verfolgt diesen Grundgedanken weiter, indem sie Schellings Schriften analysiert, um seinen Weg zur Identitätsphilosophie zu rekonstruieren.
Der Mangel als Ausgangspunkt „unendlicher“ Betrachtungen: Dieses Kapitel untersucht die Beweggründe Schellings für seine philosophischen Unternehmungen, die er selbst in einem Mangel sieht, der sich besonders im Studium der Kantischen Kritik der reinen Vernunft zeigte. Schelling kritisiert Kants Unvermögen, eine Urform aller Philosophie auf ein oberstes Prinzip zurückzuführen. Der Mangel an einem solchen Prinzip wird als Ausgangspunkt für Schellings eigene Suche nach einer umfassenden und begründeten Philosophie angesehen, die das gesamte Problem der Möglichkeit der Philosophie lösen soll. Der Mangel bei Kant wird als fehlendes grundlegendes Prinzip in den Kantischen Deduktionen betrachtet, welches Schelling aufheben will.
Schlüsselwörter
Identitätsphilosophie, Schelling, Absolut-erste Wahrheit, Kantkritik, Naturphilosophie, Transzendentalphilosophie, Indifferenzpunkt, Identität, Form und Inhalt, oberstes Prinzip, „eine Philosophie“.
Häufig gestellte Fragen zu Schellings Identitätsphilosophie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Friedrich Schellings Weg zur Identitätsphilosophie und erläutert sein Verständnis der „absolut-ersten Wahrheit“. Sie verfolgt die Entwicklung seines Denkens von frühen Schriften bis zur „Darstellung meines Systems der Philosophie“, indem sie ausgewählte Texte Schellings untersucht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Schellings Suche nach einem obersten philosophischen Prinzip, seine Kritik an Kant und die Überwindung des Mangels in Kants System, die Entwicklung des Konzepts der Identität und des Indifferenzpunkts, die Rolle des „Ich“ in Schellings System und die Einheit von Natur- und Transzendentalphilosophie in der Identitätsphilosophie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Die Kapitel befassen sich mit Schellings „Licht in der Philosophie“, dem Mangel als Ausgangspunkt seiner Betrachtungen, dem Ersten und Einen in der Wissenschaft (inkl. Form und Inhalt, Bedingung der Unbedingtheit und obersten Grundsatz), dem Weg vom ICH zum Absoluten, Schellings Identitätsphilosophie (inkl. Indifferenzpunkt, Einheit der Gegensätze und Identität/Indifferenz) und einer abschließenden Zusammenfassung.
Was ist Schellings „Licht in der Philosophie“?
Dieses Kapitel beschreibt Schellings Erleuchtung von 1801, die ihn zur Überzeugung führte, dass es nur eine einzige, absolut-erste Wahrheit und damit nur eine Philosophie gibt. Das „Licht“ repräsentiert die Erkenntnis des theoretischen Gesamtkonstrukts, das diese Einheit ermöglicht und in der „Darstellung meines Systems der Philosophie“ zum Ausdruck kommt.
Welche Kritik übt Schelling an Kant?
Schelling kritisiert Kants Unvermögen, eine Urform aller Philosophie auf ein oberstes Prinzip zurückzuführen. Der Mangel an diesem Prinzip in Kants Deduktionen bildet den Ausgangspunkt für Schellings Suche nach einer umfassenden Philosophie.
Welche Rolle spielt der „Indifferenzpunkt“ in Schellings Philosophie?
Der Indifferenzpunkt ist ein zentrales Konzept in Schellings Identitätsphilosophie und wird in einem eigenen Kapitel ausführlich behandelt. Er repräsentiert die Einheit der Gegensätze und ist eng mit dem Begriff der Identität verbunden.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Identitätsphilosophie, Schelling, Absolut-erste Wahrheit, Kantkritik, Naturphilosophie, Transzendentalphilosophie, Indifferenzpunkt, Identität, Form und Inhalt, oberstes Prinzip und „eine Philosophie“.
Wo findet man weitere Informationen zu Schellings Philosophie?
Weitere Informationen lassen sich durch die detaillierte Analyse der in der Arbeit genannten Schriften Schellings gewinnen. Die Arbeit selbst dient als fundierte Einführung und Überblick über Schellings Identitätsphilosophie.
- Arbeit zitieren
- Timo Nitz (Autor:in), 2010, Das Andere seiner selbst - Auf dem Weg zur Identitätsphilosophie Schellings, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145902