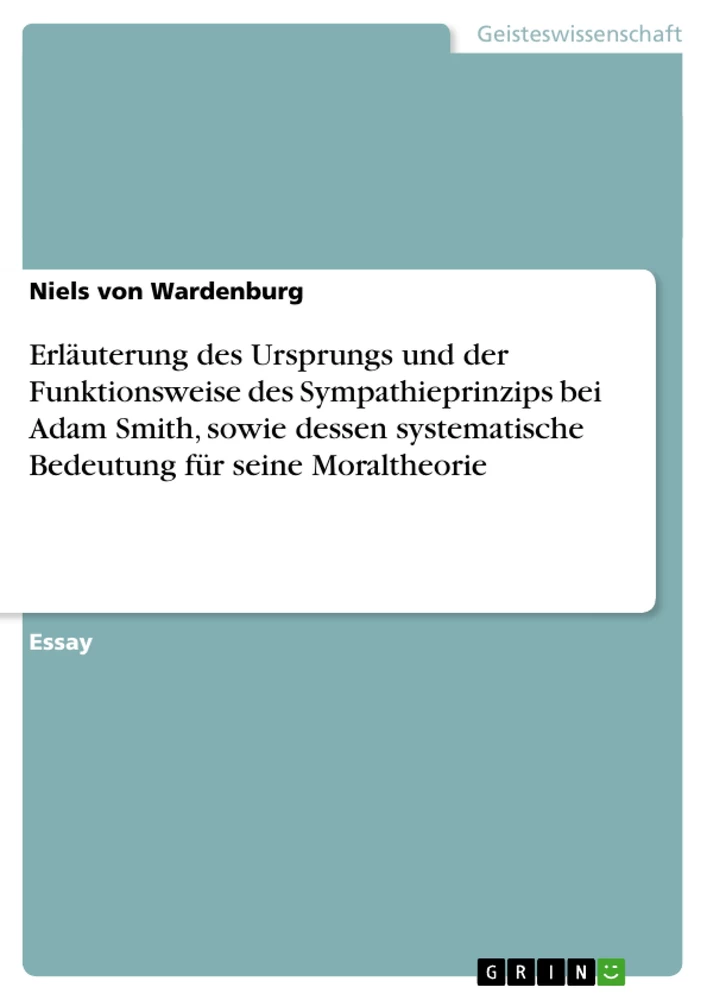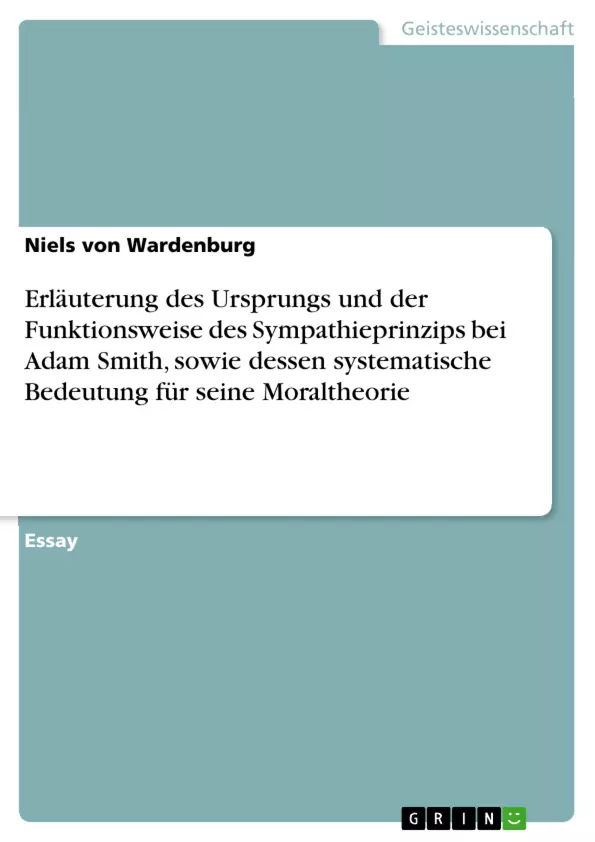Vor knapp zwei Jahrzehnten machten italienische Neurophysiologen eine bahnbrechende Entdeckung: die sog. Spiegelneuronen. Sie werden so bezeichnet, da sie Tiere wie Menschen dazu befähigen, das Verhalten anderer zu spiegeln, d.h. das Verhalten gedanklich nachzuvollziehen. Diese Spiegelung ist für das Lernen durch Nachahmen verantwortlich, bspw. für die Erlernung der Sprache beim Menschen. Kürzlich erst entdeckten sie, dass nicht nur das Verhalten, sondern auch Empfindungen gespiegelt werden. Dieses Vermögen wird von ihnen als Empathie oder Einfühlungsvermögen bezeichnet. Das bedeutet aber nicht, dass man die Gefühle des Gegenübers auf gleiche Weise fühlt. Wenn es aber zu einem gemeinsamen Gefühl kommt, bezeichnen sie es als Mitgefühl.
Der schottische Philosoph Adam Smith hat bereits im 18. Jahrhundert dieses Vermögen des Menschen und die enorme Auswirkung desselben auf unser Verhalten erkannt. Er entfaltete auf Basis dieses Vermögens eine Theorie, die erklären soll, nach welchen Prinzipien sich der Mensch naturgemäß Urteile über Verhalten und Charakter seiner Mitmenschen und seiner selbst bildet. Für das Mitgefühl verwendet Smith den Begriff der Sympathie. Dieses Essay soll erläutern, worin die Ursprünge des Sympathieprinzips bei Adam Smith liegen, wie er aus diesem seine Theorie entwickelt und zuletzt, welche Bedeutung es für seine Moraltheorie insgesamt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Ursprung des Sympathieprinzips
- 2. Funktionsweise des Sympathieprinzips
- 2.1. Grundsätzliches über die Sympathie
- 2.2. Über die,,sympathetische\" Urteilsbildung
- 2.2.1. Grundsätzliches über die „sympathetische“ Urteilsbildung
- 2.2.2. Die Beurteileiung von einem Handelnden und einem Betroffenen
- 2.2.3. Über die Selbstliebe und die Selbstbeurteilung
- 3. Bedeutung des Sympathieprinzips für Smiths Moraltheorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Essay untersucht den Ursprung und die Funktionsweise des Sympathieprinzips in Adam Smiths Moralphilosophie. Es analysiert, wie Smith aus dem Vermögen des Menschen, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen, eine Theorie der Urteilsbildung über Verhalten und Charakter entwickelt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Rolle des Sympathieprinzips in Smiths Theorie.
- Ursprünge des Sympathieprinzips bei Adam Smith
- Funktion und Bedeutung des Sympathieprinzips für die Urteilsbildung
- Verbindung des Sympathieprinzips mit der Selbstliebe und Selbstbeurteilung
- Systematische Bedeutung des Sympathieprinzips für Smiths Moraltheorie
- Einfluss von Philosophen wie Shaftesbury, Hume und Hutcheson auf Smiths Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Entdeckung der Spiegelneuronen und deren Bedeutung für das Verständnis von Empathie und Mitgefühl vor. Sie führt ein in Adam Smiths Moralphilosophie und die zentrale Rolle des Sympathieprinzips.
Kapitel 1 beleuchtet den Ursprung des Sympathieprinzips bei Adam Smith, indem es seine Verbindung zu früheren Philosophen wie Shaftesbury, Hume und Hutcheson aufzeigt. Es wird erläutert, wie Smith von diesen Ideen beeinflusst wurde und wie er sie in seine eigene Theorie integriert hat.
Kapitel 2 befasst sich mit der Funktionsweise des Sympathieprinzips. Es beschreibt, wie wir uns in die Lage anderer Menschen hineinversetzen und deren Affekte nachvollziehen können. Dabei werden die Grenzen des Einfühlungssvermögens und die Rolle von Selbstbeherrschung und Einfühlungsvermögen in der „sympathetischen“ Urteilsbildung diskutiert.
Schlüsselwörter
Sympathieprinzip, Moralphilosophie, Adam Smith, Shaftesbury, Hume, Hutcheson, Spiegelneuronen, Empathie, Mitgefühl, Urteilsbildung, Verhalten, Charakter, Selbstliebe, Selbstbeurteilung, Einfühlungssvermögen, Selbstbeherrschung, Sensibilität.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Adam Smith unter dem Begriff "Sympathie"?
Sympathie bezeichnet bei Smith das Mitgefühl oder das Vermögen des Menschen, durch die Einbildungskraft an den Empfindungen anderer teilzuhaben, unabhängig davon, ob diese angenehm oder unangenehm sind.
Wie funktioniert die "sympathetische" Urteilsbildung?
Wir bilden uns Urteile, indem wir uns in die Lage des Handelnden und des Betroffenen versetzen. Ein Verhalten wird als „schicklich“ empfunden, wenn wir die Gefühle des anderen voll nachvollziehen können.
Welchen Einfluss hatten andere Philosophen auf Smiths Theorie?
Smith wurde stark von Denkern wie Shaftesbury, David Hume und Francis Hutcheson beeinflusst, entwickelte deren Ideen zum moralischen Gefühl jedoch zu einem umfassenden System der sozialen Urteilsbildung weiter.
Was ist die Bedeutung des "unparteiischen Beobachters"?
Der unparteiische Beobachter ist eine innere Instanz, die uns hilft, unser eigenes Verhalten aus der Perspektive eines Dritten zu beurteilen und so über die reine Selbstliebe hinauszuwachsen.
Gibt es eine Verbindung zwischen Smiths Theorie und modernen Spiegelneuronen?
Ja, die Einleitung des Essays zieht eine Parallele zwischen Smiths Konzept der Sympathie und der Entdeckung der Spiegelneuronen, die biologisch erklären, wie wir das Verhalten und die Empfindungen anderer „spiegeln“.
- Quote paper
- Niels von Wardenburg (Author), 2009, Erläuterung des Ursprungs und der Funktionsweise des Sympathieprinzips bei Adam Smith, sowie dessen systematische Bedeutung für seine Moraltheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145983