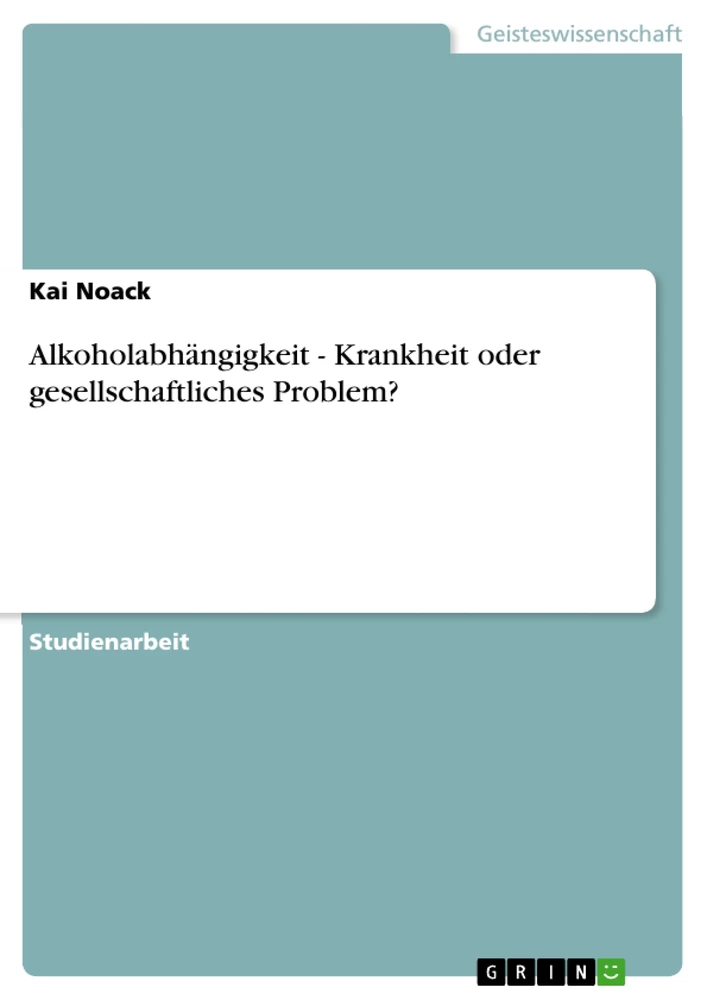Alkohol gilt als Kurzbezeichnung des chemischen Stoffes Ethylalkohol mit der Formel C2H5OH. Vielfältig angewandt wird er als Zusatz in Getränken aber auch in der Medizin als Desinfektions- oder Lösungsmittel (Pschyrembel 2002). Der Genuss von alkoholischen Getränken ist Teil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. Im privaten Umfeld, wie auch bei geschäftlichen Verhandlungen oder Festen wird Alkohol getrunken. Durch die berauschende Wirkung werden soziale Kontakte sowie Kommunikationen erleichtert und die Entspannung gefördert. Alkohol ist bereits seit Jahrtausenden bekannt und wurde bis in das 19.Jahrhundert als Lebenselixier und Heilmittel geschätzt. Seit dem hat sich das Produktions- und Konsumverhalten mit Einführung der industriellen Herstellung und dem Überangebot nach dem 2. Weltkrieg dramatisch verändert (Stat. Bundesamt 2007, S.278). Die Kehrseite des Alkoholkonsums ist ein hohes Potential an Gesundheits- und Suchtgefährdung. Das individuelle Risiko alkoholbedingt zu erkranken steigt mit der Menge des aufgenommenen Alkohols. Aus diesem Grund wurden durch verschiedene Organisationen Konsumklassen definiert. Da es keinen risikofreien Alkoholkonsum gibt, wurde ein risikoarmer Konsum reinen Alkohols für Männer bis 30 bzw. 40 g und für Frauen bis 20 g pro Tag angegeben. Ein riskanter Konsum besteht bei Männern mit 30 bis 60 g und bei Frauen mit 20 bis 40 g pro Tag. Als gefährlich wird der Konsum reinen Alkohols bis 120 g (Männer) bzw. 80 g (Frauen) täglich eingestuft (DHS 2003, S.14).
Legt man die aktuellen Statistiken zugrunde ist ein konstant rückläufiger Alkoholkonsum der Bevölkerung in Deutschland zu verzeichnen. Betrachtet man jedoch die verschiedenen Altersgruppen, trifft das nicht auf Jugendliche und junge Erwachsene zu. Ein tragisches Beispiel ist der 16-jährige Lukas aus Berlin. Er starb auf Grund einer Alkoholintoxikation mit 4,8 ‰ nach 45 Tequila im März 2007. Liest man regelmäßig Zeitung, wird schnell klar, dass Lukas kein Einzelfall ist. Das sogenannte Rauschtrinken auf „Flatrate-Partys“ nimmt unter Jugendlichen und sogar Kindern immer mehr zu. Wenn sich diese Tendenz fortsetzt, werden wir in Deutschland schon bald wieder steigende Zahlen alkoholabhängiger Personen verzeichnen müssen.
Es bleibt die Frage nach der Motivation des Rauschtrinkens bei Jugendlichen. Wird ihnen das Alkoholtrinken in der Familie vorgelebt, ist es eine Mutprobe oder wie bei Lukas eine Wette mit unberechenbarem Ausgang?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Epidemiologie
- 3. Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen
- 3.1 Akute Alkoholintoxikation (F10.0) und Missbrauch (F10.1)
- 3.2 Alkoholabhängigkeit (F10.2)
- 3.3 Alkoholinduzierte körperliche Störungen
- 4. Ursachen
- 4.1 Genetische Disposition
- 4.2 Soziokulturelle Faktoren
- 4.3 Psychosoziale Faktoren
- 5. Störungen durch Alkohol als wachsendes Problem in der sozialen Arbeit
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Alkoholabhängigkeit als komplexes Phänomen, das sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Aspekte umfasst. Ziel ist es, die epidemiologischen Daten zu beleuchten, verschiedene Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen zu beschreiben und die Ursachen der Abhängigkeit zu analysieren. Die Rolle der sozialen Arbeit im Umgang mit den wachsenden Problemen wird ebenfalls betrachtet.
- Epidemiologie des Alkoholkonsums in Deutschland
- Verschiedene Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen (Intoxikation, Missbrauch, Abhängigkeit)
- Ursachen der Alkoholabhängigkeit (genetische, soziokulturelle, psychosoziale Faktoren)
- Alkoholabhängigkeit als gesellschaftliches Problem und die Rolle der sozialen Arbeit
- Kosten und Folgen von Alkoholmissbrauch für Individuum und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Alkoholabhängigkeit ein und definiert Alkohol als chemische Substanz mit vielfältigen Anwendungen. Sie betont den gesellschaftlichen Aspekt des Alkoholkonsums und dessen historische Entwicklung, kontrastiert den traditionellen Gebrauch mit dem modernen, oft problematischen Konsumverhalten. Die Einleitung unterstreicht die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Risiken von übermäßigem Alkoholkonsum, definiert risikoreiche und gefährliche Konsummengen und führt das tragische Beispiel von Lukas als eindrückliche Illustration jugendlichen Rauschtrinkens an. Die Einleitung stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor: die Definition von Alkoholabhängigkeit, die Ursachen der Abhängigkeit und die Rolle der sozialen Arbeit in der Prävention und Intervention.
2. Epidemiologie: Dieses Kapitel beleuchtet die epidemiologischen Daten zum Alkoholkonsum in Deutschland. Es werden aktuelle Statistiken zum Alkoholkonsum der Gesamtbevölkerung und insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen analysiert, um den Trend des Alkoholkonsums und die damit verbundenen Risiken zu bewerten. Vermutlich werden hier statistische Daten zu Häufigkeiten, Altersgruppen und regionalen Unterschieden im Konsumverhalten präsentiert, um ein umfassendes Bild der epidemiologischen Lage zu liefern. Dieser Abschnitt bildet die Grundlage für das Verständnis des Ausmaßes des Problems der Alkoholabhängigkeit in Deutschland.
3. Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen, darunter die akute Alkoholintoxikation, Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit. Es definiert diese Störungen, beschreibt ihre Symptome und unterscheidet zwischen verschiedenen Subtypen und Verläufen der Alkoholabhängigkeit. Weiterhin werden die alkoholinduzierten körperlichen Störungen, sowohl organische Schädigungen als auch Störungen des Nervensystems, detailliert erläutert. Das Kapitel bietet eine umfassende Übersicht der möglichen Folgen exzessiven Alkoholkonsums und verdeutlicht den breiten Spektrum der damit verbundenen gesundheitlichen Probleme.
4. Ursachen: Das Kapitel untersucht die Ursachen der Alkoholabhängigkeit. Es wird vermutlich auf die komplexen Zusammenhänge zwischen genetischen Dispositionen, soziokulturellen und psychosozialen Faktoren eingegangen. Die genetische Komponente könnte die Rolle von vererbten Anlagen erläutern, während die soziokulturellen Faktoren den Einfluss von gesellschaftlichen Normen, kulturellen Traditionen und dem sozialen Umfeld beleuchten. Psychosoziale Faktoren könnten Faktoren wie Stress, Traumata und psychische Vorbelastungen berücksichtigen. Dieses Kapitel betont den multifaktoriellen Charakter der Alkoholabhängigkeit und den Zusammenhang von individuellen und umweltbedingten Einflüssen.
5. Störungen durch Alkohol als wachsendes Problem in der sozialen Arbeit: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen, die Alkoholabhängigkeit für die soziale Arbeit darstellt. Es untersucht die Auswirkungen von Alkoholmissbrauch auf Individuen und Familien sowie die Rolle der sozialen Arbeit in der Prävention und Intervention. Wahrscheinlich werden hier Strategien und Programme zur Bekämpfung von Alkoholabhängigkeit im Kontext der sozialen Arbeit beleuchtet. Das Kapitel hebt die Bedeutung der sozialen Arbeit für die Unterstützung Betroffener und die Prävention von Alkoholproblemen hervor.
Schlüsselwörter
Alkoholabhängigkeit, Epidemiologie, Alkoholmissbrauch, Alkoholintoxikation, soziale Arbeit, Prävention, Intervention, genetische Faktoren, soziokulturelle Faktoren, psychosoziale Faktoren, gesellschaftliche Kosten, Gesundheitsrisiken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Alkoholabhängigkeit: Eine umfassende Übersicht"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Alkoholabhängigkeit. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Epidemiologie, den Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen, den Ursachen der Abhängigkeit und der Rolle der sozialen Arbeit im Umgang mit diesem Problem.
Welche Kapitel sind enthalten?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Epidemiologie, Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen (inklusive akuter Intoxikation, Missbrauch und Abhängigkeit sowie alkoholinduzierter körperlicher Störungen), Ursachen (genetische, soziokulturelle und psychosoziale Faktoren), Störungen durch Alkohol als wachsendes Problem in der sozialen Arbeit und Zusammenfassung.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte?
Die Arbeit untersucht Alkoholabhängigkeit als komplexes Phänomen mit individuellen und gesellschaftlichen Aspekten. Ziel ist es, epidemiologische Daten zu beleuchten, verschiedene Erscheinungsformen zu beschreiben, Ursachen zu analysieren und die Rolle der sozialen Arbeit zu betrachten. Die Themenschwerpunkte umfassen die Epidemiologie des Alkoholkonsums in Deutschland, verschiedene Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen, Ursachen der Alkoholabhängigkeit (genetische, soziokulturelle und psychosoziale Faktoren), Alkoholabhängigkeit als gesellschaftliches Problem und die Rolle der sozialen Arbeit sowie die Kosten und Folgen von Alkoholmissbrauch.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein, definiert Alkohol, betont den gesellschaftlichen Aspekt und die historische Entwicklung des Alkoholkonsums. Sie unterstreicht die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Risiken, definiert risikoreiche Konsummengen und stellt die zentralen Forschungsfragen vor (Definition von Alkoholabhängigkeit, Ursachen und Rolle der sozialen Arbeit).
Was beinhaltet das Kapitel zur Epidemiologie?
Das Kapitel präsentiert epidemiologische Daten zum Alkoholkonsum in Deutschland, analysiert aktuelle Statistiken zum Konsum der Gesamtbevölkerung und insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, und bewertet den Trend des Alkoholkonsums und die damit verbundenen Risiken. Es liefert ein umfassendes Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland.
Welche Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen werden behandelt?
Das Kapitel beschreibt verschiedene Erscheinungsformen wie akute Alkoholintoxikation, Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit, definiert diese Störungen, beschreibt ihre Symptome und unterscheidet zwischen Subtypen und Verläufen. Es erläutert detailliert alkoholinduzierte körperliche Störungen (organische Schädigungen und Störungen des Nervensystems).
Welche Ursachen für Alkoholabhängigkeit werden untersucht?
Das Kapitel untersucht die komplexen Zusammenhänge zwischen genetischen Dispositionen, soziokulturellen und psychosozialen Faktoren. Es beleuchtet die Rolle von vererbten Anlagen, den Einfluss gesellschaftlicher Normen und kultureller Traditionen, sowie Faktoren wie Stress, Traumata und psychische Vorbelastungen. Es betont den multifaktoriellen Charakter der Alkoholabhängigkeit.
Welche Rolle spielt die soziale Arbeit?
Das Kapitel analysiert die Herausforderungen, die Alkoholabhängigkeit für die soziale Arbeit darstellt. Es untersucht die Auswirkungen von Alkoholmissbrauch auf Individuen und Familien und beleuchtet die Rolle der sozialen Arbeit in Prävention und Intervention. Es werden Strategien und Programme zur Bekämpfung von Alkoholabhängigkeit im Kontext der sozialen Arbeit behandelt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Alkoholabhängigkeit, Epidemiologie, Alkoholmissbrauch, Alkoholintoxikation, soziale Arbeit, Prävention, Intervention, genetische Faktoren, soziokulturelle Faktoren, psychosoziale Faktoren, gesellschaftliche Kosten und Gesundheitsrisiken.
- Quote paper
- Kai Noack (Author), 2009, Alkoholabhängigkeit - Krankheit oder gesellschaftliches Problem?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146152