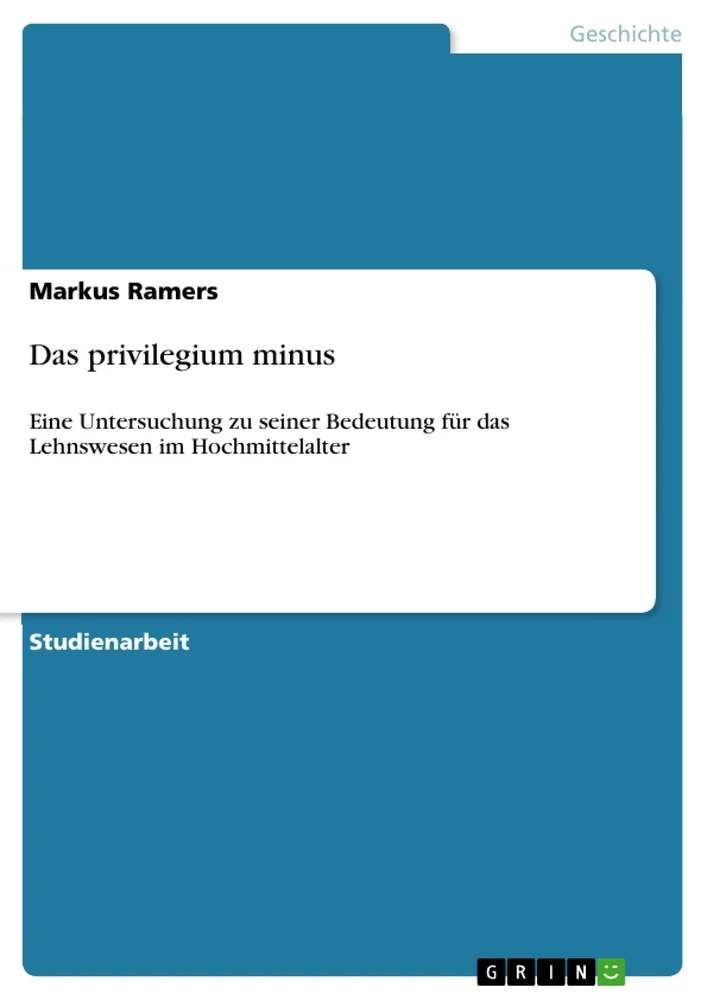Gegenstand meiner Hausarbeit ist „eine[r] der berühmtesten Urkunden des Hochmittelalters“ , zu welchen Heinrich Appelt das Privilegium minus im Vorwort seiner Studie über diese Urkunde rechnet.
Die mit dieser Urkunde Friedrichs I. Barbarossa aus dem Jahr 1156 verbundene Erhebung der Mark Österreich zum Herzogtum Österreich spielt eine wichtige Rolle in der österreichischen Landesgeschichte.
Die vorliegende Arbeit verfolgt jedoch die Absicht, dass Privilegium minus in den Kontext des Lehnsrechts einzuordnen und seine Bedeutung für die Lehnspraxis im 12. Jahrhundert herauszuarbeiten.
Die Erarbeitung erfolgt in zwei Schritten:
Im ersten Schritt stelle ich den staufisch-welfischen Konflikt, die politische Situation in der Mitte des 12. Jahrhundert und somit die Hintergründe des Privilegium minus dar. Im zweiten Teil folgt die eigentliche Auseinandersetzung mit der Urkunde: Zum einen muss die Bedeutung der zum Herzogtum erhobenen Markgrafschaft Österreich als Fahnenlehen erörtert werden, zum anderen werde ich mich kritisch mit der Frage auseinandersetzen, ob oder inwiefern die besonderen Bestimmungen des Privilegium minus den Rahmen des Lehnsrechts in der Stauferzeit sprengen.
Ziel ist es, den außergewöhnlichen Charakter der einzelnen Vorrechte Heinrich Jasomirgotts für das Lehnswesen klar herauszuarbeiten, aber dennoch den historischen Zusammenhang, das Streben Friedrichs I. Barbarossa auf einen Ausgleich in der Bayerischen Frage und seine damit verbundene Bereitschaft zu weitreichenden Zugeständnissen, mit einzubeziehen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DER STAUFISCH-WELFISCHE KONFLIKT ALS AUSGANGSPUNKT DES PRIVILEGIUM MINUS
- DAS PRIVILEGIUM MINUS IM KONTEXT DES LEHNRECHTS.
- DAS FÜRSTENTUM ALS FAHNENLEHEN.
- BESONDERE LEHNSRECHTLICHE BESTIMMUNGEN DER URKUNDE
- Heerfolge und Hoffahrt.
- Ausübung der Gerichtsbarkeit..
- Weibliche Erbfolge und die libertas affectandi.
- RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich dem Privilegium minus Friedrichs I. Barbarossa aus dem Jahr 1156, welches die Erhebung der Mark Österreich zum Herzogtum markierte. Ziel ist es, das Privilegium minus in den Kontext des Lehnsrechts des 12. Jahrhunderts einzuordnen und seine Bedeutung für die Lehnspraxis herauszuarbeiten.
- Die Rolle des Privilegium minus im staufisch-welfischen Konflikt.
- Die Bedeutung des Lehnsrechts für die politische Ordnung im Hochmittelalter.
- Die besonderen Bestimmungen des Privilegium minus im Vergleich zum allgemeinen Lehnsrecht.
- Die politische und rechtliche Bedeutung der Erhebung Österreichs zum Herzogtum.
- Die Hintergründe und Folgen der Entscheidungen Friedrichs I. Barbarossa.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Bedeutung des Privilegium minus im Kontext der österreichischen Landesgeschichte dar. Sie zeigt die Relevanz des Lehnsrechts für die politische Ordnung im Hochmittelalter auf und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf das Lehnswesen in der Forschung.
- Kapitel 2 beleuchtet den staufisch-welfischen Konflikt als Ausgangspunkt des Privilegium minus. Es beschreibt die Machtverhältnisse zwischen den Staufern und Welfen und die Konflikte, die zur Erhebung Österreichs zum Herzogtum führten.
- Kapitel 3 analysiert das Privilegium minus im Kontext des Lehnsrechts. Es untersucht die Bedeutung der Markgrafschaft Österreich als Fahnenlehen und analysiert die besonderen Bestimmungen des Privilegium minus im Vergleich zum allgemeinen Lehnsrecht.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themengebiete dieser Arbeit sind: Privilegium minus, staufisch-welfischer Konflikt, Lehnsrecht, Herzogtum Österreich, Fahnenlehen, Gerichtsbarkeit, weibliche Erbfolge, libertas affectandi, politische Ordnung, Hochmittelalter, Geschichte Österreichs.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Privilegium minus von 1156?
Es ist eine berühmte Urkunde Friedrich I. Barbarossas, die die Mark Österreich zum Herzogtum Österreich erhob.
Welche Rolle spielte der staufisch-welfische Konflikt für die Urkunde?
Die Urkunde war ein Kompromiss zur Beilegung der „Bayerischen Frage“ und sollte Heinrich Jasomirgott für den Verzicht auf das Herzogtum Bayern entschädigen.
Was bedeutet der Begriff „Fahnenlehen“ in diesem Zusammenhang?
Die Arbeit untersucht die rechtliche Einordnung des neuen Herzogtums als Fahnenlehen innerhalb des mittelalterlichen Lehnsrechts.
Welche besonderen Vorrechte erhielt Heinrich Jasomirgott?
Die Urkunde enthielt außergewöhnliche Bestimmungen zur weiblichen Erbfolge (libertas affectandi) sowie Erleichterungen bei Heerfolge und Hoffahrt.
Sprengt das Privilegium minus den Rahmen des üblichen Lehnsrechts?
Die Arbeit setzt sich kritisch damit auseinander, inwiefern die weitreichenden Zugeständnisse Barbarossas die damalige Lehnspraxis überschritten.
- Citar trabajo
- Markus Ramers (Autor), 2008, Das privilegium minus , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146229