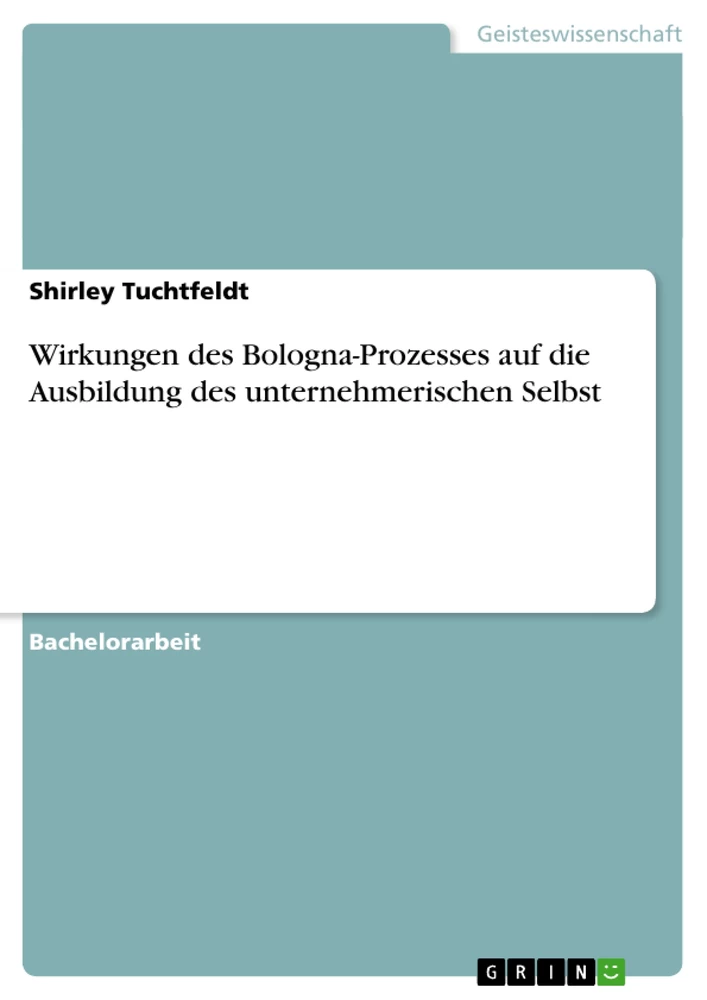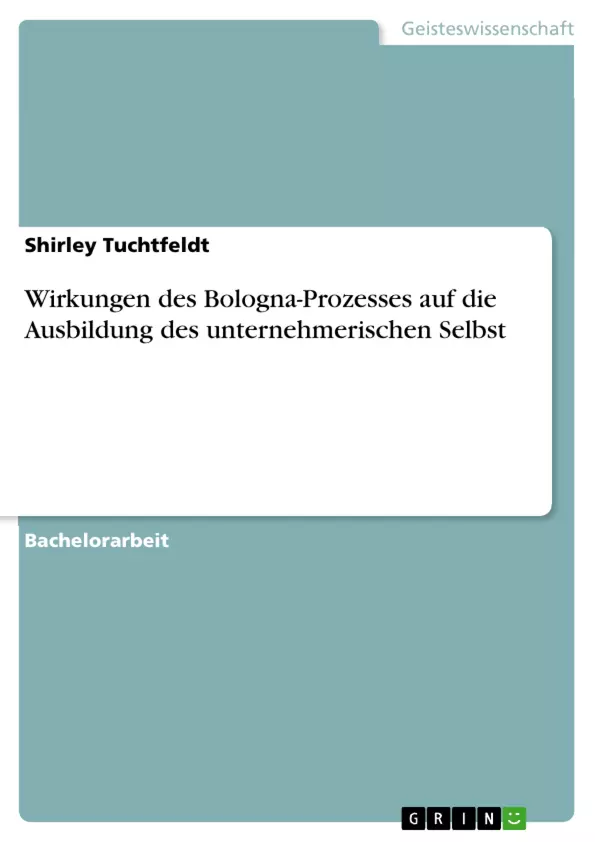Das gesellschaftliche Leitbild des ‚Unternehmers in jeder Lebenslage’ gewinnt als kategorischer Imperativ der Gegenwart immer mehr an Bedeutung. Dieses unternehmerische Selbst ist rational, eigenverantwortlich, flexibel, innovativ, kundenorientiert und durch fortwährend Selbstoptimierung geprägt. In der Figur des ‚Arbeitskraftunternehmers’ wird das unternehmerische Selbst als Idealtypus verkörpert: Dieser kontrolliert sich und seine Arbeitsleistung zunehmend selbst, er versteht sich als Unternehmer seiner eigenen Arbeitskraft, ‚produziert’ und ‚vermarktet’ seine Fähigkeiten und Leistungen, organisiert seine Arbeitsabläufe selbstständig und in zunehmend rationaler, ‚verbetrieblichter’ Weise und richtet sein gesamtes Leben nach rationalen, ‚selbstunternehmerischen’ Kriterien aus. Ohne die Entwicklung selbst moralisch bewerten zu wollen, lässt sich die Bedeutung dieser unternehmerischen Subjektivierungsform in Wirtschaft und Gesellschaft des 21. Jahrhunderts doch nicht leugnen.
Bislang galt es in Deutschland als ‚Common Sense’, dass das Studium eigenständiges Denken und Arbeiten fördert, Kreativität, Rationalität und Organisationsfähigkeit schult und damit zur Ausbildung von Eigenschaften und einer Identität im Sinne des unternehmerischen Selbst beiträgt. Im Zuge der Umsetzung des Bologna-Prozesses in Europa jedoch wird – mit dem Ziel höherer internationaler Vergleichbarkeit – das bisherige Studiensystem in Deutschland (mit den einzügigen Studienabschlüssen Diplom, Magister etc.) auf ein neues zweistufiges System mit dem Bachelor als Regelstudienabschluss und aufbauenden oder weiterbildenden Masterstudiengängen als zweite, stärker zulassungsbeschränkte Stufe umgestellt. Die neue Studienstruktur hat gegenüber den alten Studiengängen im Allgemeinen den Ruf, wesentlich stärker vorstrukturiert und damit straffer und ‚verschulter’ organisiert zu sein. Die Mitgestaltungsmöglichkeiten der Studierenden bezüglich der Organisation und der Inhalte ihres Studiums – also ihr persönlicher Handlungsspielraum – wird durch die Modularisierung der Studieninhalte stärker eingeschränkt, als es in den alten Studiengängen der Fall ist.
Was bedeutet die durch die Umstellung des Studiensystems eingetretene strukturelle Veränderung in der Ausbildung des akademischen Nachwuchses – der Ausbau externaler Kontrollmechanismen – für die Entwicklung sogenannter „unternehmerischer“ Eigenschaften? Dieser Frage wird in der hier vorliegenden empirischen Fallstudie nachgegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG UND AUFBAU DER ARBEIT
- 2. THEORETISCHER RAHMEN
- 2.1. Der Bologna-Prozess
- 2.1.1. Ziele des Bologna-Prozesses - Mobilität, Qualität, Transparenz
- 2.1.2. Umsetzung in Deutschland - Die Einführung des zweistufigen Studiensystems
- 2.2. Das unternehmerische Selbst
- 2.2.1. Der Imperativ der Gegenwart
- 2.2.2. Der Idealtypus des Arbeitskraftunternehmers
- 2.3. Die Ausbildung des unternehmerischen Selbst
- 2.4. Hypothesen
- 3. METHODISCHER RAHMEN
- 3.1. Grundgesamtheit und Stichprobe
- 3.1.1. Auswahl der Grundgesamtheit
- 3.1.2. Die Umstellung des Studiensystems in der Leipziger Soziologie
- 3.1.3. Klumpenstichprobenverfahren
- 3.2. Entwicklung des Fragebogens
- 3.2.1. Fragebogendesign
- 3.2.2. Form und Kategorienanzahl von Ratingskalen
- 3.2.3. Pretest
- 3.3. Operationalisierung der Variablen
- 3.3.1. Operationalisierung der unabhängigen Variable – Studiengang
- 3.3.2. Operationalisierung der abhängigen Variablen Studiensituation
- 3.3.3. Operationalisierung der abhängigen Variablen – Dimensionen des unternehmerischen Selbst
- 3.3.3.1. Die Dimension „Selbstkontrolle“
- 3.3.3.2. Die Dimension „Selbstökonomisierung“ und Eigeninitiative
- 3.3.3.3. Die Dimension „Selbstrationalisierung“
- 3.3.4. Operationalisierung der Drittvariablen
- 3.4. Datenanalyseverfahren
- 4. DATENANALYSE
- 4.1. Datengrundlage
- 4.2. Häufigkeitsverteilungen der unabhängigen Variable und Drittvariablen
- 4.3. Bedeutung und weitere Verwendung der Drittvariablen
- 4.4. Subjektive Beurteilung des persönlichen Handlungsspielraumes
- 4.5. Die Ausbildung des unternehmerischen Selbst
- 4.5.1. Ergebnisse der Dimension „Selbstkontrolle“
- 4.5.2. Ergebnisse der Dimension „Selbstökonomisierung und Eigeninitiative“
- 4.5.3. Ergebnisse der Dimension „Selbstrationalisierung“
- 5. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE, INTERPRETATION UND FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf die Entwicklung des unternehmerischen Selbst im Kontext des deutschen Hochschulsystems. Die Forschungsfrage lautet: Wie beeinflusst die Einführung des zweistufigen Studiensystems die Ausbildung des unternehmerischen Selbst? Die Arbeit analysiert, inwieweit die im Bologna-Prozess angestrebten Ziele – Mobilität, Qualität und Transparenz – Auswirkungen auf die Entwicklung von Eigenschaften wie Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisierung haben.
- Der Bologna-Prozess und seine Auswirkungen auf das deutsche Hochschulsystem
- Die Bedeutung des unternehmerischen Selbst im Kontext des Arbeitsmarktes
- Die Ausbildung des unternehmerischen Selbst im Kontext des Hochschulstudiums
- Die Relevanz von Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisierung für den Erfolg im Berufsleben
- Die Analyse der Auswirkungen des Studiensystems auf die Entwicklung des unternehmerischen Selbst
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung und Aufbau der Arbeit: Dieses Kapitel führt die Thematik der Arbeit ein, erläutert die Forschungsfrage und gibt einen Überblick über den Aufbau und die Struktur der Arbeit.
- Kapitel 2: Theoretischer Rahmen: In diesem Kapitel werden die wichtigsten theoretischen Grundlagen der Arbeit dargestellt. Hier wird der Bologna-Prozess im Detail beleuchtet, seine Ziele und die konkrete Umsetzung in Deutschland analysiert. Weiterhin wird das Konzept des unternehmerischen Selbst definiert und die Bedeutung dieses Konzepts im Kontext der heutigen Arbeitswelt erläutert.
- Kapitel 3: Methodischer Rahmen: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es wird die Grundgesamtheit und die Stichprobe der Studie definiert, die Konstruktion des Fragebogens erläutert und die Operationalisierung der Variablen dargestellt.
- Kapitel 4: Datenanalyse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung dargestellt und analysiert. Es werden die Häufigkeitsverteilungen der unabhängigen und der Drittvariablen gezeigt, die Bedeutung und weitere Verwendung der Drittvariablen analysiert und die Auswirkungen des Studiensystems auf die Ausbildung des unternehmerischen Selbst untersucht.
Schlüsselwörter
Bologna-Prozess, Hochschulsystem, Unternehmerisches Selbst, Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung, Selbstrationalisierung, Arbeitsmarkt, Studiensystem, Empirische Forschung, Fragebogen, Datenanalyse, Quantitativer Ansatz.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „unternehmerischen Selbst“?
Es beschreibt ein Subjektivierungsmodell, bei dem Individuen sich selbst als Unternehmer ihrer eigenen Arbeitskraft begreifen und Eigenschaften wie Eigenverantwortung, Flexibilität und Selbstoptimierung zeigen.
Wie wirkt sich der Bologna-Prozess auf die Studierenden aus?
Durch die Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse wurde das Studium stärker strukturiert und „verschult“, was den persönlichen Handlungsspielraum der Studierenden einschränken kann.
Welche Dimensionen des unternehmerischen Selbst werden untersucht?
Die Arbeit analysiert insbesondere die Dimensionen Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung (Eigeninitiative) und Selbstrationalisierung.
Was ist ein „Arbeitskraftunternehmer“?
Dies ist ein Idealtypus, der seine Fähigkeiten aktiv vermarktet, seine Arbeitsprozesse selbst rationalisiert und sein Leben nach ökonomischen Kriterien ausrichtet.
Fördert das neue Studiensystem die Ausbildung unternehmerischer Eigenschaften?
Die Fallstudie untersucht kritisch, ob die straffere Organisation des Bologna-Systems die Entwicklung von Eigenständigkeit eher behindert oder durch externe Kontrolle ersetzt.
- Quote paper
- Shirley Tuchtfeldt (Author), 2009, Wirkungen des Bologna-Prozesses auf die Ausbildung des unternehmerischen Selbst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146245