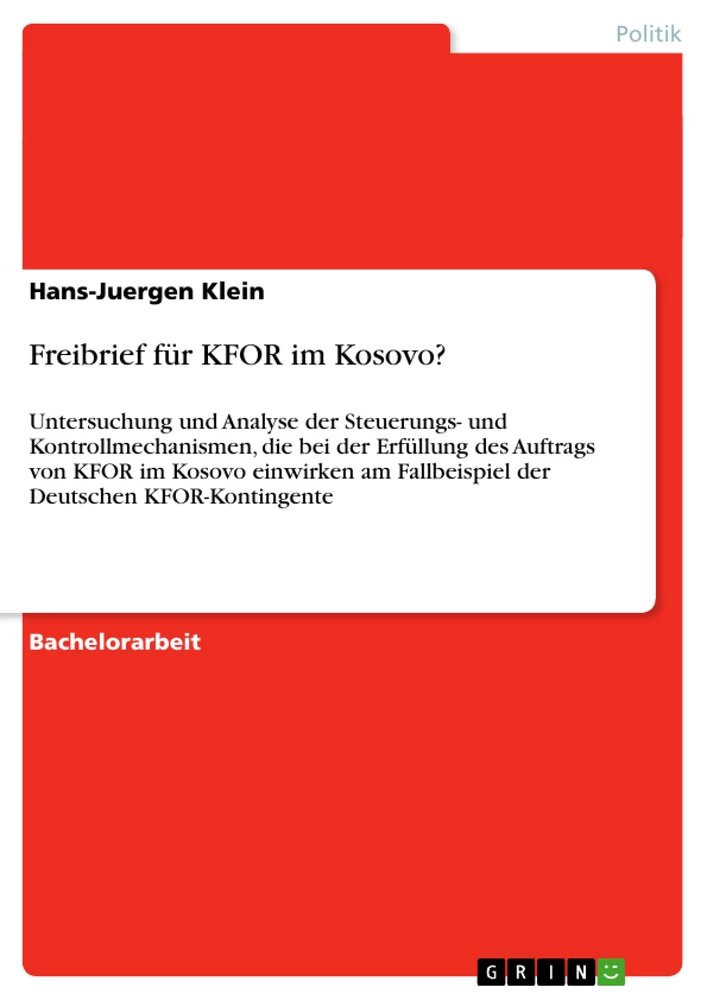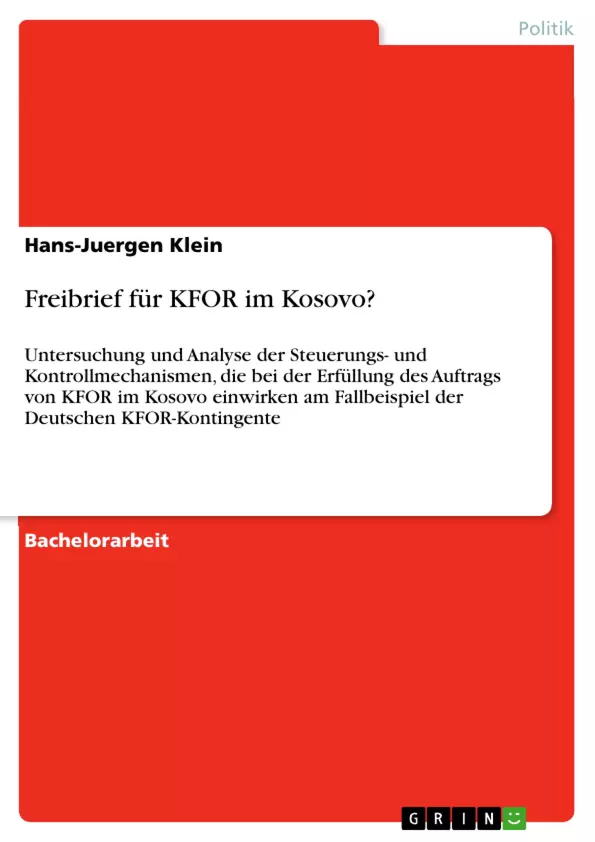Mithilfe der Prinzipal-Agent-Theroie wird die komplexe Auftragnehmer-Auftraggeber-Struktur analysiert. Dabei wird das agieren der Deutschen KFOR-Kontingente als Fallbeispiel zugrunde gelegt. Ziel dieser Arbeit war es zu beweisen, dass trotz einer "Verwässerung" des Auftrags der UNO, über die verschiedenen Stufen hinweg, die Akteure zwar "shirking" betreiben. Dieses "shirking" aber endogen in der in der Struktur des kollektiven Akteurs begründet liegt. Trotz dieses Mankos ist alle involvierten Akteure - in der Rolle des Auftragnehmers - bemüht den Auftrag im Sinne der Auftragnehmers zu erfüllen.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitende Gedanken
- A.1 Definition der Schlüsselbegriffe „Mandat“ und „Steuerungs- und Kontrollmechanismen“
- A.1.1 Definition des Schlüsselbegriffs „Mandat“
- A.1.2 Definition des Schlüsselbegriffs „Steuerungs- und Kontrollmechanismen“
- A.2 Hypothesenentwicklung
- A.3 Erläuterung der Vorgehensweise
- B Hauptteil
- B.1 Wissenschaftliche Überlegungen zum Thema
- B.1.1 Begründung des politikwissenschaftlichen Erkenntnisinteresses
- B.1.2 Stand der Forschung auf diesem Politikfeld
- B.1.3 Verortung der Fragestellung innerhalb der Politikwissenschaften
- B.1.4 Erarbeitung der theoretischen Rahmenbedingungen für die Analyse
- B.1.5 Grundüberlegungen zur Prinzipal-Agent-Theorie und Neuen Politischen Ökonomie
- B.2 Das Kosovo im Überblick
- B.2.1 Strukturdaten des Kosovos
- B.2.2 Kurzer Abriss der Ereignisse im Kosovo von 1999 bis 2009
- B.2.3 Verortung des Kosovokonflikts innerhalb der Kriegstypologien
- B.3 Gedanken über permanent existierende Steuerungs- und Kontrollmechanismen auf internationaler Ebene
- B.3.1 Das Humanitäre Völkerrecht, ein Steuerungs- und Kontrollmechanismus?
- B.3.2 Die Medien als Steuerungs- und Kontrollmechanismus
- B.3.3 Resümee der auf internationaler Ebene
- B.4 Präsentation der Hauptakteure in Rahmen dieser Untersuchung
- B.4.1 Die UNO und das Leitbild der UNO
- B.4.1.1 Beschlussfassung im UN-Sicherheitsrat
- B.4.1.2 Skizzierung der Rahmenbedingungen, unter denen die UN-Resolution 1244 gefällt worden ist
- B.4.1.3 Auflistung der für die NATO relevanten Inhalte der UN-Resolution 1244
- B.4.1.4 Alternativen zum Mandat
- B.4.1.5 Analyse des Auftraggebers UNO und der Vergabe des Auftrags in Form eines Mandats
- B.4.2 Die NATO
- B.4.2.1 Leitbild der NATO
- B.4.2.2 Beschlussfassungen im Nordatlantikrat
- B.4.2.3 Wie setzt die NATO das Mandat inhaltlich um?
- B.4.2.4 Doppelrolle der NATO aus Auftragnehmer und Auftraggeber
- B.4.2.5 Analyse der Steuerungs- und Kontrollmechanismen die auf den Akteur „NATO“ einwirken
- B.4.3 Die Bundesrepublik Deutschland
- B.4.3.1 Ziele der Bundesrepublik Deutschland im Kosovokonflikt
- B.4.3.2 Analyse der Akteurskonstellation „UNO – Bundesrepublik“ aus der Prinzipal-Agent-Perspektive
- B.4.3.3 Analyse der Inhalte des Antrags der Deutschen Bundesregierung Nr. 14/1133
- B.4.3.4 Analyse der Einstellung der Medien und Repräsentanten der öffentlichen Meinung zur KFOR-Mission
- B.4.3.5 Fazit der Analyse des Akteurs Bundesrepublik Deutschland
- B.4.4 Die Bundeswehr und das Leitbild der Bundeswehr
- B.4.4.1 Das Deutsche Einsatzkontingent
- B.4.4.2 Steuerungs- und Kontrollmechanismen der NATO
- B.4.4.3 Nationale Steuerungs- und Kontrollmechanismen
- B.4.4.4 Fazit der Analyse der Steuerungs- und Kontrollmechanismen für das Deutsche Einsatzkontingent
- B.5 Die Märzunruhen des Jahres 2004
- B.5.1 Ursache und Ablauf der Märzunruhen
- B.5.2 Beschreibung der Unruhen am 17./18.03.2004 in Prizren
- B.5.3 Analyse und Fazit der Ursachensuche bei den Steuerungs- und Kontrollmechanismen
- B.5.4 Verbesserung des Steuerungs- und Kontrollmechanismus durch Nachbesserungen
- B.6 Zusammenfassung
- B.6.1 Akteur UNO
- B.6.2 Akteur NATO
- B.6.3 Akteur Bundesrepublik Deutschland
- B.6.4 Akteur Deutsches Einsatzkontingent
- C Abschließende Gedanken
- Analyse der multilateralen Akteurskonstellation im Kosovo-Konflikt
- Untersuchung der Mandatsvergabe und -umsetzung durch die beteiligten Akteure
- Bewertung der Wirksamkeit der Steuerungs- und Kontrollmechanismen
- Analyse der Rolle des humanitären Völkerrechts und der Medien
- Fallbeispiel der Märzunruhen 2004
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Steuerungs- und Kontrollmechanismen im KFOR-Einsatz im Kosovo, insbesondere die Interaktion zwischen der UNO, der NATO, der Bundesrepublik Deutschland und dem deutschen Einsatzkontingent. Ziel ist es, die Effizienz und Effektivität dieser Mechanismen zu analysieren und mögliche Schwachstellen aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
A Einleitende Gedanken: Dieses Kapitel legt den theoretischen Rahmen der Arbeit fest. Es definiert die Schlüsselbegriffe „Mandat“ und „Steuerungs- und Kontrollmechanismen“ und entwickelt Hypothesen zur Untersuchung der Akteursbeziehungen im KFOR-Einsatz. Es wird auf die historische Bedeutung von Vertragsgestaltung und Misstrauen zwischen Akteuren eingegangen und der Fokus auf die Analyse der multilateralen Akteurskonstellation im KFOR-Einsatz gelegt.
B Hauptteil: Der Hauptteil der Arbeit gliedert sich in verschiedene Unterkapitel, die sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen, dem Kosovokonflikt, den internationalen Kontrollmechanismen und den einzelnen Akteuren (UNO, NATO, Bundesrepublik Deutschland, Bundeswehr) befassen. Es wird eine umfassende Analyse der jeweiligen Rollen, Ziele und Handlungsspielräume der Akteure im Kontext des KFOR-Mandats vorgenommen und die Wirksamkeit der Kontrollmechanismen kritisch beleuchtet. Der Abschnitt zu den Märzunruhen 2004 dient als Fallstudie, um die Funktionsweise und die Grenzen der etablierten Mechanismen zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
KFOR, Kosovo, UNO, NATO, Bundesrepublik Deutschland, Bundeswehr, Mandat, Steuerungs- und Kontrollmechanismen, Prinzipal-Agent-Theorie, Humanitäres Völkerrecht, Märzunruhen 2004, internationale Politik, Multilateralismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Steuerungs- und Kontrollmechanismen im KFOR-Einsatz im Kosovo"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Steuerungs- und Kontrollmechanismen im KFOR-Einsatz im Kosovo. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen der UNO, der NATO, der Bundesrepublik Deutschland und dem deutschen Einsatzkontingent. Ziel ist die Bewertung der Effizienz und Effektivität dieser Mechanismen und die Aufdeckung möglicher Schwachstellen.
Welche Akteure werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf vier Hauptakteure: die Vereinten Nationen (UNO), die NATO, die Bundesrepublik Deutschland und die Bundeswehr (das deutsche Einsatzkontingent). Die Arbeit untersucht deren jeweilige Rollen, Ziele und Handlungsspielräume im Kontext des KFOR-Mandats.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Analyse der multilateralen Akteurskonstellation im Kosovo-Konflikt, die Untersuchung der Mandatsvergabe und -umsetzung, die Bewertung der Wirksamkeit der Steuerungs- und Kontrollmechanismen, die Rolle des humanitären Völkerrechts und der Medien, sowie eine Fallstudie zu den Märzunruhen 2004.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Einleitende Gedanken (Definition der Schlüsselbegriffe, Hypothesenentwicklung), Hauptteil (wissenschaftliche Grundlagen, Kosovokonflikt, internationale Kontrollmechanismen, Analyse der einzelnen Akteure, Fallstudie zu den Märzunruhen 2004) und Abschließende Gedanken. Der Hauptteil ist detailliert untergliedert (siehe Inhaltsverzeichnis).
Welche Schlüsselbegriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert die Schlüsselbegriffe "Mandat" und "Steuerungs- und Kontrollmechanismen". Die Definitionen bilden die Grundlage für die anschließende Analyse.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die Prinzipal-Agent-Theorie und die Neue Politische Ökonomie als theoretische Rahmenbedingungen für die Analyse der Akteursbeziehungen.
Welche Rolle spielen das humanitäre Völkerrecht und die Medien?
Die Arbeit untersucht die Rolle des humanitären Völkerrechts und der Medien als Steuerungs- und Kontrollmechanismen auf internationaler Ebene.
Was ist die Bedeutung der Märzunruhen 2004?
Die Märzunruhen 2004 dienen als Fallbeispiel, um die Funktionsweise und Grenzen der etablierten Steuerungs- und Kontrollmechanismen zu veranschaulichen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit analysiert die Effizienz und Effektivität der Steuerungs- und Kontrollmechanismen und zeigt mögliche Schwachstellen auf. Konkrete Schlussfolgerungen zu den einzelnen Akteuren und dem Gesamtsystem werden im abschließenden Kapitel gezogen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: KFOR, Kosovo, UNO, NATO, Bundesrepublik Deutschland, Bundeswehr, Mandat, Steuerungs- und Kontrollmechanismen, Prinzipal-Agent-Theorie, Humanitäres Völkerrecht, Märzunruhen 2004, internationale Politik, Multilateralismus.
- Arbeit zitieren
- Hans-Juergen Klein (Autor:in), 2009, Freibrief für KFOR im Kosovo?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146287