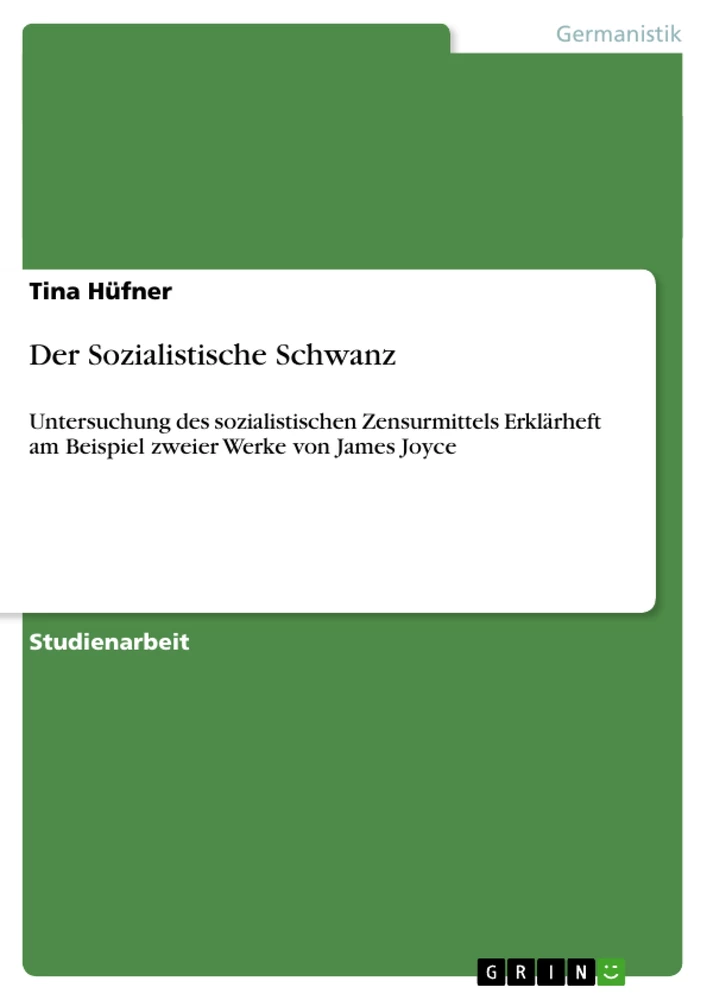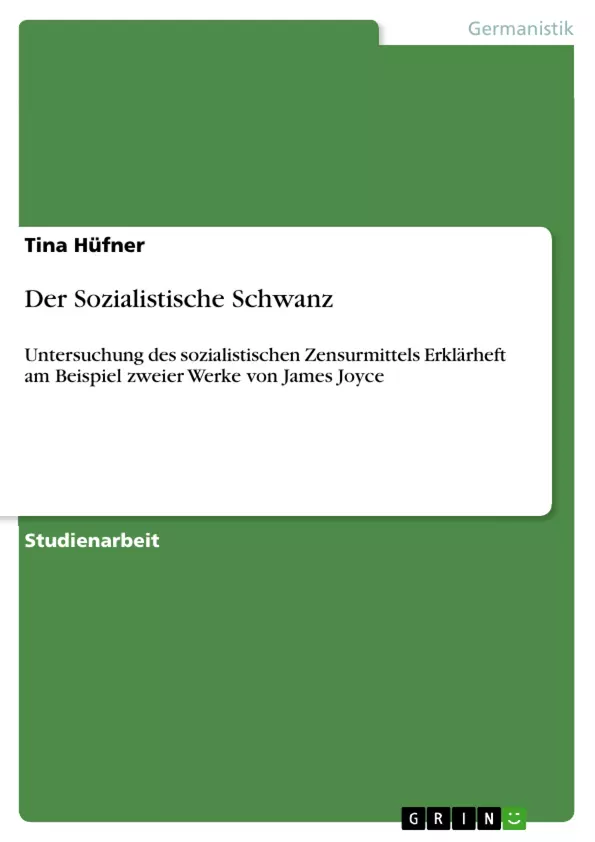I. Einleitung
Ein totalitärer Staat zeichnet sich dadurch aus, dass er versucht, Einfluss auf alle Bereiche des Lebens seiner Bürger zu nehmen, gerade wenn es um die Bildung und die Gedankenwelt geht.
Die Deutsche Demokratische Republik war in diesem Punkt keine Ausnahme, auch wenn sie sich als sozialistischer Staat und Volksdemokratie verstand, in der das Volk regiert. Und wie lässt sich die Bildungs- und Gedankenwelt eines Staates besser kontrollieren, als über seine Literatur?
In den 45 Jahren des Bestehens der DDR war ein ganzer Apparat an Politikern, Literaturwissenschaftlern und Funktionären fast ausschließlich damit beschäftigt zu entscheiden, welche Literatur mit den Dogmen und Thesen des Sozialismus und des Marxismus/Leninismus überhaupt zu vereinbaren sind und eine Daseinsberechtigung in der Deutschen Demokratischen Republik haben, deren Devisen und Materialressourcen so begrenzt waren, dass selbst erwünschte Bücher nur selten in ausreichender Stückzahl vorhanden waren, um den Markt zu decken.
Aber kein Staat der Welt kann ohne eine höhere Bildungsschicht existieren und genau diese Bildungsschicht war es, die nach einem breiteren Spektrum an Literatur verlangte, gerade wenn es sich um Werke von bedeutenden Autoren wie Franz Kafka, die Literaten der Familie Mann oder Theodor Fontane handelte. Also musste eine Lösung gefunden werden, um wenigstens einen Teil der westdeutschen und ausländischen Literatur veröffentlichen zu können, ohne dass die Aussagen dieser Werke als nicht konform mit der sozialistischen Ideologie gewertet werden können.
Es gab verschiedene Wege, eine scheinbare Konformität zu erreichen und genau dies soll Inhalt dieser Hausarbeit sein. Ein besonderer thematischer Schwerpunkt wird dabei auf die so genannten „Erklärhefte“ gelegt, deren Struktur und Zielsetzung hier an zwei Beispielen, die als Beilage zu Werken von James Joyce erschienen waren, untersucht wird.
Diesem Schwerpunkt voran gestellt, ist ein kurzer Exkurs über die Legitimations- und Veröffentlichungsprobleme mehrerer Werke der österreichischen und westdeutschen Literatur, die schlussendlich zu der Erfindung der „Erklärhefte“ führten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 2.1. Ein allgemeiner Exkurs über die Entstehung und Geschichte der Erklärhefte
- 2.2. Eine kurze Biografie von James Joyce
- 2.3. Wolfgang Wicht - Beilage zu „Stephen der Held“ von James Joyce
- 2.4. Joachim Krehayn – Beilage zu „Ein Portrait des Künstlers als junger Mann“
- III. Das Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Strategien der DDR-Verlage zur Veröffentlichung von westlicher und ausländischer Literatur, die nicht der sozialistischen Ideologie entsprach. Ein besonderer Fokus liegt auf den „Erklärheften“, die als Begleittexte zu problematischen Werken dienten, um deren Publikation zu ermöglichen. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der Zensur und die verschiedenen Methoden, die angewendet wurden, um literarische Werke mit dem politischen System zu vereinbaren.
- Herausforderungen bei der Veröffentlichung westlicher Literatur in der DDR
- Die Entstehung und Funktion der „Erklärhefte“
- Analyse der „Erklärhefte“ zu Werken von James Joyce
- Alternative Strategien zur Anpassung von Texten an die politische Ideologie
- Der Einfluss von politischen und ökonomischen Faktoren auf die Literaturpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Versuch des totalitären DDR-Staates, die Bildungs- und Gedankenwelt seiner Bürger zu kontrollieren, insbesondere durch die Zensur von Literatur. Sie führt in die Problematik der Veröffentlichung westlicher und ausländischer Werke ein und kündigt den Fokus auf „Erklärhefte“ an, die als Begleittexte zur Umdeutung nicht-konformer Inhalte dienten. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit und hebt die Bedeutung der „Erklärhefte“ als Untersuchungsgegenstand hervor. Die Problematik der begrenzten Ressourcen und der Notwendigkeit, zumindest Teile der westlichen Literatur zugänglich zu machen, wird ebenfalls angesprochen.
II. Hauptteil: Der Hauptteil der Arbeit analysiert detailliert die Entstehung und den Gebrauch von „Erklärheften“ in der DDR. Er beleuchtet, wie linientreue Literaturwissenschaftler Kommentare zu Werken schrieben, um nicht-konforme Inhalte umzudeuten und deren Veröffentlichung zu ermöglichen. Es werden die Schwierigkeiten und die langwierigen Prozesse der Zensur und der Abstimmung mit den Lizenzgebern herausgearbeitet, die oft zu Verzögerungen oder der kompletten Verhinderung von Veröffentlichungen führten. Der Hauptteil schildert den Übergang von integrierten Kommentaren zu separaten Broschüren als Erklärhefte, die urheberrechtlich eigenständig waren und somit die Zustimmung des Lizenzgebers nicht mehr benötigten. Die Arbeit veranschaulicht diese Praxis anhand von Beispielen österreichischer Autoren wie Karl Kraus und Elias Canetti, sowie der Herausforderungen bei der Publikation von Werken von Robert Musil, James Joyce und Marcel Proust. Sie beschreibt diverse Strategien, um die Publikation von Werken zu ermöglichen, von der Anpassung von Inhalten bis zum Weglassen von antikommunistischen Textstellen. Auch der Ansatz, weniger bekannte Werke in Anthologien zu veröffentlichen, wird thematisiert, um den späteren Weg für die Veröffentlichung von Hauptwerken zu ebnen. Der Teil schließt mit der Beobachtung, dass die Kenntnis über die Praxis der „Erklärhefte“ in der Bevölkerung der ehemaligen DDR gering war.
2.1. Ein allgemeiner Exkurs über die Entstehung und Geschichte der Erklärhefte: Dieser Abschnitt befasst sich eingehend mit der Entstehung und Entwicklung der „Erklärhefte“ als Instrument der literarischen Zensur in der DDR. Er beschreibt, wie diese Kommentare die ideologischen Konflikte zwischen den Werken und der politischen Linie des Staates zu entschärfen versuchten. Es wird detailliert auf die Herausforderungen bei der Zusammenarbeit mit westlichen Verlagen und Autoren eingegangen, die durch die Notwendigkeit der Abstimmung und die lange Bearbeitungszeit für die Kommentare geprägt waren. Die ökonomischen Aspekte, insbesondere die Devisensituation der DDR und der Umgang mit Lizenzgebühren, werden als zentrale Einflussfaktoren hervorgehoben. Der Abschnitt zeigt, wie die „Erklärhefte“ ein pragmatisches, wenn auch manipulatives Mittel zur Erweiterung des literarischen Angebots in der DDR waren.
2.2. Eine kurze Biografie von James Joyce: Dieser Abschnitt bietet einen kurzen biographischen Überblick über James Joyce, der zwar in der ursprünglichen Gliederung aufgeführt ist, aber im vorliegenden Textfragment nicht weiter ausgeführt wird. Eine Zusammenfassung ist somit nicht möglich, da keine Informationen zu James Joyce im Text vorhanden sind.
Schlüsselwörter
DDR, Literaturzensur, Erklärhefte, Westliteratur, James Joyce, ideologische Konformität, Veröffentlichungspraxis, Lizenzverträge, Devisen, Zensurmethoden, politische Einflussnahme, sozialistische Ideologie, Marxismus/Leninismus, österreichische Literatur.
FAQ: Analyse der Veröffentlichungspraxis westlicher Literatur in der DDR
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Strategien der DDR-Verlage bei der Veröffentlichung westlicher und ausländischer Literatur, die nicht der sozialistischen Ideologie entsprach. Ein besonderer Fokus liegt auf den „Erklärheften“, die als Begleittexte zu problematischen Werken dienten, um deren Publikation zu ermöglichen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der Zensur, die verschiedenen Methoden zur Vereinbarkeit literarischer Werke mit dem politischen System, die Entstehung und Funktion der „Erklärhefte“, die Analyse dieser Hefte zu Werken von James Joyce (obwohl im vorliegenden Auszug nicht detailliert behandelt), alternative Anpassungsstrategien von Texten, und den Einfluss politischer und ökonomischer Faktoren auf die Literaturpolitik.
Was sind „Erklärhefte“?
„Erklärhefte“ waren Begleittexte zu westlichen oder ausländischen Werken, die nicht der sozialistischen Ideologie entsprachen. Sie dienten dazu, problematische Inhalte umzudeuten und die Veröffentlichung dennoch zu ermöglichen. Sie entwickelten sich von integrierten Kommentaren zu separaten Broschüren, um die Zustimmung von Lizenzgebern zu umgehen.
Welche Herausforderungen gab es bei der Veröffentlichung westlicher Literatur in der DDR?
Die Veröffentlichung westlicher Literatur in der DDR war mit großen Herausforderungen verbunden. Dazu gehörten die Zensur, die Abstimmung mit Lizenzgebern, die langen Bearbeitungszeiten, die ökonomischen Aspekte (Devisen, Lizenzgebühren) und die ideologischen Konflikte zwischen den Werken und der politischen Linie des Staates.
Wie wurden die „Erklärhefte“ eingesetzt?
Die „Erklärhefte“ wurden eingesetzt, um die ideologischen Konflikte zwischen den Werken und der politischen Linie des Staates zu entschärfen. Die darin enthaltenen Kommentare versuchten, nicht-konforme Inhalte umzudeuten und so deren Veröffentlichung zu ermöglichen. Der Ansatz reichte von der Anpassung von Inhalten bis zum Weglassen antikommunistischer Textstellen. Auch die Veröffentlichung weniger bekannter Werke in Anthologien, um später den Weg für Hauptwerke zu ebnen, wurde praktiziert.
Welche Rolle spielte James Joyce in dieser Arbeit?
Die Arbeit erwähnt James Joyce als Beispiel für einen Autor, dessen Werke in der DDR unter Zensur standen und gegebenenfalls mit „Erklärheften“ begleitet wurden. Jedoch findet sich im vorliegenden Auszug keine detaillierte Analyse seiner Werke oder der dazugehörigen „Erklärhefte“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil (mit Unterkapiteln zu einem allgemeinen Exkurs über die Entstehung der „Erklärhefte“, einer kurzen Biografie von James Joyce und Analysen zu „Erklärheften“ zu Werken von James Joyce und anderen Autoren), und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: DDR, Literaturzensur, Erklärhefte, Westliteratur, James Joyce, ideologische Konformität, Veröffentlichungspraxis, Lizenzverträge, Devisen, Zensurmethoden, politische Einflussnahme, sozialistische Ideologie, Marxismus/Leninismus, österreichische Literatur.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kürze)?
Das Fazit wird im vorliegenden Auszug nicht explizit dargestellt. Es kann jedoch angenommen werden, dass es die Ergebnisse der Analyse der Veröffentlichungspraxis westlicher Literatur in der DDR unter Berücksichtigung der „Erklärhefte“ zusammenfasst und möglicherweise auch die Bedeutung und den langfristigen Einfluss dieser Praxis beleuchtet.
- Quote paper
- Tina Hüfner (Author), 2008, Der Sozialistische Schwanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146291