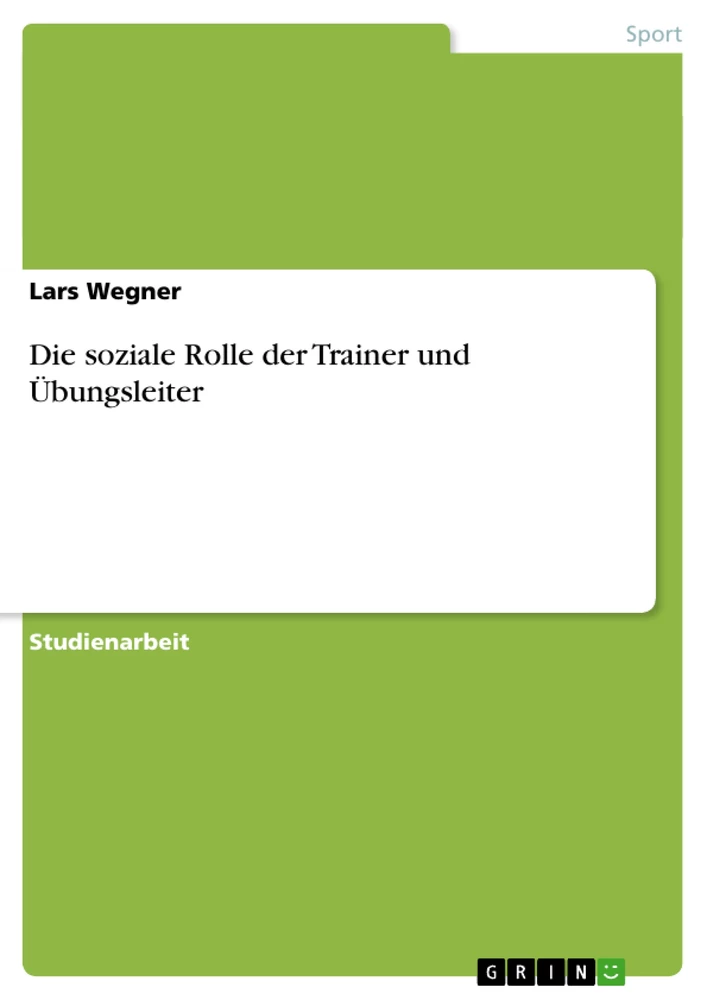Kommt mir die notwendige Aufmerksamkeit zu? Spreche ich mit meiner Art ein Training zu leiten die Bedürfnisse der mir ‚unterstellten’ Sportler an? Fordere ich sie ausreichend bzw. bis an das Maß des Erträglichen oder überfordern meine oder die durch andere gesteckten Ziele ihr Leistungsvermögen? Fragen die den meisten Trainern und Übungsleitern bekannt vorkommen dürften. Im Sport spielen soziale Prozesse in vielfältiger Weise eine bedeutende Rolle. Dies lässt sich sowohl über die sozialen Kognitionen begründen, wie auch aus der Tatsache herleiten, dass Sport und Bewegung vornehmlich in einem Gruppenkontext stattfinden. ‚Sportliches Handeln’ ist (fast) immer auch soziales Handeln. Und dieses soziale Handeln bzw. der Umgang mit anderen Menschen erfordert zum Einen eine Unmenge an Erfahrungen aus dem eigenen evtl. sportlichen Werdegang; zum Anderen auch instinktive, angeborene Fähigkeiten sowie erlernte Fertigkeiten, um pädagogisch wirksam interagieren und eine auf gegenseitigem Nutzen basierende dauerhafte Verbindung zwischen Trainer und Sportler etablieren zu können. Der Leiter einer Sportmannschaft hat zumeist Dutzende verschiedener Charaktere zu betreuen, die nicht nur in ein (meist vorgegebenes) Sportkonzept bzw. –modell eingefügt werden wollen, sondern zur vollständigen Synthese mit diesem und dem zum Erreichen bestimmter Ziele notwendigen Umfeld reifen sollen. Hierbei ist es seine Aufgabe durch eine ständige Sublimierung der Trainingsinhalte ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, mit all den feinen Abstufungen, zu sichern. Dabei trägt die Person des Trainers nicht nur die Verantwortung für die sportliche sondern gerade im Hochleistungssport auch für die soziale, menschlich-charakterliche und berufliche Entwicklung seiner Zöglinge. Welche Methode in der Interaktion am ehesten ‚Früchte’ trägt, lässt sich, wie immer im Umgang mit Menschen, nur sehr schwer pauschalisieren und scheint doch am Ende ein schier unmögliches Vorhaben. Es haben sich im Laufe der Zeit bestimmte Arten der Menschenführung entwickelt, die letztlich auch immer von der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung geprägt und abhängig waren, weil sie das Menschenbild ihrer Zeit widerspiegelten.
Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- Soziale Rollen im Sport
- Die spezifische Rollenproblematik des Trainers
- Trainer versus Übungsleiter – Charakteristik der Rolle des Übungsleiters
- Soziale Interaktion und Kommunikation
- Führung
- Kompetenzbereich
- Entscheidungsspielraum
- Führungsstile
- Autoritärer Führungsstil
- Kooperativ-partnerschaftlicher Führungsstil
- 'Laissez-faire' Führungsstil
- Situative Führung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sozialen Rolle von Trainern und Übungsleitern im Sport. Sie analysiert die spezifischen Herausforderungen, die diese Rolle mit sich bringt, und beleuchtet verschiedene Führungsansätze im Kontext des Sporttrainings. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Bedeutung sozialer Prozesse und Interaktionen im Sport zu entwickeln und die vielfältigen Aspekte der Trainer- und Übungsleiterrolle aufzuzeigen.
- Die spezifische Rollenproblematik des Trainers im Sport
- Der Unterschied zwischen Trainer und Übungsleiter und die Charakteristik der Rolle des Übungsleiters
- Die Bedeutung sozialer Interaktion und Kommunikation im Sporttraining
- Verschiedene Führungsansätze im Sport und ihre Auswirkungen auf das Training
- Die Entwicklung von Führungsqualitäten im Kontext des Sporttrainings
Zusammenfassung der Kapitel
Prolog
Der Prolog stellt die grundlegende Fragestellung der Arbeit in den Vordergrund: Wie können Trainer und Übungsleiter die Bedürfnisse der Sportler optimal erfüllen und gleichzeitig effektive Trainingsmethoden anwenden? Es wird die Bedeutung sozialer Prozesse im Sport hervorgehoben, insbesondere die Notwendigkeit für Trainer, sowohl sportliche als auch menschliche Entwicklung ihrer Schützlinge zu fördern.
Soziale Rollen im Sport
Dieses Kapitel definiert den Begriff "Soziale Rolle" und erläutert die Bedeutung von Rollenerwartungen im gesellschaftlichen Kontext. Es wird gezeigt, dass die Rolle des Trainers durch ein Bündel von Normen und Erwartungen definiert wird, die sowohl aus dem sportlichen als auch aus dem sozialen Umfeld stammen.
Führung
Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Führungsstilen im Sport. Es analysiert die Vor- und Nachteile von autoritärem, kooperativ-partnerschaftlichem, 'Laissez-faire'- und situativem Führungsstil und zeigt, wie diese Stile die Trainingsatmosphäre und die Leistungsentwicklung der Sportler beeinflussen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Schlüsselbegriffen: Soziale Rolle, Trainer, Übungsleiter, Sport, Führung, Führungsstil, Interaktion, Kommunikation, Motivation, Leistung, soziale Prozesse, menschliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Trainer und einem Übungsleiter?
Während der Trainer oft im Hochleistungssport auf Leistungssteigerung fokussiert ist, übernimmt der Übungsleiter im Breitensport breitere pädagogische und soziale Aufgaben.
Welche sozialen Rollen nimmt ein Trainer ein?
Ein Trainer ist nicht nur technischer Vermittler, sondern auch Erzieher, Psychologe, Vorbild und oft eine zentrale Bezugsperson für die menschliche Entwicklung seiner Sportler.
Welche Führungsstile gibt es im Sport?
Man unterscheidet zwischen autoritärem, kooperativ-partnerschaftlichem, Laissez-faire- und situativem Führungsstil, je nach Situation und Zielgruppe.
Warum ist soziale Interaktion im Training so wichtig?
Sportliches Handeln ist fast immer soziales Handeln. Eine gute Kommunikation zwischen Trainer und Sportler ist die Basis für Vertrauen, Motivation und langfristigen Erfolg.
Was bedeutet „Situative Führung“ im Sport?
Es bedeutet, dass der Trainer seinen Führungsstil flexibel an den Reifegrad der Sportler und die jeweilige Situation (Wettkampf vs. Training) anpasst.
- Arbeit zitieren
- Lars Wegner (Autor:in), 2003, Die soziale Rolle der Trainer und Übungsleiter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14635