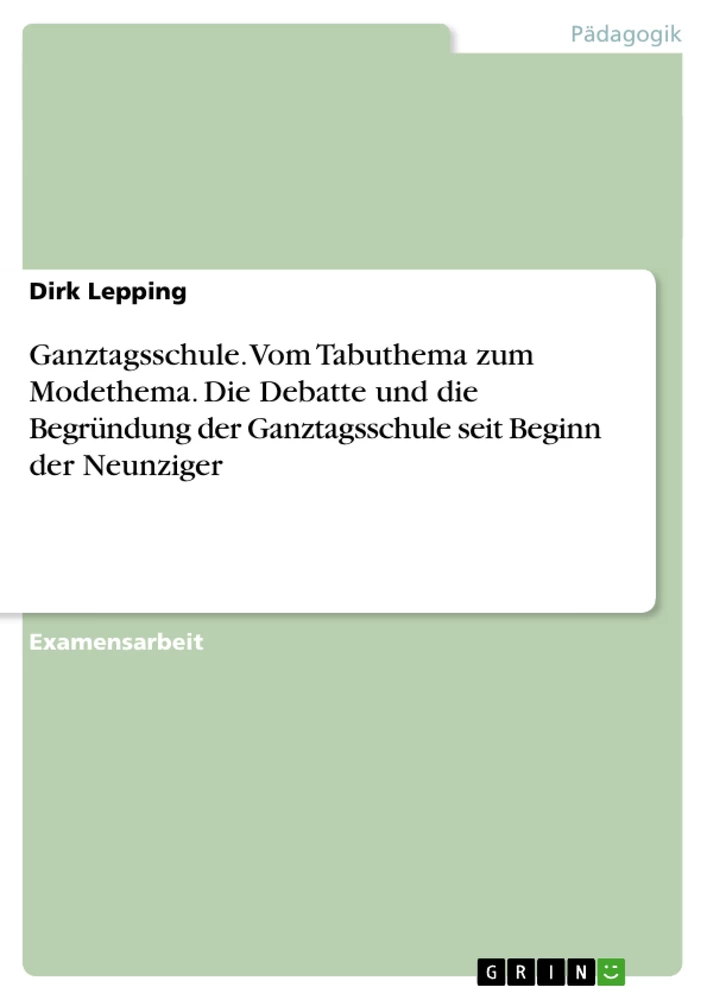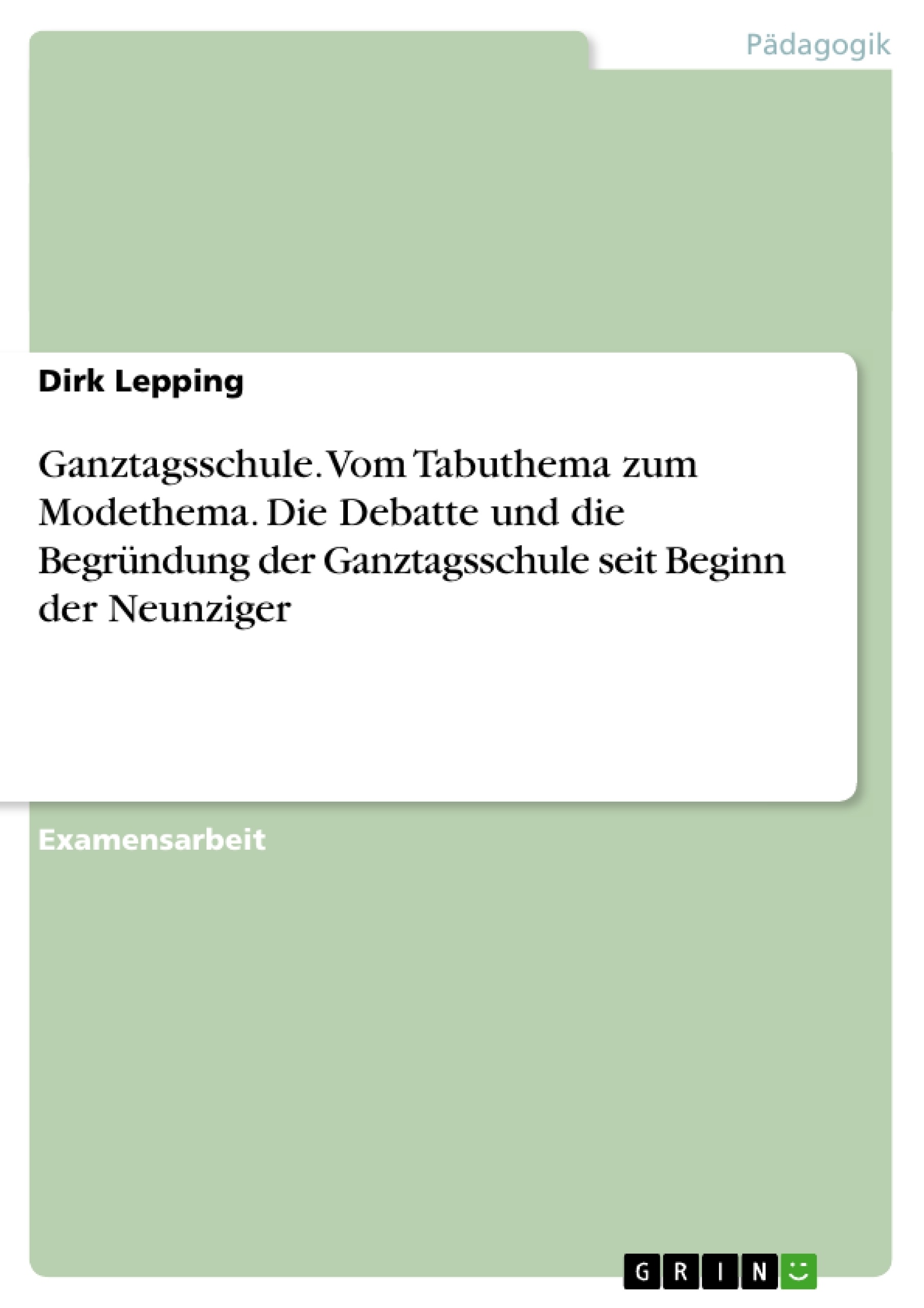Im Jahre 1964 sorgte Georg Picht mit seiner Artikelserie über die „Deutsche Bildungskatastrophe“ für Alarmstimmung und brachte die Bildungspolitik ganz oben auf die politische Agenda. Fast vier Jahrzehnte später stand der nächste Schrecken ins Haus. Die PISA-Studie 2000 hatte Deutschland eindeutig vor Augen geführt, dass das deutsche Bildungssystem in der Krise steckt. Deutschland, das wie kaum ein Land in der Welt auf sein Humanvermögen angewiesen ist, hinkte im weltweiten Vergleich schulischer Leistung hinter den Besten her. Es war deutlich geworden, dass der Wandel der außerschulischen Erziehungsbedingungen und die zukünftigen Bildungs- und Qualifikationsanforderungen in hohem Maße veränderte Herausforderungen an schulische Bildungs- und Erziehungsprozesse stellte. Gleichzeitig jedoch schien die heutige Halbtagsschule mit ihrer gegenwärtigen institutionellen Struktur diesen neuen Herausforderungen nicht mehr gewachsen zu sein. Aus diesem Grund haben momentan pädagogische Konzepte ganztägiger institutioneller Schulbetreuung Konjunktur. Besonders auf bildungs- und sozialpolitischer Ebene sowie in der pädagogisch-wissenschaftlichen Diskussion scheinen ganztägige Schulkonzepte zum neuen Modethema geworden zu sein. Fast alle Bundesländern haben in den letzten Jahren Überlegungen und Konzepte für Schulen mit erweiterten Öffnungszeiten und Betreuungsangeboten am Nachmittag vorgelegt. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung fordert die Ganztagsschule als Innovation im Bildungssystem, doch die Vielfalt der möglichen Ganztagskonzepte erschwert schnelle Entscheidungen.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich daher nach einer historischen Einleitung in die Debatte um die Ganztagsschule einen Einblick in den aktuellen Stand der Ganztagsschule in Deutschland geben. Neben Definitionsversuchen und der Darstellung von statistischen Zahlen soll der Fokus der Arbeit auf der Analyse unterschiedlicher Begründungen für den Ausbau von Ganztagsschulen liegen. Es sollen sowohl bildungspolitische und pädagogische als auch gesellschafts-, sozial-, familien-, frauen- und wirtschaftspolitische Positionen dargestellt werden, die begründen, warum das Thema Ganztagsschule von einem Tabuthema zum neuen Modethema geworden ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entwicklung der Ganztagsschule in Deutschland
- 2.1 Entwicklung vor dem Zweiten Weltkrieg
- 2.1.1 Die deutschen Landerziehungs-Heime nach Hermann Lietz
- 2.2 Entwicklung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
- 2.3 Entwicklung seit der Deutschen Wiedervereinigung
- 2.4 Die gegenwärtige Ganztagsschul- Debatte in Folge des „,PISA-Schocks“
- 3. Zur Definition des Begriffs Ganztagsschule
- 3.1 Die Definition des UNESCO-Instituts (1961)
- 3.2 Die Definition der Gemeinnützigen Gesellschaft Tagesheimschule (1972)
- 3.3 Die Definition des „Hamburger Gutachtens“ (1990)
- 3.4 Die Definition des Ganztagsschulverbands (1990)
- 3.5 Die Ganztagsschule in der gegenwärtigen öffentlichen Debatte
- 3.6 Zentrale Bausteine des Ganztagsschulkonzepts
- 4. Aktuelle Situation der Ganztagsschulentwicklung in Zahlen und Diagrammen
- 5. Die gegenwärtige Diskussion um die Ganztagsschule
- 5.1 Gründe für die Forderung nach Ganztagsschulen auf Grund veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen
- 5.1.1 Familie im Prozess gesellschaftlichen Wandels
- 5.1.2 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- 5.1.3 Schwindende Erziehungsbereitschaft der Eltern
- 5.1.4 Veränderte Kindheit
- 5.2 Mögliche Konsequenzen und Probleme bei der Realisierung eines verlässlichen Ganztagsschulangebots
- 5.2.1 Verwaltungstechnische Konsequenzen aus schulorganisatorischer Sicht
- 5.2.2 Probleme und Konsequenzen aus schulpolitischer Sicht
- 5.2.3 Probleme und Konsequenzen aus Sicht der Lehrkräfte
- 5.2.4 Probleme und Konsequenzen aus Sicht der sozialpädagogischen Fachkräfte
- 5.2.4.1 Mögliche Konfliktfelder bei der Zusammenarbeit von Sozialpädagogen und Lehrkräften
- 5.2.5 Probleme und Konsequenzen aus Sicht der Schülerschaft
- 5.2.6 Probleme und Konsequenzen aus Sicht der Elternschaft
- 5.2.7 Probleme und Konsequenzen aus ernährungswissenschaftlicher Sicht
- 5.2.8 Probleme und Konsequenzen aus gesundheitlicher Sicht
- 5.3 Die Ganztagsschule aus Sicht der pädagogischen Verbände und Gewerkschaften
- 5.3.1 Ganztagsschulverband
- 5.3.2 Bundeselternrat (BER)
- 5.3.3 Landeselternbeirat (LEB)
- 5.3.4 Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV)
- 5.3.5 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
- 5.3.6 Verband für Bildung und Erziehung (VBE)
- 5.3.7 „Forum Bildung“
- 5.3.8 Deutscher Lehrerverband (DL)
- 5.3.9 Deutscher Philologenverband (DPhV)
- 5.3.10 Wohlfahrtsverbände
- 5.4 Gesellschafts- und sozialpolitische Aspekte der Ganztagsschule
- 5.4.1 Die Erfordernis von Ganztagsschule aus gesellschaftspolitischer Sicht
- 5.4.2 Bildungspolitische Positionen der politischen Parteien
- 5.4.3 Wirtschaftspolitische Aspekte der Ganztagsschule
- 5.4.4 Positionen und Konsequenzen aus Sicht der Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften
- 5.4.4.1 Position der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
- 5.4.4.2 Position des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB)
- 5.4.4.3 Position der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
- 5.4.4.4 Position des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH)
- 5.4.4.5 Position des Deutschen AkademikerInnenbundes (DAB)
- 5.4.5 Position des Deutschen Städtetags
- 5.4.6 Positionen der Evangelischen und Katholischen Kirche
- 6. Quo vadis Ganztagsschule?
- Entwicklung der Ganztagsschule in Deutschland
- Definition des Begriffs Ganztagsschule
- Aktuelle Situation und Diskussion um die Ganztagsschule
- Herausforderungen und Chancen der Ganztagsschule
- Gesellschafts- und sozialpolitische Aspekte der Ganztagsschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und der gegenwärtigen Diskussion um die Ganztagsschule in Deutschland. Sie analysiert die historischen Wurzeln des Konzepts sowie die Gründe für die zunehmende Bedeutung der Ganztagsschule in der heutigen Gesellschaft. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Ganztagsschule aus unterschiedlichen Perspektiven, darunter die Sicht der Eltern, Lehrer, Schüler und verschiedenen gesellschaftlichen Akteure. Die Analyse beinhaltet auch die Bewertung der Ganztagsschule aus pädagogischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt eine Einführung in die Thematik und stellt die Relevanz der Ganztagsschule in der heutigen Gesellschaft dar. Im zweiten Kapitel wird die Entwicklung der Ganztagsschule in Deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart dargestellt. Es werden die unterschiedlichen Phasen der Entwicklung und die wichtigsten Einflussfaktoren beleuchtet. Kapitel drei befasst sich mit der Definition des Begriffs Ganztagsschule und analysiert verschiedene Definitionen aus unterschiedlichen Perspektiven. Kapitel vier präsentiert die aktuelle Situation der Ganztagsschulentwicklung in Deutschland anhand von Statistiken und Diagrammen.
Das fünfte Kapitel widmet sich der gegenwärtigen Diskussion um die Ganztagsschule. Es werden die Gründe für die Forderung nach Ganztagsschulen, die möglichen Konsequenzen und Probleme sowie die Positionen verschiedener Akteure und Institutionen beleuchtet. Kapitel sechs befasst sich mit der Frage, welche Zukunft die Ganztagsschule in Deutschland hat und welche Herausforderungen und Chancen es in Zukunft zu bewältigen gilt.
Schlüsselwörter
Ganztagsschule, Bildungslandschaft, Gesellschaftlicher Wandel, Schulpolitik, Familienstruktur, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Pädagogische Konzepte, Sozialpädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte, Schülerschaft, Elternschaft, Wirtschaftspolitische Aspekte, Gesellschaftspolitische Aspekte, Gewerkschaften, Verbände, Zukunft der Schule.
Häufig gestellte Fragen
Was löste die Debatte um die Ganztagsschule in Deutschland aus?
Der sogenannte "PISA-Schock" im Jahr 2000 verdeutlichte die Krise des deutschen Bildungssystems und machte Ganztagsangebote zur politischen Priorität.
Warum wird die Ganztagsschule heute als Notwendigkeit gesehen?
Gründe sind der gesellschaftliche Wandel, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die veränderten Erziehungsbedingungen in modernen Familien.
Welche Probleme gibt es bei der Realisierung von Ganztagsschulen?
Herausforderungen liegen in der Schulorganisation, der Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Sozialpädagogen sowie in finanziellen Aspekten.
Wie definieren Fachverbände die Ganztagsschule?
Definitionen variieren von reiner Nachmittagsbetreuung bis hin zu rhythmisierten Konzepten, die Unterricht und Freizeit über den Tag verteilen.
Welche Rolle spielen wirtschaftspolitische Aspekte?
Wirtschaftsverbände fordern Ganztagsschulen, um das Humanvermögen besser zu nutzen und Eltern die volle Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
- Arbeit zitieren
- Dirk Lepping (Autor:in), 2003, Ganztagsschule. Vom Tabuthema zum Modethema. Die Debatte und die Begründung der Ganztagsschule seit Beginn der Neunziger, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14645