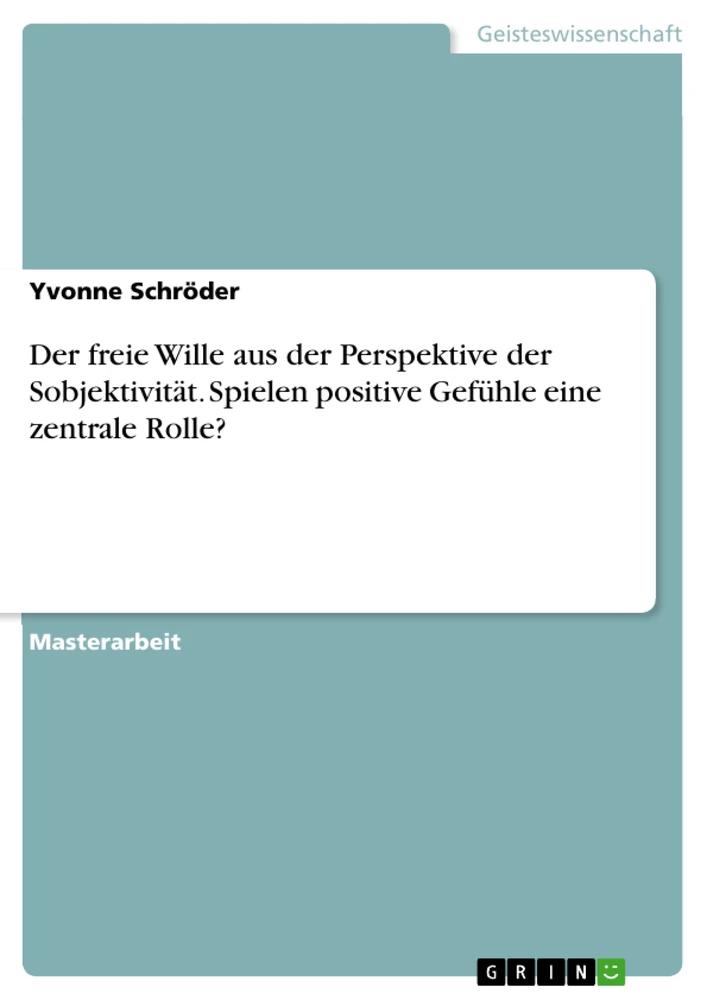Über die letzten Jahrzehnte musste festgestellt werden, dass die Frage, ob ein freier Wille existiert, nicht trivial zu beantworten ist. Daraufhin konzentrierte sich die Sozialpsychologie auf einen alternativen Ansatz: Es wird nicht unmittelbar die Existenz des freien Willens erforscht, sondern der Glaube an die Existenz einer Willensfreiheit und die damit verbundenen Auswirkungen im Verhalten der Menschen. Mit diesem Ansatz konnten bereits einige Zusammenhänge analysiert werden. Beispielsweise wird der Eindruck erweckt, dass positive Emotionen mit dem Glauben an den freien Willen zusammenhängen könnten, da der aktuelle Wissensstand zeigt, dass Gefühle wie Dankbarkeit oder Zufriedenheit positiv mit dem Glauben an die Willensfreiheit korrelieren. Die Theorie des Monismus erklärt die Verbindung zwischen dem Geist und dem Körper mit einer dritten Realitätsform: der Sobjektivität.
In der sogenannten Geist-Materie-Forschung wurden in der Vergangenheit einige Effekte deutlich, die durch das Modell der pragmatischen Information (MPI) beschrieben werden. An diesen Theorien orientieren sich zwei Hypothesen, die die Wahrscheinlichkeit prüfen, ob der Glaube an den freien Willen mit einem erhöhten positiven Affekt einhergeht. Als Methode wird das Messinstrument PANAS zur Erfassung des positiven Affektes und eine Manipulation des Glaubens durch eine LFW- und HFW-Bedingung herangezogen. Es wurden zwei bayes'sche einseitige T-Tests für unabhängige Stichproben als Forschungsdesign gewählt. Die Stichprobe erfasste eine Anzahl von 1901 gültigen Fällen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Methode der Manipulation des Glaubens an den freien Willen als erfolgreich erweist. Ein Zusammenhang mit positiven Gefühlen im Allgemeinen konnte nicht bestätigt werden. Der Fokus sollte in zukünftigen Studien auf einzelne positive Affekte, wie der Emotion Freude, begrenzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrundwissen zum freien Willen
- Theoretischer Hintergrund
- Determinismus und Indeterminismus
- Modelle zum freien Willen
- Sozialpsychologische Sicht
- Forschungsstand
- Studien der Hirnforschung
- Studien der Sozialpsychologie
- Sobjektivität
- Modell der pragmatischen Information
- Theoretischer Hintergrund
- Empirische Studie: Sobjektivität und der freie Wille
- Forschungslücken, Fragestellung und Hypothesen
- Untersuchungsmethode
- Stichprobe und Design
- Erhebungsinstrumente und Treatment
- Datenerhebung
- Datenaufbereitung
- Datenauswertung
- Ergebnisse
- Deskriptive Analyse
- Bayes´sche Statistik
- Explorative Analyse
- Diskussion
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob ein Zusammenhang zwischen dem Glauben an den freien Willen und positiven Gefühlen besteht. Die Forschungsarbeit untersucht die Auswirkungen des Glaubens auf das individuelle Verhalten und die damit verbundenen Effekte im Rahmen der Sobjektivität.
- Der Einfluss des Glaubens an den freien Willen auf das menschliche Verhalten
- Die Rolle von positiven Emotionen im Zusammenhang mit dem Glauben an den freien Willen
- Das Konzept der Sobjektivität und ihre Bedeutung für die Erforschung des freien Willens
- Die Anwendung des Modells der pragmatischen Information (MPI) in der empirischen Forschung
- Die Überprüfung der Hypothese, ob ein induzierter Glaube an den freien Willen den positiven Affekt beeinflusst
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel der Arbeit bietet einen Überblick über den theoretischen Hintergrund zum freien Willen. Es werden verschiedene Modelle, wie Determinismus, Indeterminismus, Kompatibilismus und Inkompatibilismus, vorgestellt und diskutiert. Außerdem wird der aktuelle Forschungsstand im Bereich der Hirnforschung und Sozialpsychologie beleuchtet. Das Kapitel behandelt außerdem das Konzept der Sobjektivität und das Modell der pragmatischen Information (MPI), die als Grundlage für die empirische Studie dienen.
Das dritte Kapitel widmet sich der empirischen Studie zum freien Willen. Es werden die Forschungslücken und die Forschungsfrage definiert, die zu zwei Hypothesen führen. Die Methodik der Studie wird detailliert dargestellt, einschließlich der Stichprobe, des Designs, der Erhebungsinstrumente, des Treatments, der Datenerhebung und der Datenauswertung. Die Ergebnisse der Studie werden mit Hilfe deskriptiver Statistik, bayes’schen T-Tests und einer explorativen Analyse präsentiert.
Das vierte Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Studie. Die Hypothesen werden auf Basis der empirischen Daten überprüft und interpretiert. Die Studie liefert einen neuen Blickwinkel auf die Thematik des freien Willens und eröffnet weitere Forschungsmöglichkeiten. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Manipulation des Glaubens an den freien Willen einen signifikanten Einfluss auf die Selbstbewertung hat, aber keinen Einfluss auf den positiven Affekt im Allgemeinen. Die Diskussion umfasst auch die Einschränkungen der Studie und die daraus abgeleiteten Verbesserungsvorschläge für zukünftige Forschungsarbeiten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie freien Willen, Sobjektivität, positiver Affekt, Modell der pragmatischen Information (MPI), PANAS, Glaubensmanipulation, Determinismus, Indeterminismus, Kompatibilismus, Inkompatibilismus, Hirnforschung, Sozialpsychologie, Psychokinese, Quantenmechanik, Empirische Forschung, Bayes’sche Statistik, Deskriptive Statistik, Explorative Analyse.
- Arbeit zitieren
- Yvonne Schröder (Autor:in), 2023, Der freie Wille aus der Perspektive der Sobjektivität. Spielen positive Gefühle eine zentrale Rolle?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1466118