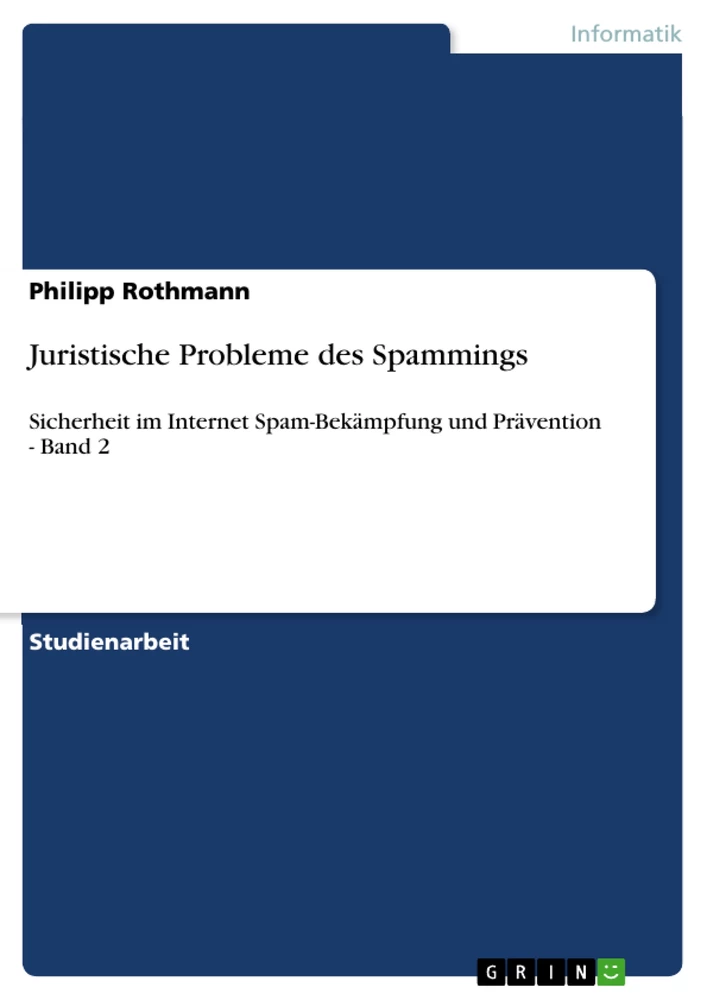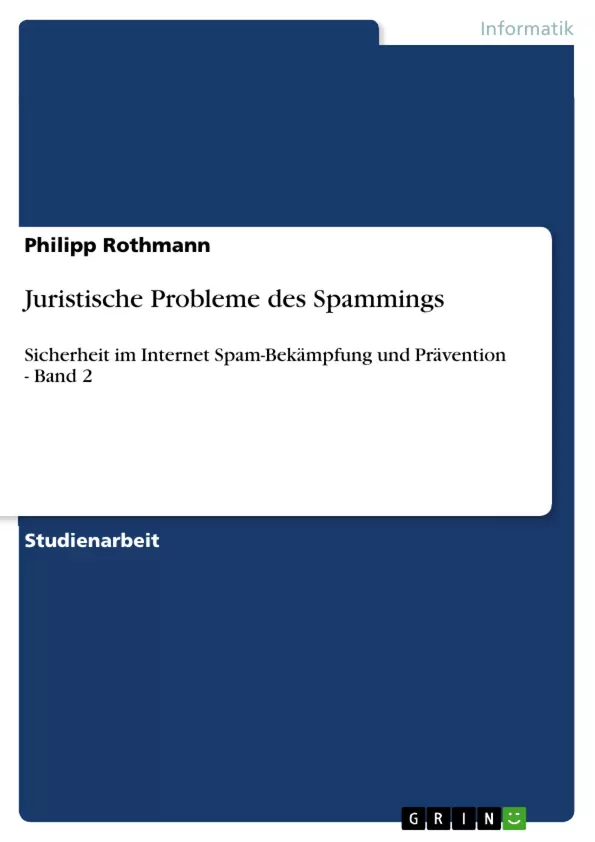Der vorliegende Band soll einen Überblick über die juristischen Rahmenbedingungen des weltweiten
Mailsystems in Bezug auf den Empfang und den Versand unerwünschter E-Mails geben. Dabei
werden die Rechtslagen in Europa (EU), speziell in Deutschland, den USA und Australien fokussiert.
Diese Arbeit soll die rechtlichen Unsicherheiten bei Betreibern von Mailsystemen vorstellen und
Wege aufzeigen, wie Provider und Unternehmen juristisch einwandfrei Maildienste anbieten können.
Hierzu gehört auch die Betrachtung von zulässigen Filtermaßnahmen gegen E-Mails, die Malware
enthalten und Spam. Weiterhin sollen die Möglichkeiten für Unternehmen und Privatpersonen zur
juristischen Klärung bzw. zum Vorgehen gegen unerwünschte Werbe-E-Mails sowie die
strafrechtlichen Sanktionen für Spam-Versender (sogenannte „Spammer“) beleuchtet werden. Diese
Arbeit stellt keinen Leitfaden für die juristische Absicherung von Marketing-Kampagnen, wie den
geplanten - rechtlich einwandfreien - Newsletter-Versand, dar.
Im nächsten Punkt wird die Bedeutung des Begriffs „unerwünschte E-Mail“ bzw. Spam für diese
Ausarbeitung beschrieben und die juristische Bedeutung hervorgehoben. Danach folgt die juristische
Betrachtung der Rechtslage für Nutzer (Spam-Versender und Spam-Empfänger) und Betreiber der
Mailsysteme in den o.g. Ländern und Staaten. Da mit juristischen Mitteln die Flut von weltweit
versendeten unerwünschten E-Mails nicht mit nationaler und EU-weiter Gesetzgebung eingedämmt
werden kann, ist der Einsatz von technischen Filtermaßnahmen unumgänglich; die
rechtskonforme Filterung von unerwünschten E-Mails wird im Anschluss betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Überblick
2. Spam
2.1. Abgrenzung und Begriffsdefinition
2.2. Juristische Definition von Spam
3. Juristische Aspekte von Spam
3.1. Rechtslage
3.1.1. Anti-Spam-Recht in Deutschland
3.1.1.1. Abgrenzung von Straf-, Zivil-und Wettbewerbsrecht
3.1.1.2. Zivilrecht in Deutschland
3.1.1.3. Wettbewerbsrecht in Deutschland
3.1.1.4. Strafrecht in Deutschland
3.1.1.5. Weitere relevante Rechtsgebiete in Deutschland
3.1.2. Anti-Spam-Recht in Europa
3.1.3. Anti-Spam-Recht in den USA
3.1.4. Anti-Spam-Recht in Australien
3.2. Filtermaßnahmen gegen Spam
3.2.1. Rechtskonforme Filterung von Spam und Malware in Deutschland
3.2.2. Rechtskonforme Filterung von Spam und Malware in Europa
3.2.3. Rechtskonforme Filterung von Spam und Malware in den USA
3.2.4. Rechtskonforme Filterung von Spam und Malware in Australien
4. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick
Literaturverzeichnis
1. Einleitung und Überblick
Der vorliegende Band soll einen Überblick über die juristischen Rahmenbedingungen des weltweiten Mailsystems in Bezug auf den Empfang und den Versand unerwünschter E-Mails geben. Dabei werden die Rechtslagen in Europa (EU), speziell in Deutschland, den USA und Australien fokussiert. Diese Arbeit soll die rechtlichen Unsicherheiten bei Betreibern von Mailsystemen vorstellen und Wege aufzeigen, wie Provider und Unternehmen juristisch einwandfrei Maildienste anbieten können. Hierzu gehört auch die Betrachtung von zulässigen Filtermaßnahmen gegen E-Mails, die Malware enthalten und Spam. Weiterhin sollen die Möglichkeiten für Unternehmen und Privatpersonen zur juristischen Klärung bzw. zum Vorgehen gegen unerwünschte Werbe-E-Mails sowie die strafrechtlichen Sanktionen für Spam-Versender (sogenannte „Spammer“) beleuchtet werden. Diese Arbeit stellt keinen Leitfaden für die juristische Absicherung von Marketing-Kampagnen, wie den geplanten - rechtlich einwandfreien - Newsletter-Versand, dar.
Im nächsten Punkt wird die Bedeutung des Begriffs „unerwünschte E-Mail“ bzw. Spam für diese Ausarbeitung beschrieben und die juristische Bedeutung hervorgehoben. Danach folgt die juristische Betrachtung der Rechtslage für Nutzer (Spam-Versender und Spam-Empfänger) und Betreiber der Mailsysteme in den o.g. Ländern und Staaten. Da mit juristischen Mitteln die Flut von weltweit versendeten unerwünschten E-Mails nicht mit nationaler und EU-weiter Gesetzgebung eingedämmt werden kann, ist der Einsatz von technischen Filtermaßnahmen unumgänglich (vgl. [SIE07]); die rechtskonforme Filterung von unerwünschten E-Mails wird im Anschluss betrachtet.
Der vorliegende Band wurde im Mai 2008 als Seminararbeit bei Prof. Tobias Eggendorfer an der Fernuniversität in Hagen eingereicht. Die Rechtsprechung und Literatur konnte bis April 2008 berücksichtigt werden.
2. Spam
2.1. Abgrenzung und Begriffsdefinition
In dieser Arbeit wird der Begriff Spam (Spam-E-Mail oder Junk-E-Mail) für unerwünscht zugesandte E-Mails verwendet. Dabei wird den E-Mails ein kommerzieller Hintergrund unterstellt, was den größten Anteil von Spam-E-Mails ausmacht (vgl. [ECO06]). Insbesondere unerbetene Werbe-E-Mails für Produkte, Dienstleistungen, Parteien etc. sind also im Sinne dieser Arbeit als Spam zu verstehen. Insbesondere solche Werbe-E-Mails, die gegen den Willen des Empfängers und außerhalb von bestehenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zugestellt werden (vgl. [KAR07]).
Diese Art von E-Mail-Spam wird auch mit dem Akronym UCE (Unsolicited Commercial electronical Message, übersetzbar mit „unverlangter kommerzieller E-Mail”) abgekürzt.
Neben UCE stehen die Begriffe UBE (Unsolicited Bulk E-Mail, übersetzbar mit „unverlangte und massenhaft versendete E-Mails“) und Malware (übersetzbar mit „Schadprogrammen“) im Zusammenhand. UCE kann dabei auch eine UBE sein. Das Abgrenzungskriterium ist hier der werbende Charakter der unverlangten E-Mail (vgl. [WIK07] und Band 1: „E-Mails-Spamfilterung“).
Spam an sich wird nicht als juristische Definition oder Begriff verwendet; weder die EU, Australien noch die USA verwenden den Begriff an sich. Die hier beleuchtete Art von Spam, nämlich UCE in Form einer kommerziellen E-Mail, ist juristisch nur eine Ausprägung von Spam. Generell werden in der EU technisch neutral beispielhaft E-Mails, Voice-Over-IP (VIOP), Faxnachrichten und SMS- Nachrichten (Short Message Service) als UCE klassifiziert. In Australien gehören explizit MMS (Multimedia Message Service) und Instant-Messaging dazu, jedoch sind Faxnachrichten und Werbung per Telefon juristisch ausgenommen (vgl. [ITU05]). Die genannten Ausprägungen von Spam werden in den Bänden 19: „Spam über Internet-Telefonie (SPIT)“, 20: „Spam über Instant Messaging (SPIM)“ und 21: „Spam über SMS“ dargestellt.
Die Funktionsweise von Spam wird in dem Band 1: „E-Mail-Spamfilterung“ ausführlich behandelt. Weiterhin sei auf [TOP04] verwiesen.
2.2. Juristische Definition von Spam
Das quantitative Kriterium von UBE, also der massenhafte Versand von E-Mails, ist insofern für die Einzelperson nicht von Bedeutung, als dass diese nur die eigene E-Mail im Posteingang wahrnimmt. Möglicherweise enthält der E-Mail-Postfacheingang eine Vielzahl von verschiedenen UBE's. Das typische Merkmal aus Empfänger-Sicht ist also „unerwünschte E-Mail“. Dabei handelt es sich allerdings um ein subjektives, der Informatik nicht zugängliches Kriterium, welches sich durch die Schwierigkeit manifestiert, Spam-E-Mails anhand Ihres Inhalts zu klassifizieren. E-Mails, die für manche Empfänger unerwünscht sind, können für andere - subjektiv betrachtet - durchaus nützlich und willkommen sein (vgl. Diskussion zwischen Widerspruchs- und Einwilligungslösung und unterschiedliche Gesetzgebung). Die juristische Definition ist von daher auf unverlangte Werbe-E- Mails (UCE) ausgerichtet (vgl. [TUW07]):
Unverlangt ist eine E-Mail dann, wenn das Einverständnis des Empfängers zumEmpfang der Nachricht nicht vorliegt und nicht zu erwarten ist[TOP04] .
Ein Versender von UCE möchte die Empfänger zu einem Kauf seiner angebotenen Produkte oder Dienstleistungen animieren. UCE wird von Spammern im Namen von Unternehmen oder Webseiten- Betreibern versendet; dabei sind die Anreizsysteme für die Spammer häufig Provisionszahlungen bei Neukundengewinnung (ergänzend dazu siehe Band 3: „Ökonomie des Spammings“). Zu den typischen Produkten in UCE zählen z. B. Webseiten mit pornografischen Inhalten, potenzsteigernde Mittel, Diätpräparate oder ähnliche Produkte. Der kommerzielle Hintergrund ist bei Parteienwerbung, bei der Vermittlung weltanschaulicher, politischer oder religiöser Ideen zwar nicht gegeben, diese Art von Spam zählt aber weitestgehend auch zu UCE (vgl. [TOP04] und [WIK08a]). Rechtlich gibt es allerdings international Unterschiede bei der Definition und der juristischen Zulässigkeit (vgl. dazu die Gesetzeslage in Australien 3.1.4 und in Deutschland 3.1.1.2).
Eine brauchbare Legaldefinition für Spam leitet sich aus dem deutschen Wettbewerbsrecht ab: elektronische Werbung ist gem. § 7 Abs. 1 Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) - z. B. per E- Mail - ohne vorherige Einwilligung Spam, weil sie andere Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt. Insbesondere ist lt. § 7 Abs. 2, Nr. 1 UWG von einer unzumutbaren Belästigung auszugehen, wenn nach § 7 Abs. 2, Nr. 3 UWG erkennbar ist, dass der Empfänger die Werbung nicht wünscht, die Einwilligung des Empfängers für elektronische Post nicht vorliegt oder gem. § 7, Abs. 2, Nr. 4 UWG die Identität des Absenders, in dessen Auftrag die Nachricht versendet wurde, nicht klar hervorgeht oder falsch ist. Auf die Ausnahmen wird in Punkt 3.1.1.3 weiter eingegangen.
Zur Abgrenzung von UCE zu Links und Anhängen von E-Mail-Diensten, die eine rein private E-Mail- Nachricht um kommerzielle Inhalte ergänzen, gibt es einzelne US-Bundesstaatengesetze, die für die kostenlose Überlassung eines E-Mail-Postfachs angehängte Werbung vom Begriff der kommerziellen E-Mail ausnehmen. In Deutschland sind derartige E-Mails, die nicht rein auf die Tätigkeit des zur Übermittlung genutzten Anbieters verweisen, prinzipiell als belästigend anzusehen (vgl. [BAH03], [MAD07]).
Auf die speziellen Regelungen im internationalen Umfeld wird im nächsten Kapitel eingegangen. Zur Abgrenzung und Definition von Werbung im juristischen Sinne sei an dieser Stelle auf [MAD07] verwiesen.
3. Juristische Aspekte von Spam
Die Betrachtung der juristischen Aspekte von UCE steht in diesem Punkt im Vordergrund und soll einen Überblick über die Rechtslage und Rechtsfolgen in Deutschland, in Europa, den USA und Australien geben. Neben der Rechtslage wird im Anschluss der juristisch einwandfreie Einsatz von Filtermaßnahmen und -Techniken diskutiert, um sich vor Spam zu schützen.
Auf die Problematik des „Zurück-Hackens“ wird im juristischen Sinne in dem Band 15: „Angreifen der Angreifer“ ausführlich eingegangen.
3.1. Rechtslage
Unerwünschte E-Mails mit kommerziellem Hintergrund sind in Deutschland und der EU zwar verboten, jedoch ist die Behandlung (wie weiter unten beschrieben) international uneinheitlich (vgl. [TOP04]). Die Grundlagen für Rechtsfolgen in Form von Sanktionen sind dementsprechend unterschiedlich. Im betrachteten Untersuchungsgegenstand sind rechtliche Grundlagen eingeführt und etabliert, die dabei auf den unterschiedlichen Prinzipien: Einverständnislösungen („Opt-In“) und Widerspruchslösungen („Opt-Out“) beruhen (vgl. [KAR07]).
Das in Deutschland und in weiteren EU-Staaten sowie in Australien (vgl. [ITU05]) durchgesetzte „Opt-In“-Prinzip regelt die rechtliche Zulässigkeit bei versendeten Werbe-E-Mails über die vorherige ausdrückliche oder konkludente Einwilligung des Empfängers. [TOP04] grenzt Spam weiterhin von solchen E-Mails ab, bei denen bereits ein geschäftlicher Kontakt (vgl. 3.1.1.3) zu dem Versender besteht.
Für Versender von UCE (Spammer) bedeuten diese Prinzipien, dass bei einer Rechtsprechung mit Anwendung des „Opt-In“-Prinzips der Nachweis erbracht werden muss, dass eine Einwilligung des Empfängers vorlag.
Die Versendung von kommerzieller Werbung ist auch dann rechtswidrig, wenn die erklärte Zustimmung nicht von dem Empfänger selbst stammte. Um diese Praxis zu verhindern, wird heute das in dieser Hinsicht für den seriösen Versender rechtlich nicht geforderte „Double-Opt-In“- Verfahren genutzt (siehe 3.1.1). In der Vergangenheit gab es in Deutschland Abmahnungen, die aufgrund der Verifikations-Nachricht wettbewerbswidriges Verhalten erachteten und von den zuständigen Gerichten letzendlich abgewiesen wurden (vgl. [WIK08b], [TAZ07]).
In den USA gilt indes das „Opt-Out“-Prinzip, welches Werbe-E-Mails grundsätzlich ohne vorherige Einwilligung zulässt. Allerdings fordert dieses Prinzip die Möglichkeit, dass man sich mit geringem Aufwand aus dem Kreis der Empfänger löschen kann, beispielsweise aus einer Liste austragen kann (vgl. [KAR07]).
Für Versender von UCE bedeutet das „Opt-Out“-Prinzip, dass bei einer anwendbaren Rechtsprechung kein Verstoß vorliegt, wenn UCE zum Empfänger gelangt. Allerdings sind andere Anforderungen (vgl. 3.1.3) nötig, um rechtlich unbeschadet UCE zu versenden. Die Möglichkeit zum Austragen aus der Verteilerliste für den Empfänger birgt indes das Risiko, dass damit ein existierendes E-Mail- Postfach, also ein verifizierter potenzieller Kunde für weitere UCE gefunden wurde. Daher ist das Verfahren umstritten (vgl. [KAR07]). Durch die Möglichkeit der erstmaligen unerbetenen Zusendung wird die Spam-Produktion zudem begünstigt (vgl. [GEI05]).
In Band 16, „Betrieb sicherer und seriöser Mailinglisten“ wird im Detail auf die Unterschiede und technischen Rahmenbedingungen der verschiedenen „OPT“-Verfahren eingegangen. Juristisch wird hier nur in Widerspruchslösungen und Einwilligungslösungen unterschieden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit gibt einen Überblick über die juristischen Rahmenbedingungen des weltweiten Mailsystems in Bezug auf den Empfang und den Versand unerwünschter E-Mails (Spam). Dabei werden die Rechtslagen in Europa (EU), speziell in Deutschland, den USA und Australien fokussiert.
Was ist das Ziel dieser Arbeit?
Ziel ist es, die rechtlichen Unsicherheiten bei Betreibern von Mailsystemen aufzuzeigen und Wege aufzuzeigen, wie Provider und Unternehmen juristisch einwandfrei Maildienste anbieten können. Dazu gehört die Betrachtung von zulässigen Filtermaßnahmen gegen Malware und Spam, sowie die Möglichkeiten für Unternehmen und Privatpersonen, gegen unerwünschte Werbe-E-Mails vorzugehen.
Was bedeutet der Begriff "Spam" in dieser Arbeit?
In dieser Arbeit wird der Begriff Spam (Spam-E-Mail oder Junk-E-Mail) für unerwünscht zugesandte E-Mails verwendet, wobei den E-Mails ein kommerzieller Hintergrund unterstellt wird. Insbesondere unerbetene Werbe-E-Mails für Produkte, Dienstleistungen, Parteien etc. sind im Sinne dieser Arbeit als Spam zu verstehen (UCE - Unsolicited Commercial Electronical Message).
Wie wird Spam juristisch definiert?
Juristisch wird Spam, insbesondere UCE, als unverlangte Werbe-E-Mail definiert, d.h. eine E-Mail, für deren Empfang keine vorherige Einwilligung des Empfängers vorliegt und nicht zu erwarten ist.
Welche juristischen Aspekte von Spam werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt die Rechtslage und Rechtsfolgen in Deutschland, Europa, den USA und Australien im Bezug auf Spam. Des Weiteren wird der juristisch einwandfreie Einsatz von Filtermaßnahmen und -Techniken diskutiert, um sich vor Spam zu schützen.
Was ist der Unterschied zwischen dem "Opt-In"- und dem "Opt-Out"-Prinzip?
Das "Opt-In"-Prinzip (Deutschland, EU, Australien) regelt, dass Werbe-E-Mails nur mit vorheriger ausdrücklicher oder konkludenter Einwilligung des Empfängers zulässig sind. Das "Opt-Out"-Prinzip (USA) erlaubt Werbe-E-Mails grundsätzlich ohne vorherige Einwilligung, fordert aber die Möglichkeit, sich mit geringem Aufwand aus dem Kreis der Empfänger zu löschen.
Welche Gesetze in Deutschland sind in Bezug auf Spam relevant?
In Deutschland ist § 7 Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) relevant. Elektronische Werbung ohne vorherige Einwilligung (z. B. per E-Mail) ist Spam und stellt eine unzumutbare Belästigung dar.
- Arbeit zitieren
- Master of Computer Science Philipp Rothmann (Autor:in), 2008, Juristische Probleme des Spammings, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146615