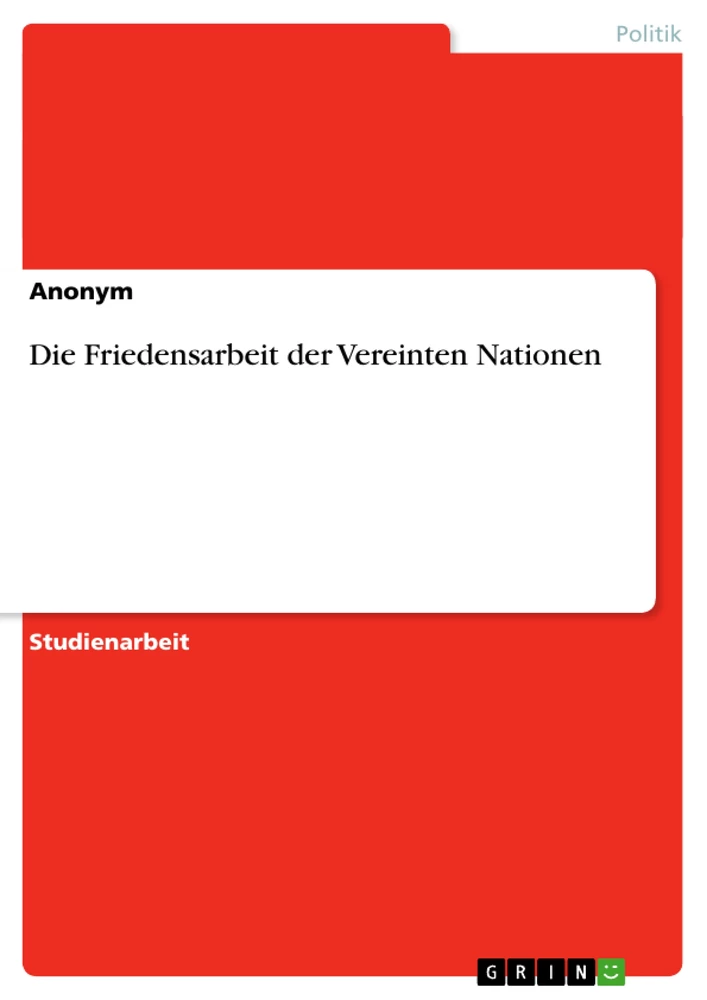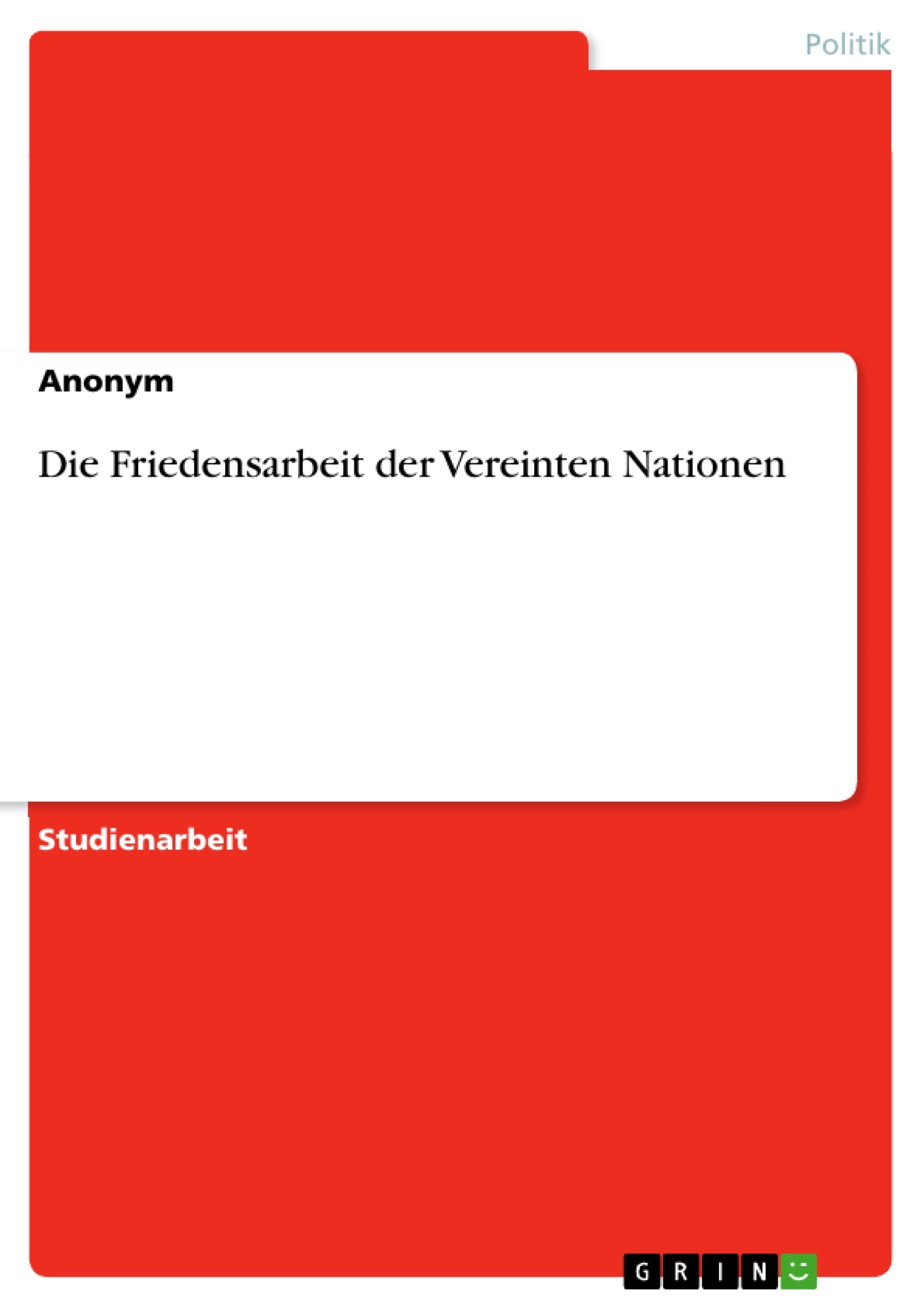„Als die Organisation der Vereinten Nationen [VN] am 24. Juni 1945 im War Memorial Opera House von San Francisco ins Leben gerufen wurde, war sie Neuanfang, zugleich aber auch eine Antwort auf das Ende eines "Großen Experiments", des Völkerbunds.“ Der 1919 begründete Völkerbund, initiiert durch Woodrow Wilsons 14-Punkte-Programm und entstanden aus dem Vertrag von Versailles, war der erste Versuch, der Welt eine allgemeingültige Friedensordnung zu geben. Die wohl größte Besonderheit dieses Friedenswerkes ist mit Sicherheit, dass die Hauptgründernation, die USA, aufgrund des Widerstandes im amerikanischen Senat am Ende nicht beitraten. Die plausibelste Begründung für die Ablehnung des Völkerbundes ist offensichtlich die Unvereinbarkeit der Einbindung souveräner Staaten in ein System gegenseitiger Sicherheit mit dem amerikanischen Freiheitsideal gewesen. „George Washington siegte [sozusagen] posthum über Woodrow Wilson.“ Eine andere Version betrifft persönliche Animositäten zwischen Präsident Wilson und dem amerikanischen Kongress. Möglicherweise darf man annehmen, dass von allem etwas dabei war. Jedenfalls war die Ablehnung des Völkerbundes durch die USA ein wesentlicher Grund dafür, dass das Bündnis nicht die in es gesetzten Erwartungen erfüllen konnte und schließlich scheiterte. Weitere Schwächen des Völkerbundes waren insbesondere ein lediglich partielles Kriegsverbot, das Einstimmigkeitsprinzip im Völkerbundrat, keine nötige Zwangsgewalt zur Durchsetzung seiner Beschlüsse und die mangelnde Universalität; der Völkerbund repräsentierte niemals die ganze Völkergemeinschaft wie heute die Vereinten Nationen mit ihren inzwischen 192 Mitgliedsstaaten. Vor allem aus diesen Kritikpunkten zogen die Vereinten Nationen Konsequenzen für die Errichtung ihrer Weltordnung. „Die Entstehung und Entwicklung der Vereinten Nationen ist insofern ohne das Wissen um die Entstehung, Schwächen und das Ende des Völkerbunds kaum zu erklären, zumal die VN den Völkerbund nicht nur ablösten, sondern auch einiges davon übernahmen“ , auch wenn sie nicht allzu viel mit ihm gemein haben. Doch gerade für diese Gelegenheit, ein neues funktionelleres System zu errichten und die Idee einer kollektiven Sicherheitsgemeinschaft fortzuführen, sollte die Bedeutung des Völkerbunds nicht geschmälert werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Vom Völkerbund zu den Vereinten Nationen
- B. Das VN-System kollektiver Sicherheit
- 1. Die fundamentalen Grundsätze der VN-Charta
- 1.1 Die friedliche Streitbeilegung
- 1.2 Das allgemeine Gewaltverbot
- 1.3 Das Souveränitäts- und das Nichteinmischungsprinzip
- 2. Die Friedensarbeit der Vereinten Nationen in der Praxis
- 2.1 Die Entwicklung des peacekeeping
- 2.2 Vielversprechende Reforminitiativen: Die Agenda für den Frieden und der Brahimi-Bericht
- C. Rück- und Ausblick für die Friedensarbeit der Vereinten Nationen
- D. Literaturverzeichnis
- E. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem System der kollektiven Sicherheit der Vereinten Nationen. Sie untersucht die Entwicklung des VN-Systems von seinen Ursprüngen im Völkerbund bis hin zu den heutigen Herausforderungen und Reformdebatten. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der fundamentalen Grundsätze der VN-Charta und deren Anwendung in der Praxis der Friedensarbeit der Vereinten Nationen.
- Entwicklung des VN-Systems von seinen Ursprüngen im Völkerbund bis zur Gegenwart
- Analyse der fundamentalen Grundsätze der VN-Charta, insbesondere im Hinblick auf die friedliche Streitbeilegung und das Gewaltverbot
- Bewertung der Friedensarbeit der Vereinten Nationen in der Praxis, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen des peacekeeping
- Diskussion der Reforminitiativen und aktuellen Debatten zur Stärkung der kollektiven Sicherheit der Vereinten Nationen
- Bedeutung des Völkerrechts und der internationalen Zusammenarbeit für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
A. Vom Völkerbund zu den Vereinten Nationen Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Völkerbundes als ersten Versuch, eine internationale Friedensordnung zu etablieren. Es analysiert die Gründe für das Scheitern des Völkerbundes und zeigt auf, wie die Vereinten Nationen auf den Fehlern des Völkerbundes aufbauten.
B. Das VN-System kollektiver Sicherheit
1. Die fundamentalen Grundsätze der VN-Charta Dieses Kapitel analysiert die Grundprinzipien der VN-Charta, insbesondere die friedliche Streitbeilegung, das allgemeine Gewaltverbot und das Souveränitäts- und Nichteinmischungsprinzip. Es zeigt die Bedeutung dieser Prinzipien für die Funktionsweise des VN-Systems und deren Anwendung in der Praxis.
2. Die Friedensarbeit der Vereinten Nationen in der Praxis
2.1 Die Entwicklung des peacekeeping Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des peacekeeping als eines der wichtigsten Instrumente der Friedensarbeit der Vereinten Nationen. Es analysiert die Herausforderungen und Erfolge des peacekeeping im Laufe der Zeit.
2.2 Vielversprechende Reforminitiativen: Die Agenda für den Frieden und der Brahimi-Bericht Dieses Kapitel stellt aktuelle Reforminitiativen zur Stärkung der kollektiven Sicherheit der Vereinten Nationen vor, wie die Agenda für den Frieden und den Brahimi-Bericht. Es analysiert deren Bedeutung für die Zukunft der Friedensarbeit der Vereinten Nationen.
Schlüsselwörter
Kollektive Sicherheit, Vereinte Nationen, VN-Charta, Friedensarbeit, peacekeeping, friedliche Streitbeilegung, Gewaltverbot, Nichteinmischungsprinzip, Souveränität, Völkerbund, Reforminitiativen, Agenda für den Frieden, Brahimi-Bericht, internationales Recht, internationale Zusammenarbeit, Weltfrieden, internationale Sicherheit.
Häufig gestellte Fragen
Warum scheiterte der Völkerbund als Friedensordnung?
Hauptgründe waren das Fehlen der USA, das Einstimmigkeitsprinzip im Rat, mangelnde Zwangsgewalt zur Durchsetzung von Beschlüssen und ein nur partielles Kriegsverbot.
Was sind die fundamentalen Grundsätze der VN-Charta?
Dazu gehören die friedliche Streitbeilegung, das allgemeine Gewaltverbot sowie das Souveränitäts- und Nichteinmischungsprinzip.
Wie hat sich das "Peacekeeping" der Vereinten Nationen entwickelt?
Peacekeeping entwickelte sich als praktisches Instrument zur Friedenssicherung, das über die Jahre an neue Herausforderungen wie innerstaatliche Konflikte angepasst wurde.
Was beinhalten Reforminitiativen wie die "Agenda für den Frieden"?
Diese Initiativen zielen darauf ab, die kollektive Sicherheit zu stärken, Frühwarnsysteme zu verbessern und die Effizienz von Friedenseinsätzen (Brahimi-Bericht) zu steigern.
Was unterscheidet die VN heute maßgeblich vom Völkerbund?
Die Vereinten Nationen besitzen eine nahezu universelle Mitgliedschaft und verfügen über einen Sicherheitsrat mit weitreichenden Kompetenzen zur Friedenserzwingung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Die Friedensarbeit der Vereinten Nationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146634