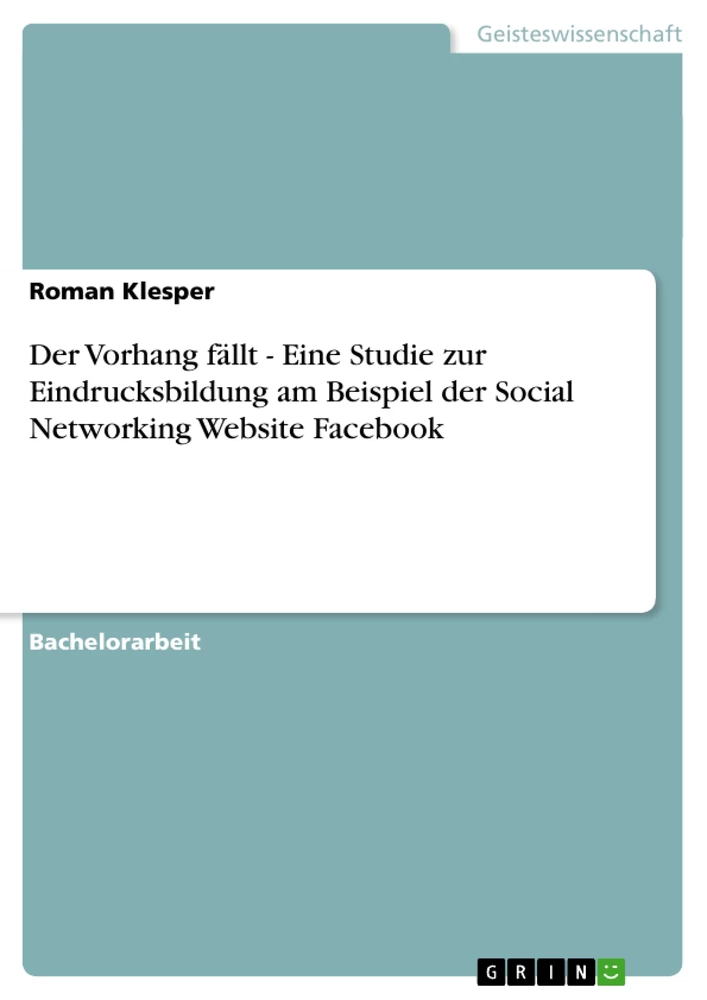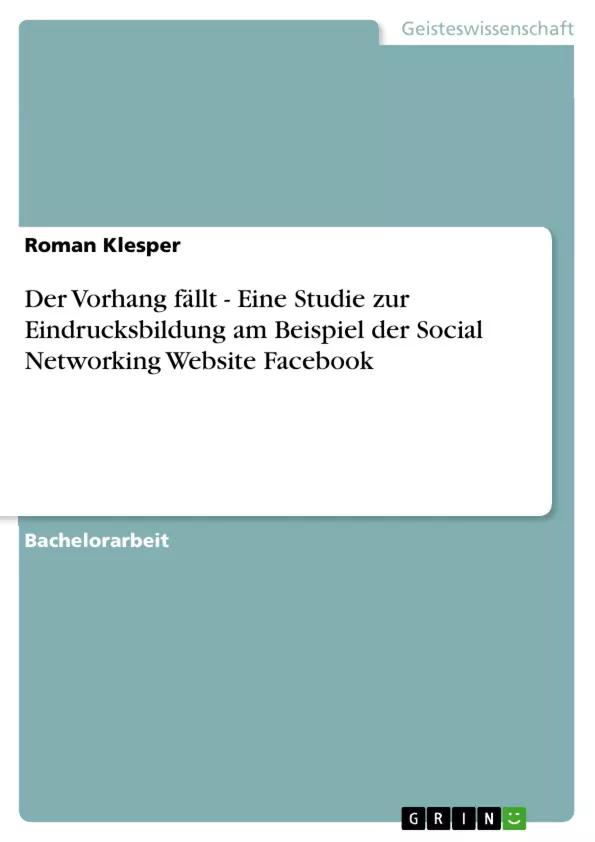Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich anhand einer Analyse der Social Net-working Website „Facebook“ mit den Phänomenen der „Eindrucksbildung“ und der „Selbstdarstellung“.
Eine Studie der Pricewaterhouse Coopers aus dem Jahr 2008 hat ergeben, dass sich soziale Online-Netzwerke wie „YouTube“, „Xing“, „StudiVZ“ und „Facebook“ im Zeitalter des Web 2.0 wachsender Beliebtheit erfreuen. Die meisten der in der Studie unter-suchten Netzwerke weisen dabei einen Bekanntheitsgrad von 50 – 96% bei den Be-fragten auf. Gerade in der Altersgruppe der 20 – 28jährigen ersetzt ein solches soziales Netzwerk häufig die Funktionen von SMS, E-Mail oder Telefon, da 50% der befragten Nutzerinnen und Nutzer den Kontakt zu Personen mit ähnlichen Interessen anstreben und überwiegend solche Online-Plattformen bevorzugen, in denen der eigene Freundeskreis vertreten ist (Pricewaterhouse Coopers, 2008).
Bedingt durch unsere Umwelt, die uns bestimmenden Umstände und die uns umge-benden Personen wechselt jeder Mensch jeden Tag sein Erscheinungsbild und/oder sein Verhalten. Dabei steht zumeist nicht im Vordergrund, den besten Eindruck für eine bestimmte Situation zu erzeugen, sondern es geht vielmehr um die Herstellung und Aufrechterhaltung eines strategischen interpersonellen Kontakts.
Das Netzwerk „Facebook“ ist mit über fünf Millionen deutschen Nutzern eines der größten Online-Portale und bietet seinen Mitgliedern unzählige Möglichkeiten, ihren Kontakten durch das Aufzeigen und Mitteilen vielfältiger Aspekte des eigenen Lebens ein entsprechendes Bild von sich selbst zu vermitteln (Facebook, 2009).
Ziel dieser Arbeit ist nun die Überprüfung, welcher Zusammenhang zwischen der Nut-zungsintensität der Plattform „Facebook“, den Persönlichkeitsmerkmalen der Nutzer und dem Grad des „self-monitoring“ der einzelnen Probanden besteht.
Auf der Grundlage der Inhalte der Theorien des „Impression Management“ und des „self-monitorings“ wurde hierzu (2009) eine Onlineumfrage mit N= 194 Befragten durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Impression Management in der Interaktion auf Facebook
- Der Begriff des Web 2.0
- Das Web als Plattform
- Kollektive Intelligenz
- Daten als „Intel Inside“
- Lightweight Programming Models
- Software über Gerätegrenzen hinweg
- Rich User Experiences
- Facebook-Daten und Fakten
- Die Anziehungskraft von Social Networks wie Facebook
- Selbstdarstellung – Die Präsentation der eigenen Person
- Selbstbezogene und prosoziale Motive der Selbstdarstellung
- Begriffsdefinition Impression Management
- Die Impression-Management-Theorie
- Ursprünge der Theorie
- Die Impression-Management-Theorie nach Tedeschi
- Assertive Taktiken
- Ingratiation
- Self-Promotion
- Die Theorie des Self-Monitoring
- Neuere Ansätze der Self-Monitoring-Theorie
- Impression Management und die Persönlichkeit
- Das Modell der „Big Five“-Faktoren
- Die Persönlichkeitsausprägung „Extraversion“
- Konzeption und Methode
- Objektivität, Reliabilität und Validität
- Objektivität
- Reliabilität
- Validität
- Stichprobenwahl und Grundgesamtheit
- Forschungsdesign
- Untersuchungsleitende Fragestellung und Hypothesen
- Operationalisierung
- „Ingratiation“
- „Self-Promotion“
- Erfüllung der Testgütekriterien
- Objektivität
- Reliabilität
- Validität
- Durchführung der Befragung
- Auswertung des Fragebogens
- Die statistische Auswertung durch Unipark
- Auswertung durch SPSS
- Repräsentativität der Stichprobe
- Allgemeine Informationen
- Deskriptive Statistik
- Auswertung der Hypothesen
- Facebook und Extraversion
- Extraversion, Self-Monitoring und Self-Promotion
- Geschlechtsspezifische Unterschiede
- Interpretation der Ergebnisse
- Facebook und Extraversion
- Geschlechtsspezifische Unterschiede
- Extraversion, Self-Monitoring und Self-Promotion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen der „Eindrucksbildung“ und der „Selbstdarstellung“ im Kontext der Social Networking Website Facebook. Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen der Nutzungsintensität von Facebook, den Persönlichkeitsmerkmalen der Nutzer und dem Grad des „self-monitoring“.
- Die Bedeutung von Social Networking im Web 2.0
- Die Theorie des Impression Management und ihre Anwendung im Kontext von Facebook
- Die Rolle des Self-Monitorings bei der Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken
- Der Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf die Nutzung von Facebook
- Die Analyse der Ergebnisse einer Online-Umfrage mit 194 Teilnehmern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und erläutert die Relevanz des Themas der Selbstdarstellung im digitalen Zeitalter.
- Impression Management in der Interaktion auf Facebook: Dieses Kapitel beschreibt das Konzept des Web 2.0 und die spezifischen Eigenschaften von Social Networking Websites wie Facebook. Es beleuchtet die Nutzung von Facebook als Plattform für soziale Interaktion und Selbstdarstellung.
- Selbstdarstellung – Die Präsentation der eigenen Person: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Selbstdarstellung und erläutert die verschiedenen Motive, die Menschen dazu bewegen, sich online zu präsentieren.
- Die Impression-Management-Theorie: Dieses Kapitel präsentiert die Theorie des Impression Managements und ihre Relevanz für das Verständnis von Selbstdarstellungsstrategien. Es beleuchtet die verschiedenen Taktiken, die Menschen einsetzen, um einen bestimmten Eindruck bei anderen zu hinterlassen.
- Konzeption und Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methode, die in der Arbeit verwendet wurde, um den Zusammenhang zwischen Facebook-Nutzung, Persönlichkeitsmerkmalen und Self-Monitoring zu untersuchen. Es erläutert die Stichprobenwahl, das Forschungsdesign und die Operationalisierung der verwendeten Konzepte.
- Auswertung des Fragebogens: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Online-Umfrage. Es werden deskriptive Statistiken und die Ergebnisse der Hypothesentests dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der „Eindrucksbildung“ und der „Selbstdarstellung“ im Kontext von Social Networking Websites wie Facebook. Weitere Schlüsselbegriffe sind: Web 2.0, Impression Management, Self-Monitoring, Persönlichkeitsmerkmale, Online-Umfrage, Social Media.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Studie zum Thema Facebook?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Nutzungsintensität von Facebook, den Persönlichkeitsmerkmalen der Nutzer (Big Five) und dem Grad des „Self-Monitorings“.
Was versteht man unter "Impression Management"?
Es bezeichnet die Strategien, mit denen Personen versuchen, den Eindruck, den andere von ihnen haben, zu kontrollieren und zu steuern, insbesondere in sozialen Netzwerken.
Welche Rolle spielt die Extraversion bei der Facebook-Nutzung?
Die Arbeit analysiert, wie stark das Persönlichkeitsmerkmal Extraversion die Selbstdarstellung und die Interaktionshäufigkeit auf der Plattform beeinflusst.
Was ist "Self-Monitoring"?
Self-Monitoring ist die Fähigkeit und Tendenz, das eigene Verhalten an soziale Situationen und die Erwartungen anderer anzupassen, um einen bestimmten Eindruck zu erzeugen.
Wie wurde die Untersuchung durchgeführt?
Es wurde eine Online-Umfrage mit 194 Teilnehmern durchgeführt und statistisch mit Tools wie SPSS ausgewertet.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Selbstdarstellung auf Facebook?
Ja, die Studie untersucht und interpretiert Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich ihrer Strategien beim Impression Management.
- Quote paper
- Roman Klesper (Author), 2009, Der Vorhang fällt - Eine Studie zur Eindrucksbildung am Beispiel der Social Networking Website Facebook, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146642