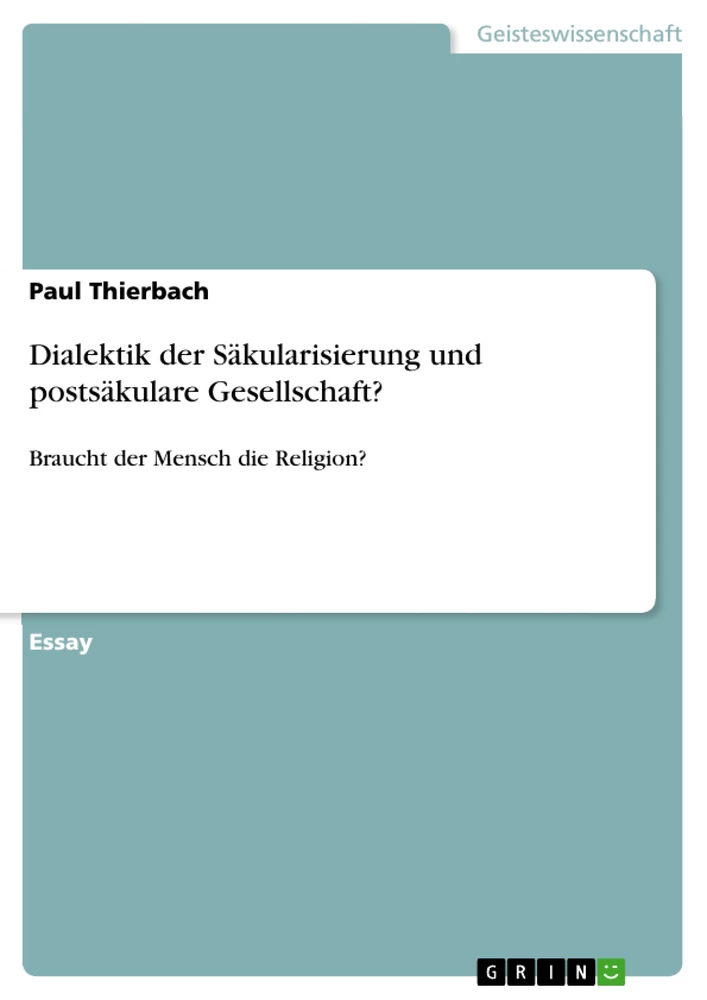Im mit dem Ende des Kalten Krieges neu aufgelegten großen Glaubenskrieg zwischen den drei monotheistischen Weltreligionen hat sich eine neue Front gebildet. Diese verläuft quer zu allen Glaubensrichtungen und durch jede einzelne westliche Gesellschaft. Es sind die so genannten „neuen Atheisten“ die den Kampf gegen die Religion an sich aufgenommen haben, allerdings mit deutlich weniger kriegerischen Mitteln. Die von Jon Worth initiierte „Atheist Bus Campaign“ in Großbritannien, die „Pro-Reli-Kampagne“ in Berlin und der Konflikt um die Sterbehilfe für Eluana Englaro in Italien sind nur aktuelle Hinweise auf die neue Frontlinie. Hinter konkreten Konfliktthemen wie Abtreibung, Sterbehilfe und Gentechnik geht es dabei um eine sehr viel bedeutendere Frage: Brauchen die Menschen die Religion, oder können sie gut auf sie verzichten?
In diesem Essay möchte ich einige Anregungen zur Beantwortung dieser Frage geben. Dazu werde ich mich besonders mit den Gedanken von Jürgen Habermas auseinandersetzen, da dieser sich in letzter Zeit intensiv und kontrovers mit dem Thema beschäftigt hat. Ausgangspunkt ist die umstrittene These dieses eigentlich in der Tradition der Aufklärung stehenden Sozialphilosophen, dass die Religion notwendig ist, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Ich werde dagegen den Standpunkt vertreten, dass die säkulare Gesellschaft aus sich selbst heraus nicht nur ein von allen Gräueln befreites funktionales Äquivalent zur Religion schaffen kann, sondern dabei auch noch die Freiheit gewinnt, über Gut und Böse selbst zu entscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Dialektik der Säkularisierung und postsäkulare Gesellschaft?
- Braucht der Mensch die Religion?
- Habermas' These zur Notwendigkeit der Religion
- Einwände gegen die Habermassche „Dialektik der Säkularisierung“
- Voltaires Argument für die Funktionsfähigkeit der Religion
- Die Grenzen der Übersetzung religiöser Normen
- Moderne Werte und das Christentum
- Die Integrationsfähigkeit der Religion
- Diskriminierung von Säkularen durch die Religion
- Die „Diktatur des Relativismus“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit der Frage, ob die Religion für die Gesellschaft notwendig ist oder ob sie sich selbst aus einer säkularen Perspektive heraus neu erfinden kann. Die zentrale These des Autors ist, dass die säkulare Gesellschaft nicht nur ein funktionales Äquivalent zur Religion schaffen kann, sondern dabei auch noch die Freiheit gewinnt, über Gut und Böse selbst zu entscheiden.
- Die Dialektik der Säkularisierung und die postsäkulare Gesellschaft
- Der funktionale Beitrag der Religion zur Gesellschaft
- Die Grenzen der Aufklärung und die Notwendigkeit der Religion
- Einwände gegen die Habermassche These
- Die Bedeutung von säkularen Werten und Menschenrechten
Zusammenfassung der Kapitel
- Dialektik der Säkularisierung und postsäkulare Gesellschaft?: Der Autor führt in die Debatte um die Rolle der Religion in der modernen Gesellschaft ein und stellt die Frage, ob die Menschen die Religion brauchen oder ob sie gut auf sie verzichten können.
- Braucht der Mensch die Religion?: Der Autor präsentiert die These von Jürgen Habermas, der die Religion als notwendig für den Zusammenhalt der Gesellschaft erachtet. Er kritisiert die „politisch unbeherrschte Dynamik von Weltwirtschaft und Weltgesellschaft“ und argumentiert, dass die Religion einen wichtigen Beitrag zur Stabilität der Gesellschaft leistet.
- Habermas' These zur Notwendigkeit der Religion: Der Autor erläutert die Argumentation von Habermas, der die Religion als eine Kraft sieht, die die säkulare Vernunft zähmt und die Demokratie und Menschenrechte unterstützt.
- Einwände gegen die Habermassche „Dialektik der Säkularisierung“: Der Autor präsentiert eine Reihe von Einwänden gegen die These von Habermas. Er argumentiert, dass die Existenz Gottes unwahrscheinlich ist und dass die Religion eher ein menschliches Konstrukt als eine göttliche Offenbarung ist.
- Voltaires Argument für die Funktionsfähigkeit der Religion: Der Autor verweist auf die positiven Funktionen der Religion, die von Voltaire und der Religionssoziologie aufgezeigt werden. Er argumentiert jedoch, dass ein weltliches funktionales Äquivalent zur Religion geschaffen werden kann.
- Die Grenzen der Übersetzung religiöser Normen: Der Autor kritisiert die Forderung von Habermas, religiöse Normen in säkulare Pendants zu übersetzen. Er argumentiert, dass viele religiöse Normen heute nicht mehr akzeptabel sind und dass ein solches Unterfangen kaum praktikabel wäre.
- Moderne Werte und das Christentum: Der Autor weist darauf hin, dass moderne Werte wie die Menschenrechte nicht aus dem Christentum stammen, sondern von Religionskritikern wie Thomas Paine erdacht wurden.
- Die Integrationsfähigkeit der Religion: Der Autor argumentiert, dass die Religion zwar innerhalb einer Glaubensgemeinschaft integrieren kann, aber nicht für die Gesamtintegration in der pluralistischen Gesellschaft geeignet ist.
- Diskriminierung von Säkularen durch die Religion: Der Autor argumentiert, dass nicht die gläubigen Bürger, sondern die säkularen Bürger von den Vorschriften der Religion benachteiligt werden, da diese oft auch für nicht-religiöse Bürger gelten sollen.
- Die „Diktatur des Relativismus“: Der Autor kritisiert die Behauptung von Glaubensvertretern, dass die moderne Gesellschaft unter einer „Diktatur des Relativismus“ leide. Er argumentiert, dass die ständige Aushandlung von Normen in einer pluralistischen Gesellschaft notwendig und legitim ist.
Schlüsselwörter
Dieser Essay behandelt die Themen Säkularisierung, postsäkulare Gesellschaft, Religion, Vernunft, Aufklärung, Demokratie, Menschenrechte, Integration, Pluralismus, Weltwirtschaft, Weltgesellschaft, Habermas, Voltaire, Dawkins, Schmidt-Salomon, Deschner, Flores d'Arcais.
Häufig gestellte Fragen
Braucht eine moderne Gesellschaft Religion für ihren Zusammenhalt?
Jürgen Habermas vertritt die These, dass Religion notwendig ist, während der Autor des Essays argumentiert, dass eine säkulare Gesellschaft aus sich selbst heraus stabil sein kann.
Was bedeutet „Dialektik der Säkularisierung“?
Es beschreibt den Prozess, in dem die Vernunft erkennt, dass sie auf religiöse Überlieferungen angewiesen sein könnte, um moralische Leerräume zu füllen.
Stammen moderne Werte wie Menschenrechte aus dem Christentum?
Der Autor widerspricht dieser Annahme und weist darauf hin, dass Menschenrechte oft gegen den Widerstand der Kirchen von Religionskritikern erkämpft wurden.
Was ist eine postsäkulare Gesellschaft?
Ein Begriff von Habermas für moderne Gesellschaften, die sich auf das Fortbestehen religiöser Gemeinschaften in einer säkularen Umgebung einstellen müssen.
Wer sind die „neuen Atheisten“?
Es sind Denker wie Dawkins oder Schmidt-Salomon, die Religion als überholt betrachten und für eine rein wissenschaftlich-rationale Weltanschauung plädieren.
- Citation du texte
- Paul Thierbach (Auteur), 2009, Dialektik der Säkularisierung und postsäkulare Gesellschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146760