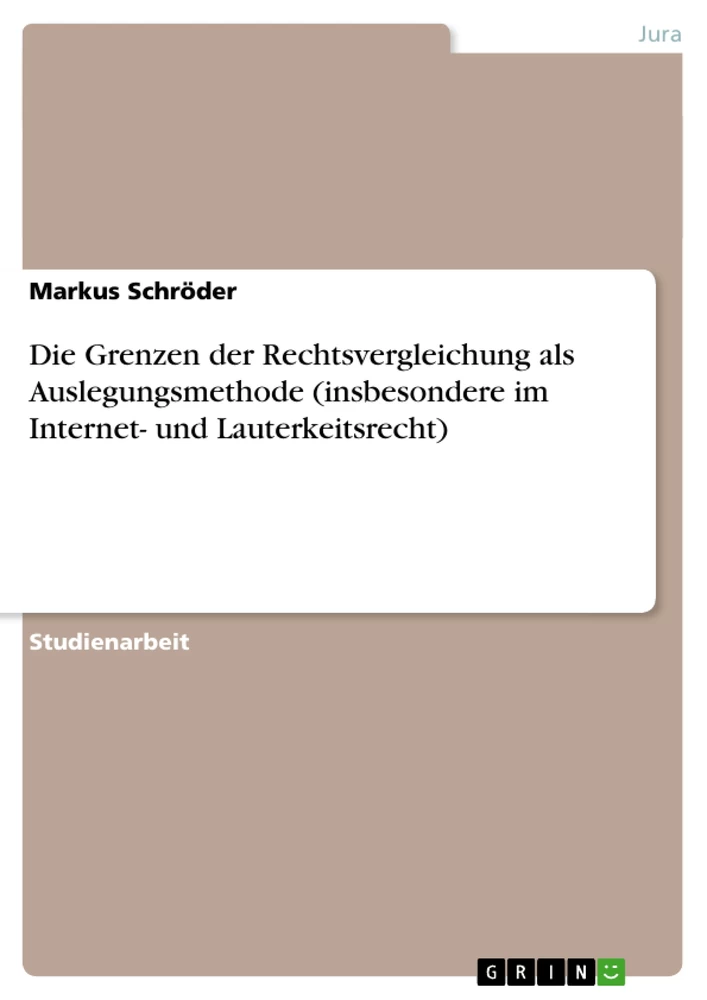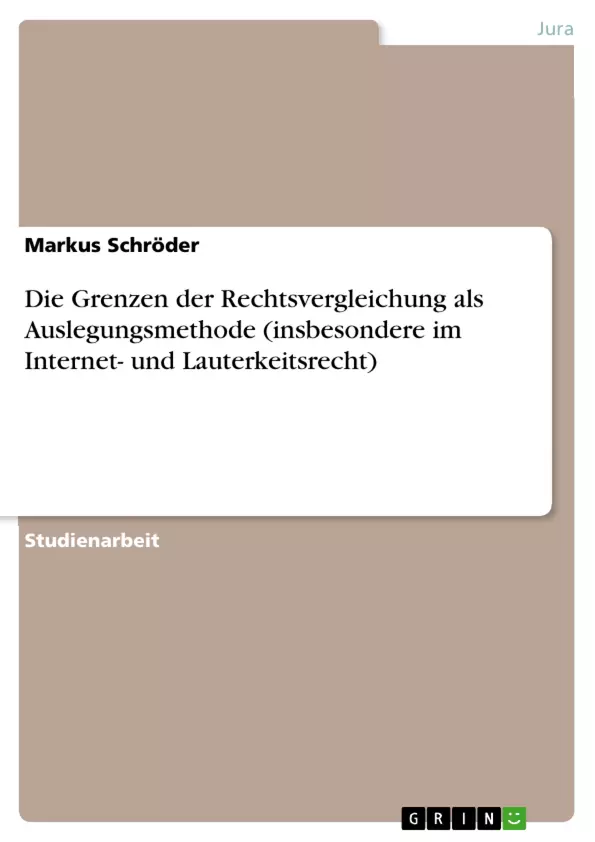Die Welt wächst zusammen. In der Welt der Wirtschaft zeigt sich die Globalisierung nirgendwo so deutlich wie im Bereich der Internetökonomie. Internationale, zumeist US-amerikanische, Unternehmen erlangen eine überragende Präsens und Marktdominanz. Damit geht zwangsläufig einher,dass diese Unternehmen Verträge zumeist ihrer heimatlichen Rechtsordnung und Jurisdiktion unterstellen. Gerichte und der Gesetzgeber werden dadurch mit der Frage konfrontiert, ob und wenn ja innerhalb welcher Grenzen man ausländische Rechtsordnungen im Rahmen der Rechtsvergleichung und als Argumentationshilfe heranziehen soll und darf. Beispiele hierfür sind die AdWords-Verfahren vor dem EuGH, die Diskussion um das Zugangserschwerungsgesetz in Deutschland sowie der Vergleich zum deutschen UWG in der Auslegung des UWG in Österreich. Die vorliegende Arbeit geht diesen wichtigen Fragen nach. Es werden Möglichkeiten und Grenzen der Rechtsvergleichung aufgezeigt und diese Grundsätze auf Sachverhalte aus dem Internet- und Lauterkeitsrecht übertragen. Besondere Bedeutung haben dabei das Verhältnis von Civil Law und Common Law sowie die Ebene des europäischen Rechts.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Grundlagen der rechtsvergleichenden Auslegung
- I. Die verschiedenen Rechtskreise
- II. Mikro- und Makrovergleichung
- III. Die dogmatische Einordnung der Rechtsvergleichung
- 1. Rechtsvergleichung und Rechtsdogmatik
- 2. Rechtsvergleichung als Hilfsfunktion
- 3. Rechtsvergleichung als eigenständige Auslegungsmethode
- 4. Stellungnahme
- IV. Probleme der Rechtsvergleichung
- 1. Territorialitäts-, Legalitäts- und Gewaltenteilungsprinzip
- 2. Die Auswahl der zu vergleichenden Rechtsordnungen
- a) Gemeinsamer Rechtskreis
- b) Unterschiedlicher Rechtskreis
- aa) Neuartige Rechtsprobleme
- bb) EU-Recht
- C. Anwendung der Rechtsvergleichung
- I. Wissenschaft
- II. Gesetzgebung
- III. Rechtsprechung
- 1. Nationale Gerichte
- a) Rechtsvergleichung innerhalb des eigenen Rechtskreises
- b) Rechtsvergleichung mit anderen Rechtskreisen
- c) EU-Recht
- 2. EuGH
- a) Art. 220, 288 EGV
- b) Rechtsvergleichung zur Lückenfüllung
- 1. Nationale Gerichte
- D. Schlussfolgerungen für die weitere Entwicklung der Rechtsvergleichung
- E. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Grenzen und Möglichkeiten der Rechtsvergleichung als Auslegungsmethode, insbesondere im Internet- und Lauterkeitsrecht. Der Fokus liegt auf der Klärung, wie und inwieweit rechtsvergleichende Ansätze in gerichtliche Entscheidungen Eingang finden können, vor dem Hintergrund der Globalisierung und der Herausforderungen, die sich daraus für den Rechtsanwender und Gesetzgeber ergeben.
- Die verschiedenen Rechtskreise (Civil Law vs. Common Law)
- Die dogmatische Einordnung der Rechtsvergleichung als Auslegungsmethode
- Probleme der Rechtsvergleichung im Kontext von Territorialitäts-, Legalitäts- und Gewaltenteilungsprinzipien
- Anwendung der Rechtsvergleichung in Wissenschaft, Gesetzgebung und Rechtsprechung
- Die Rolle der Rechtsvergleichung bei neuartigen Rechtsproblemen im Internetbereich
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Die Einführung beschreibt den Kontext der Arbeit, ausgehend von der zunehmenden Globalisierung und den daraus resultierenden Herausforderungen für das Recht. Sie hebt die Schwierigkeiten hervor, die sich aus der Dominanz US-amerikanischer Unternehmen und deren Nutzungsbedingungen ergeben, die nicht immer mit nationalen Rechtsordnungen konform sind. Die Arbeit stellt die zentrale Frage nach der Nutzbarkeit der Rechtsvergleichung zur Lösung derartiger Probleme und deren Anwendung in gerichtlichen Entscheidungen. Das Beispiel der Google AdWords-Rechtssachen des EuGH wird als aktuelles Beispiel für die Notwendigkeit der Rechtsvergleichung angeführt.
B. Grundlagen der rechtsvergleichenden Auslegung: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die weitere Analyse. Es beginnt mit der Erörterung verschiedener Rechtskreise und der Einteilung in Civil Law und Common Law Systeme, wobei die Unterschiede in der Rechtsfindung (kodifiziertes Recht vs. Case Law) hervorgehoben werden. Das Kapitel befasst sich weiter mit der dogmatischen Einordnung der Rechtsvergleichung, beleuchtet ihre Rolle als Hilfsfunktion und eigenständige Methode und analysiert die damit verbundenen Probleme, insbesondere im Hinblick auf die Auswahl der zu vergleichenden Rechtsordnungen und die Berücksichtigung von Prinzipien wie Territorialität, Legalität und Gewaltenteilung.
C. Anwendung der Rechtsvergleichung: Dieses Kapitel analysiert die Anwendung der Rechtsvergleichung in der Wissenschaft, Gesetzgebung und Rechtsprechung. Im Detail wird auf die Anwendung in nationalen Gerichten eingegangen, wobei die Unterscheidung zwischen der Rechtsvergleichung innerhalb des eigenen Rechtskreises und mit anderen Rechtskreisen sowie die Einbindung des EU-Rechts betont wird. Die Rolle des EuGH und die Verwendung der Rechtsvergleichung zur Lückenfüllung werden ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Rechtsvergleichung, Auslegungsmethode, Internetrecht, Lauterkeitsrecht, Globalisierung, Civil Law, Common Law, EU-Recht, Rechtsdogmatik, gerichtliche Entscheidungen, Google AdWords, Territorialitätsprinzip, Legalitätsprinzip, Gewaltenteilung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Rechtsvergleichende Auslegung
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Rechtsvergleichung als Auslegungsmethode, insbesondere im Internet- und Lauterkeitsrecht. Der Fokus liegt auf der Frage, wie und inwieweit rechtsvergleichende Ansätze in gerichtliche Entscheidungen einfließen können, insbesondere im Kontext der Globalisierung und der damit verbundenen Herausforderungen für Rechtsanwender und Gesetzgeber.
Welche Rechtskreise werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht vorwiegend Civil Law und Common Law Systeme, wobei die Unterschiede in der Rechtsfindung (kodifiziertes Recht vs. Case Law) im Detail beleuchtet werden. Es wird auch der Einfluss des EU-Rechts berücksichtigt.
Wie wird die Rechtsvergleichung dogmatisch eingeordnet?
Die Arbeit analysiert die Rechtsvergleichung sowohl als Hilfsfunktion als auch als eigenständige Auslegungsmethode. Sie untersucht ihre Stellung im Verhältnis zur Rechtsdogmatik und die damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Probleme der Rechtsvergleichung werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet Probleme im Kontext von Territorialitäts-, Legalitäts- und Gewaltenteilungsprinzipien. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Auswahl geeigneter Rechtsordnungen für den Vergleich, insbesondere bei neuartigen Rechtsproblemen im Internetbereich.
Wo wird die Rechtsvergleichung angewendet?
Die Anwendung der Rechtsvergleichung wird in der Wissenschaft, Gesetzgebung und Rechtsprechung untersucht. Die Arbeit analysiert die Rolle nationaler Gerichte, insbesondere die Unterscheidung zwischen innerstaatlicher und grenzüberschreitender Rechtsvergleichung. Die Bedeutung des EuGH und die Nutzung der Rechtsvergleichung zur Lückenfüllung werden ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielt das EU-Recht?
Das EU-Recht spielt eine wichtige Rolle in der Arbeit. Es wird untersucht, wie das EU-Recht die Rechtsvergleichung beeinflusst und wie die Rechtsvergleichung zur Auslegung und Anwendung von EU-Recht beiträgt. Konkrete Artikel des EGV werden erwähnt.
Welches Beispiel wird verwendet, um die Notwendigkeit der Rechtsvergleichung zu verdeutlichen?
Die Google AdWords-Rechtssachen des EuGH dienen als aktuelles Beispiel für die Notwendigkeit und Relevanz der Rechtsvergleichung in der Praxis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einführung, Grundlagen der rechtsvergleichenden Auslegung, Anwendung der Rechtsvergleichung, Schlussfolgerungen und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Rechtsvergleichung und deren Anwendung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rechtsvergleichung, Auslegungsmethode, Internetrecht, Lauterkeitsrecht, Globalisierung, Civil Law, Common Law, EU-Recht, Rechtsdogmatik, gerichtliche Entscheidungen, Google AdWords, Territorialitätsprinzip, Legalitätsprinzip, Gewaltenteilung.
- Citation du texte
- LL.M. (Informationsrecht) Markus Schröder (Auteur), 2010, Die Grenzen der Rechtsvergleichung als Auslegungsmethode (insbesondere im Internet- und Lauterkeitsrecht), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146789