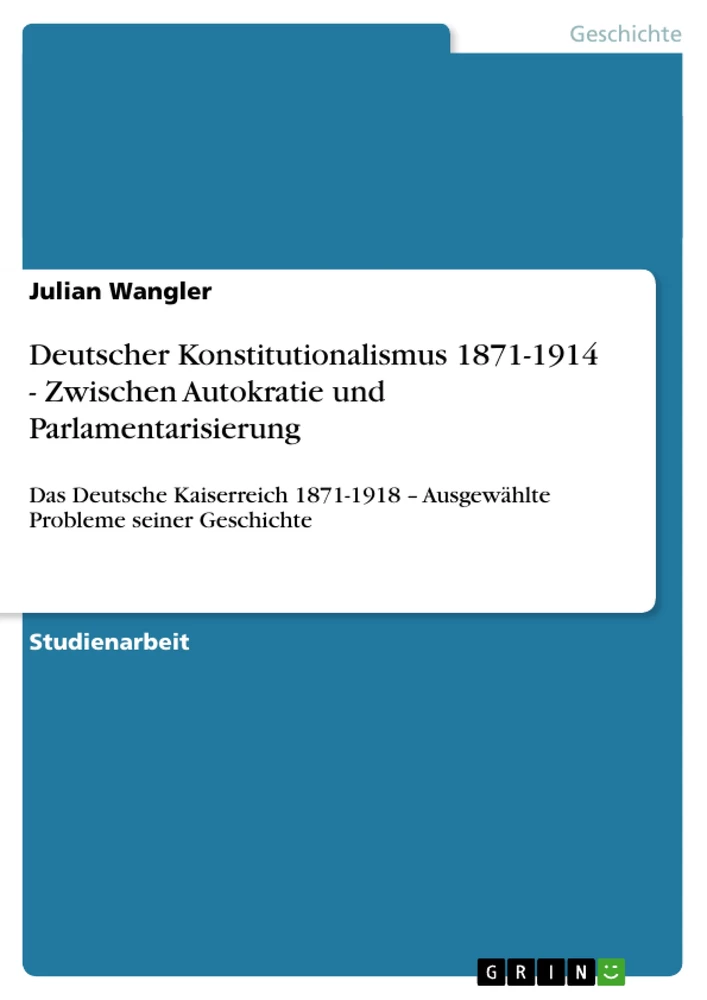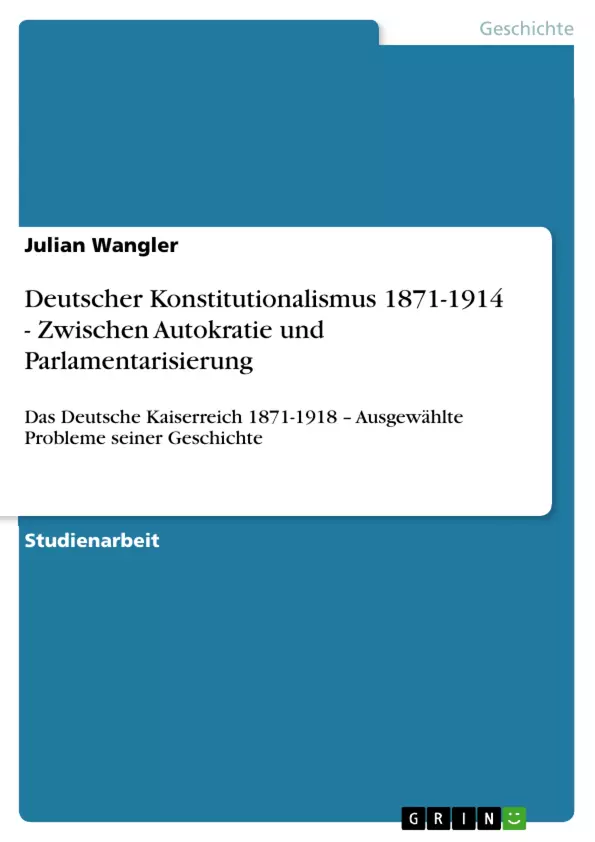In dieser Arbeit wird die Eigendynamik thematisiert, die das politische System des Deutschen Kaiserreichs zunehmend entwickelte und sich so von der ursprünglichen Konstruktionsintentionen Bismarcks entfernt hat. Wenn heute von der konstitutionellen Monarchie des deutschen Kaiserreichs die Rede ist, gerät ein zentrales Faktum hinter der vermeintlichen Eindeutigkeit des Begriffs schnell in Vergessenheit: „Die Verfassung des Kaiserreichs war ein merkwürdiger Zwitter, eine Mischung aus konservativen und progressiven Elementen“. Die Idee des nationalen Einheitsstaats wurde von den preußischen Machthabern, allem voran Otto von Bismarck, gezielt instrumentalisiert, um den Fortbestand der Krone als politische Leitinstanz und zudem Preußens Dominanz im kleindeutschen Raum zu zementieren. Hierbei versuchte das Kaiserreich historisch gegensätzliche Kräfte und Ideen – Föderalismus und Unitarismus, Volkssouveränität und monarchisches Prinzip – auszubalancieren. Damit grenzte es sich sowohl von östlichen neoabsolutistischen wie westlichen parlamentarischen Regierungssystemen ab. Jener seltsamen Mittellage ist es geschuldet, dass Wolfgang J. Mommsen das Kaiserreich als ein „System umgangener Entscheidungen“ charakterisiert. Gleichsam verweist dieses Urteil auf eine spezifische Problemlage, der sich der deutsche Nationalstaat über den Fortgang der Dekaden hinweg zusehends ausgesetzt sah: die realpolitische Eigendynamik des Systems gegenüber den verfassungsväterlichen Intentionen von Reichsgründer Bismarck. Die vorliegende Hausarbeit soll, im Gefolge einer knappen Klärung des Begriffs um den deutschen Konstitutionalismus, das Kaiserreich zunächst unter folgender Fragestellung betrachten: Wie nahm sich jene Eigendynamik des politischen Systems, von der Bismarck-Zeit bis in die Wilhelminische Ära hinein, bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs aus? In diesem Zusammenhang erschien eine logische Separierung der Arbeit in zwei Teile sinnvoll, wobei zunächst Bismarcks verfassungspolitische Ziele und sodann die Verfassungswirklichkeit dargestellt werden sollen. Untersucht werden die politischen Kräftefelder Bundesrat und Reichstag sowie Reichskanzler und Kaiser und ihr Spannungsverhältnis zu- wie untereinander. In der Schlussbetrachtung schließlich soll die Frage beantwortet werden, ob – und wenn ja: inwiefern – es im Wilhelminismus tatsächlich eine klare Parlamentarisierung des deutschen Reichs gegeben haben könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutscher Konstitutionalismus
- Verfassungspolitische Ziele Bismarcks
- Kalkulierter Föderalismus
- Geduldetes Parlament
- Verfassungskaiser
- Reichskanzler als Integrationsfigur
- Verfassungswirklichkeit
- Auflösung preußischer Hegemonie
- Parlamentarisierung unter dem Kaiser
- Persönliches Regiment
- Schwindende Kanzlerautorität
- Schlussbetrachtung: Deutscher Konstitutionalismus als transitorisches Phänomen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den deutschen Konstitutionalismus im Kaiserreich von 1871 bis 1914. Sie beleuchtet die Spannungen zwischen dem monarchischen Prinzip und dem aufstrebenden Parlamentarisierungsstreben, die den deutschen Nationalstaat prägten. Dabei steht die Frage im Zentrum, wie die politische Entwicklung im Kaiserreich die verfassungspolitischen Ziele Bismarcks übertraf und zu einem „System umgangener Entscheidungen“ führte.
- Die Entwicklung des deutschen Konstitutionalismus im Kaiserreich
- Bismarcks verfassungspolitische Ziele und deren Umsetzung
- Die Rolle des Bundesrats und des Reichstags in der politischen Entscheidungsfindung
- Das Spannungsverhältnis zwischen Kaiser, Reichskanzler und den politischen Organen
- Die Frage nach einer möglichen Parlamentarisierung im Wilhelminismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Besonderheiten des deutschen Konstitutionalismus und stellt die Problematik des Zusammenspiels von Monarchie und parlamentarischen Elementen dar. Es wird die Frage nach der Eigendynamik des politischen Systems im Kaiserreich aufgeworfen.
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Begriff des deutschen Konstitutionalismus und analysiert die Entstehung der Reichsverfassung. Es beleuchtet die Rolle Preußens als Hegemonialmacht und die spezifischen Konstitutionsbedingungen des Kaiserreichs.
Das zweite Kapitel behandelt Bismarcks verfassungspolitische Ziele. Es analysiert die Rolle des Bundesrats als Instrument preußischer Hegemonie und die strategische Nutzung des Reichstags durch Bismarck.
Das dritte Kapitel untersucht die Verfassungswirklichkeit im Kaiserreich. Es beleuchtet die Auflösung der preußischen Hegemonie, die Parlamentarisierung unter dem Kaiser und die zunehmende Bedeutung des persönlichen Regiments.
Schlüsselwörter
Deutscher Konstitutionalismus, Kaiserreich, Bismarck, Bundesrat, Reichstag, Parlamentarisierung, Monarchie, Föderalismus, Unitarismus, Machtstaat, Reichskanzler, Kaiser Wilhelm II., Wilhelminismus, System umgangener Entscheidungen.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Besondere an der Verfassung des Deutschen Kaiserreichs?
Sie war ein „merkwürdiger Zwitter“ aus konservativen monarchischen Elementen und progressiven parlamentarischen Ansätzen, die Bismarck gezielt ausbalancierte.
Welche Rolle spielte Otto von Bismarck im Konstitutionalismus?
Bismarck instrumentalisierte die Verfassung, um die Vorherrschaft Preußens und den Fortbestand der Krone als zentrale politische Leitinstanz zu sichern.
Gab es im Wilhelminismus eine echte Parlamentarisierung?
Die Arbeit untersucht, ob die politische Eigendynamik trotz des „persönlichen Regiments“ Kaiser Wilhelms II. zu einer schleichenden Stärkung des Reichstags führte.
Wie war das Machtverhältnis zwischen Bundesrat und Reichstag?
Der Bundesrat war als Instrument preußischer Hegemonie geplant, während der Reichstag als geduldetes Parlament zwar Mitspracherechte hatte, aber oft umgangen wurde.
Warum nannte Mommsen das Kaiserreich ein „System umgangener Entscheidungen“?
Weil grundlegende Konflikte zwischen Volkssouveränität und monarchischem Prinzip nicht gelöst, sondern durch komplexe Verfassungskonstruktionen lediglich aufgeschoben wurden.
- Quote paper
- Julian Wangler (Author), 2008, Deutscher Konstitutionalismus 1871-1914 - Zwischen Autokratie und Parlamentarisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146798