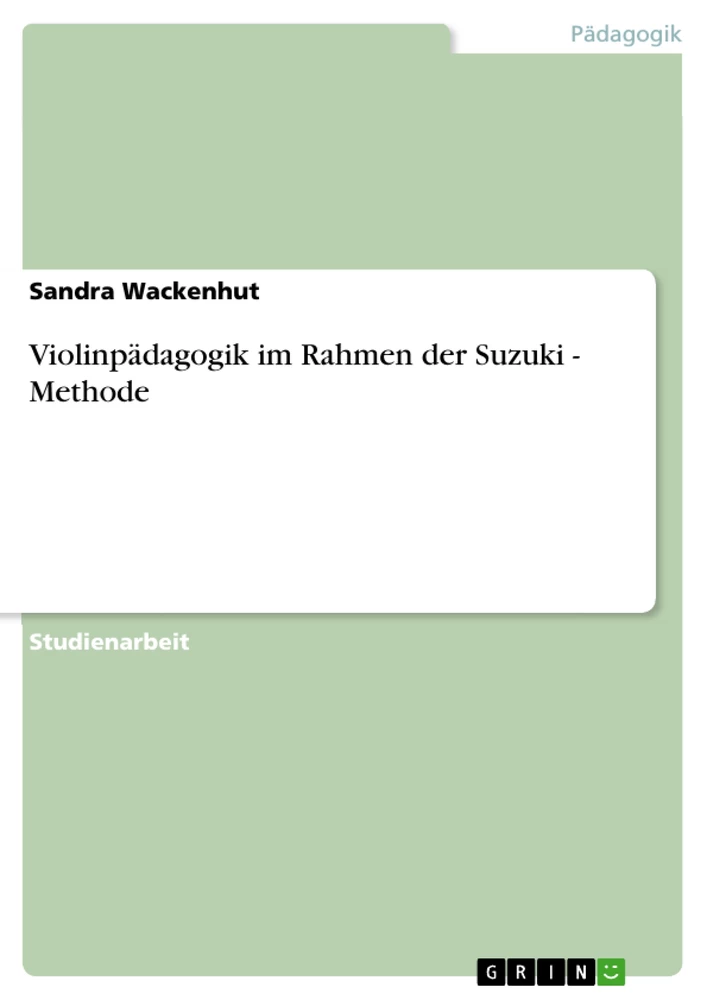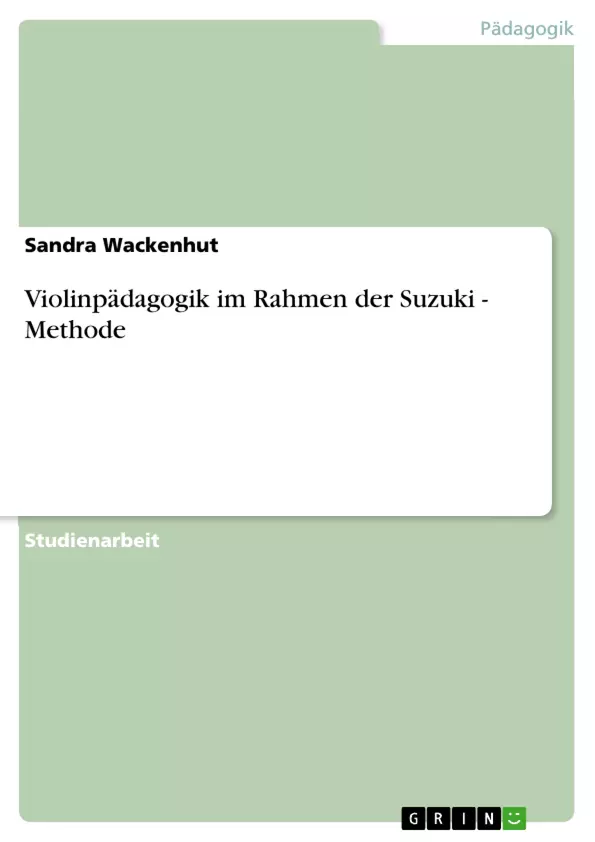Einleitung
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Vorstellung und Untersuchung der Suzuki-Methode Shinichi Suzukis, welche zunächst vom Erlernen des Violinspiels ausging, heute aber auch auf andere Instrumente übertragen bzw. erweitert wurde. Zuerst aber werde ich kurz auf die geschichtlichen Grundlagen der Violine eingehen.
Man kann sich natürlich fragen, warum Kinder ausgerechnet das Violinspiel erlernen sollen, wo es doch viele Instrumente gibt, die eventuell einfacher bzw. schneller zu erlernen sind. Eine berechtigte Frage, die zunächst gar nicht so leicht zu beantworten ist.
Aber ist es überhaupt nötig, Antworten dafür parat zu haben? Spielen Fragen nach besonderen Vorzügen, Wirkungen oder positiven Nebeneffekten eines Instruments bei der Instrumentenwahl überhaupt eine essentielle Rolle? Meiner Meinung nach wird bei der Wahl des Instruments selten im Voraus über Antworten auf die genannten Fragen reflektiert, sondern eher nach pragmatischen oder ästhetischen Gründen oder auch nach Popularität und Modernität der Instrumente vorgegangen.
Nach einer Untersuchung dieser Gründe wird deutlich, dass die Instrumentenwahl in seltenen Fällen nach einer systematische Beantwortung der Ausgangsfragen stattfindet. Trotzdem soll an dieser Stelle eine nach meinen Erfahrungen gemachte Besonderheit des Erlernens der Violine, welche selbstverständlich auch für andere Streichinstrumente gilt, die Violine jedoch von vielen anderen Instrumenten unterscheidet, hervorgehoben werden: Die Bildung und Schulung des musikalischen Gehörs.
Für die Produktion reiner, sauberer Töne ist neben der (Finger-)Technik ein feines musikalisches Gehör unentbehrlich. Natürlich wird es erst nach und nach erworben, so dass es mit den Jahren des Übens perfektioniert werden kann und auch auf andere musikalische Bereiche wie das Singen angewendet werden bzw. dort von hohem Nutzen sein kann. Es trägt sehr zur Perfektionierung der Intonation beim Singens und des Vom-Blatt-Singens bei. Das Violinspiel generell bietet viele Möglichkeiten des Zusammenspiels in den verschiedensten Orchestern und Ensembles, da es heutzutage in nahezu allen Musikgenres vertreten ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtliche Grundlagen der Violine
- Die Suzuki-Methode
- Entstehung
- Zur Person - Shinichi Suzuki
- Acht Grundprinzipien
- Besonderheiten und Zielsetzung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Suzuki-Methode, einem pädagogischen Konzept zur musikalischen Talenterziehung, das von Shinichi Suzuki entwickelt wurde. Die Arbeit untersucht die Entstehung und die Grundprinzipien der Methode, beleuchtet die Rolle des Zen-Buddhismus in Suzukis Philosophie und analysiert die Besonderheiten und Zielsetzungen der Suzuki-Methode im Vergleich zu anderen Instrumentalunterrichtsformen.
- Die Entstehung und Entwicklung der Suzuki-Methode
- Die acht Grundprinzipien der Suzuki-Methode
- Die Rolle des Zen-Buddhismus in der Suzuki-Methode
- Die Besonderheiten und Zielsetzungen der Suzuki-Methode
- Die Bedeutung der Suzuki-Methode für die musikalische Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Suzuki-Methode als ein innovatives Konzept zur musikalischen Talenterziehung vor. Sie beleuchtet die Frage nach der Instrumentenwahl und hebt die Besonderheit des Violinspiels in Bezug auf die Entwicklung des musikalischen Gehörs hervor.
Das Kapitel „Geschichtliche Grundlagen der Violine“ beleuchtet die Entwicklung der Violine als Instrument und ihre Bedeutung in der abendländischen Musikgeschichte. Es wird die Entstehung der Violine im 16. Jahrhundert in Oberitalien durch den Geigenbauer Amati beschrieben und die Rolle der Violine in verschiedenen Epochen der Musikgeschichte hervorgehoben.
Das Kapitel „Die Suzuki-Methode“ widmet sich der Vorstellung der Suzuki-Methode, ihrer Entstehung und den acht Grundprinzipien, die auf der „Muttersprachen-Methode“ basieren. Es wird die Biografie von Shinichi Suzuki beleuchtet und seine Motivation, die Suzuki-Methode zu entwickeln, erläutert. Die acht Grundprinzipien werden im Detail vorgestellt und ihre Bedeutung für die musikalische Entwicklung von Kindern erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Suzuki-Methode, Shinichi Suzuki, Talenterziehung, musikalische Bildung, Muttersprachen-Methode, Violinspiel, Zen-Buddhismus, Frühinstrumentalunterricht, Persönlichkeitsentwicklung, Charakterentwicklung, musikalisches Gehör, Intonation, Ensemble, Orchester, Musikgenres, Geschichte der Violine, Amati, Barock, Klassik, Romantik, Tasteninstrumente, Blasinstrumente, Spielmannsinstrument, Soloinstrument, Musikvideos, Werbung, Blockflöte, Notenlesen, Notenspiel, Wiederholung, Nachahmung, Selbstbewusstsein, Massenkonzerte, Repertoire, Auswendiglernen, Aufmerksamkeit, Vortragsfähigkeit, pränatale Phase, kindlicher Spracherwerb, sensomotorische Entwicklung, frühes Lernen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Suzuki-Methode?
Die Suzuki-Methode ist ein pädagogisches Konzept zur musikalischen Talenterziehung, das auf der "Muttersprachen-Methode" basiert. Kinder lernen Musik so natürlich wie ihre eigene Sprache durch Nachahmung und Wiederholung.
Wer war Shinichi Suzuki?
Shinichi Suzuki war ein japanischer Violinist und Pädagoge, der davon überzeugt war, dass jedes Kind musikalisches Talent entwickeln kann, wenn es in der richtigen Umgebung aufwächst.
Welche Rolle spielt das Gehör beim Erlernen der Violine nach Suzuki?
Ein feines musikalisches Gehör ist für die Produktion reiner Töne unentbehrlich. Die Methode schult das Gehör intensiv, was auch Vorteile für andere Bereiche wie das Singen und die Intonation hat.
Welchen Einfluss hat der Zen-Buddhismus auf die Suzuki-Methode?
Suzukis Philosophie ist stark vom Zen-Buddhismus geprägt, was sich in der Betonung von Charakterbildung, Geduld und der ganzheitlichen Entwicklung der Persönlichkeit widerspiegelt.
Ab welchem Alter kann mit der Suzuki-Methode begonnen werden?
Die Methode setzt bereits in der pränatalen Phase und im frühen Kindesalter an, da sie die sensomotorische Entwicklung und den natürlichen Spracherwerb nutzt.
- Quote paper
- Sandra Wackenhut (Author), 2008, Violinpädagogik im Rahmen der Suzuki - Methode, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146886