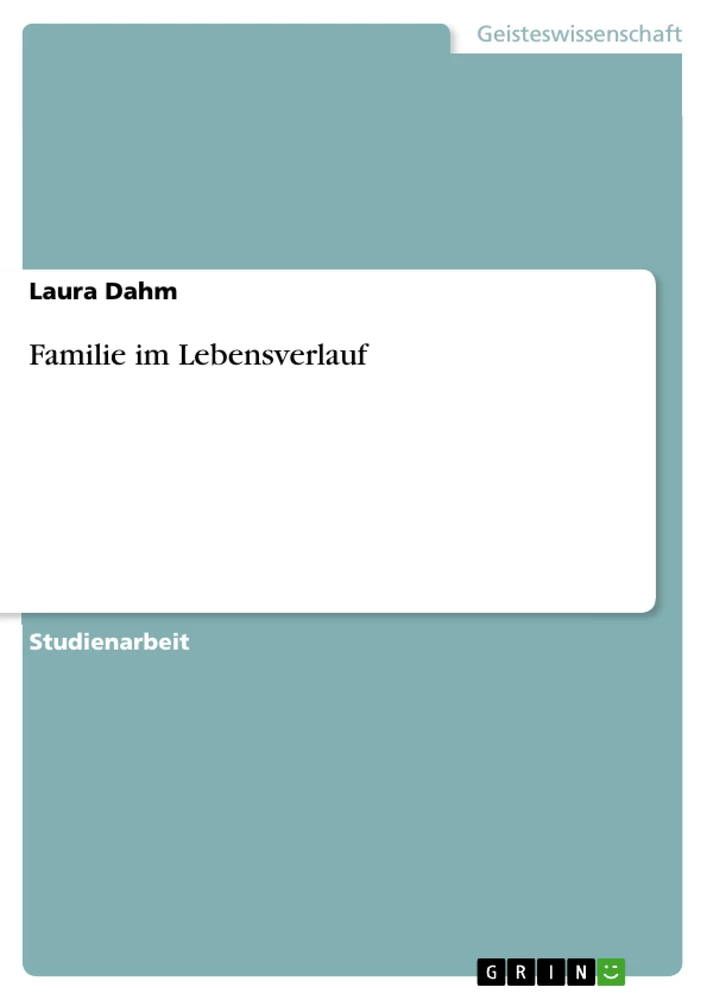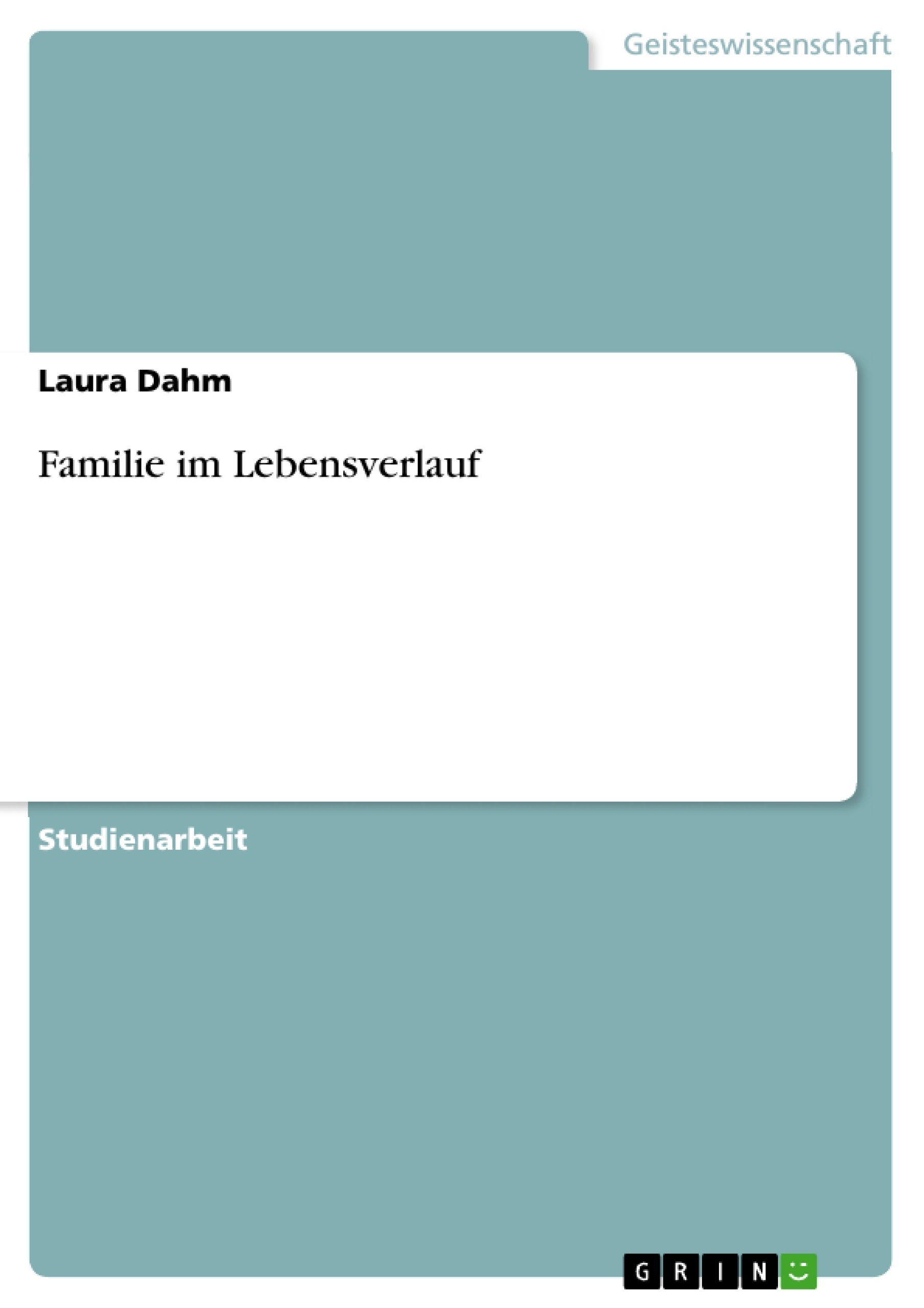Der Strukturwandel der Familie in der Moderne ist als Prozeß der Auslagerung von nichtfamilialen und der Spezialisierung der sich herausbildenden Familie als ein Teilsystem der Gesellschaft auf einen nur ihr eigenen Funktions- und Handlungskomplex zu betrachten. Dieser Wandel entstand durch Ereignisse innerhalb und außerhalb der Familie, und es gibt sozial und ethnisch bedingte Unterschiede in Familienbiographien (vgl. Aldous 1996, S. 20).
Im Verlauf der Industrialisierung trennte sich Arbeits- und Wohnstätte, und zuerst im wohlhabenden Bürgertum entwickelte sich die bürgerliche Familie als Vorläufermodell der modernen Familienform.
Um eine Argumentationsbasis für die empirische Auseinandersetzung zu finden, müssen die spezifischen Handlungsmotive im Zusammenhang mit der Entscheidung zum Eintritt in eine Partnerschaft und zur Gründung einer Familie beleuchtet werden (vgl. Huinink 1995, S. 13-26).
Der Lebensverlauf ist abhängig von den individuellen Ressourcen (Bildung, Elternhaus) und Restriktionen (Gesundheit), sowie gesellschaftlichen Institutionen (Schule, Rente), die den Lebensverlauf aufgrund des Alters strukturieren. Auch kumulierte biographische und historische Ereignisse (z.B. Krieg) spielen eine bedeutende Rolle. Aus diesen Faktoren ergibt sich dann das Alter bei einer Erstheirat und Erstgeburt. Der Lebensverlauf besteht außerdem aus verschiedenen ineinander verwobenen Lebensbereichen, die aufeinander abgestimmt werden müssen. In meinem Referat möchte ich nun darauf eingehen, inwieweit Ehe und Familie immer noch ihren Stellenwert im Lebensverlauf eines Individuums haben. Dazu betrachte ich die Übergänge zu Partnerschaft und Elternschaft im Lebensverlauf zunächst theoretisch und dann empirisch. Dabei unterteile ich in Lebensverlaufsstudien zur Gründung partnerschaftlicher Lebensgemeinschaften und Lebensverlaufsstudien zur Geburt des ersten und zweiten Kindes. Ich gehe insbesondere auf die Bildungsbeteiligung und ihre Auswirkungen auf Heirat und Familiengründung sowie auf die Zusammenhänge von Erwerbstätigkeit und Heirat bzw. Familiengründung ein.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Partnerschaft und Elternschaft im Lebensverlauf
- 1.1. Handeln im Lebensverlauf
- 1.2. Familienentwicklung im Lebensverlauf
- 1.2.1. Die partnerschaftliche Lebensgemeinschaft und die Eheschließung im Lebensverlauf
- 1.2.2. Die Familiengründung im Lebensverlauf
- 1.3. Methodische Bemerkungen zur Lebensverlaufsanalyse
- 2. Lebensverlaufsstudien zur Gründung partnerschaftlicher Lebensgemeinschaften
- 2.1. Ausbildungsbeteiligung und Heirat: Der Institutioneneffekt
- 2.2. Erwerbsbeteiligung und Heirat bei Männern und Frauen
- 2.3. Nichteheliches Zusammenleben
- 3. Lebensverlaufsstudien zur Geburt des ersten und zweiten Kindes
- 3.1. Bildungsbeteiligung und die Geburt des ersten Kindes: Der Institutioneneffekt
- 3.2. Die Erwerbstätigkeit und die Familiengründung bei Männern und Frauen
- 3.3. Die Entscheidungssituation beim zweiten Kind
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Stellenwert von Ehe und Familie im Lebensverlauf des Individuums. Die Hauptaugenmerke liegen auf den Übergängen zu Partnerschaft und Elternschaft, sowohl theoretisch als auch anhand empirischer Daten aus Lebensverlaufsstudien. Der Fokus liegt auf dem Einfluss von Bildungsbeteiligung und Erwerbstätigkeit auf die Entscheidungen bezüglich Heirat und Familiengründung.
- Der Wandel von Familie und Partnerschaft in der Moderne
- Der Einfluss von Bildung und Erwerbstätigkeit auf Heirat und Familiengründung
- Lebensverlaufsstudien als Methode zur Analyse von Partnerschafts- und Familienentscheidungen
- Die Bedeutung von individuellen Ressourcen und gesellschaftlichen Institutionen für den Lebensverlauf
- Die Rolle von Statusübergängen im Lebensverlauf
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Strukturwandel der Familie in der Moderne als Prozess der Auslagerung nichtfamilialer Funktionen und der Spezialisierung der Familie als Teilsystem der Gesellschaft. Sie beleuchtet den Einfluss der Industrialisierung und des Wirtschaftswunders auf die Entwicklung der modernen Familienform und die zunehmende Pluralisierung der Lebensformen in den letzten Jahrzehnten. Der Fokus liegt auf dem kritischen Wandel der Muster individueller Lebensgestaltung und den Veränderungen im Geschlechterverhältnis, mit Auswirkungen auf Partnerschaft, Familie und die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Die Arbeit begründet die Notwendigkeit, die Handlungsmotive im Zusammenhang mit Partnerschafts- und Familienentscheidungen zu beleuchten, um eine Argumentationsbasis für die empirische Auseinandersetzung zu schaffen. Schließlich wird die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit umrissen.
1. Partnerschaft und Elternschaft im Lebensverlauf: Dieses Kapitel betrachtet Partnerschaft und Familie als Instrumente zur Befriedigung elementarer menschlicher Bedürfnisse und als erstrebenswerte Ziele individueller Lebensgestaltung. Familienentwicklung wird als Teil des individuellen Lebensverlaufs dargestellt, wobei Entscheidungen von der jeweiligen Lebensphase abhängen. Es wird ein handlungstheoretischer Ansatz in der Lebensverlaufsforschung eingebettet, der die individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen für Entscheidungen bezüglich Partnerschaft und Familie erklärt. Die Bedeutung der Zeit und des chronologischen Alters in der Lebensverlaufsforschung wird hervorgehoben, ebenso wie die Verknüpfung theoretischer und empirischer Modellbildung. Der Begriff des Statusübergangs und die Bedeutung von Statuspassagen werden eingeführt, um individuelles Handeln im Kontext des Lebensverlaufs zu verstehen.
2. Lebensverlaufsstudien zur Gründung partnerschaftlicher Lebensgemeinschaften: Dieses Kapitel analysiert empirische Daten zu Lebensverlaufsstudien, die sich auf die Gründung partnerschaftlicher Lebensgemeinschaften konzentrieren. Es werden die Auswirkungen von Ausbildungsbeteiligung und Erwerbstätigkeit auf Heiratsentscheidungen bei Männern und Frauen untersucht. Der "Institutioneneffekt" wird diskutiert, der den Einfluss gesellschaftlicher Institutionen auf diese Entscheidungen beschreibt. Zusätzlich wird das nichteheliche Zusammenleben als alternative Lebensform beleuchtet.
3. Lebensverlaufsstudien zur Geburt des ersten und zweiten Kindes: Dieses Kapitel präsentiert empirische Ergebnisse von Lebensverlaufsstudien zur Geburt des ersten und zweiten Kindes. Es analysiert den Einfluss von Bildungsbeteiligung und Erwerbstätigkeit auf die Entscheidung zur Familiengründung bei Männern und Frauen. Der "Institutioneneffekt" wird im Kontext der Familiengründung erneut betrachtet. Die Entscheidungssituation beim zweiten Kind wird im Detail untersucht und die komplexen Faktoren, die diese Entscheidung beeinflussen, werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Lebensverlauf, Familie, Partnerschaft, Familiengründung, Heirat, Bildungsbeteiligung, Erwerbstätigkeit, Lebensverlaufsforschung, Institutioneneffekt, Geschlechterverhältnis, Statusübergang, individuelle Ressourcen, gesellschaftliche Institutionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Lebensverlaufsstudie zu Partnerschaft und Elternschaft
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Stellenwert von Ehe und Familie im Lebensverlauf des Individuums. Der Fokus liegt auf den Übergängen zu Partnerschaft und Elternschaft, dem Einfluss von Bildungsbeteiligung und Erwerbstätigkeit auf die Entscheidungen bezüglich Heirat und Familiengründung, und der Nutzung von Lebensverlaufsstudien als Methode zur Analyse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel von Familie und Partnerschaft, den Einfluss von Bildung und Erwerbstätigkeit auf Heirat und Familiengründung, Lebensverlaufsstudien als Methode, die Bedeutung individueller Ressourcen und gesellschaftlicher Institutionen, und die Rolle von Statusübergängen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Partnerschaft und Elternschaft im Lebensverlauf, ein Kapitel zu Lebensverlaufsstudien zur Gründung partnerschaftlicher Lebensgemeinschaften und ein Kapitel zu Lebensverlaufsstudien zur Geburt des ersten und zweiten Kindes.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt den Strukturwandel der Familie, den Einfluss der Industrialisierung und des Wirtschaftswunders, die zunehmende Pluralisierung der Lebensformen, den Wandel der individuellen Lebensgestaltung und Veränderungen im Geschlechterverhältnis. Sie formuliert die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit.
Worüber handelt Kapitel 1 (Partnerschaft und Elternschaft im Lebensverlauf)?
Kapitel 1 betrachtet Partnerschaft und Familie als Instrumente zur Bedürfnisbefriedigung und Ziele individueller Lebensgestaltung. Es verwendet einen handlungstheoretischen Ansatz, betont die Bedeutung von Zeit und Alter und führt den Begriff des Statusübergangs ein.
Worum geht es in Kapitel 2 (Lebensverlaufsstudien zur Gründung partnerschaftlicher Lebensgemeinschaften)?
Kapitel 2 analysiert empirische Daten zu Lebensverlaufsstudien über die Gründung partnerschaftlicher Lebensgemeinschaften. Es untersucht die Auswirkungen von Ausbildung und Erwerbstätigkeit auf Heiratsentscheidungen und diskutiert den "Institutioneneffekt" sowie nichteheliches Zusammenleben.
Was wird in Kapitel 3 (Lebensverlaufsstudien zur Geburt des ersten und zweiten Kindes) untersucht?
Kapitel 3 präsentiert empirische Ergebnisse zu Lebensverlaufsstudien über die Geburt des ersten und zweiten Kindes. Es analysiert den Einfluss von Bildung und Erwerbstätigkeit auf die Familiengründung und den "Institutioneneffekt" im Kontext der Familiengründung. Die Entscheidungssituation beim zweiten Kind wird detailliert untersucht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Lebensverlauf, Familie, Partnerschaft, Familiengründung, Heirat, Bildungsbeteiligung, Erwerbstätigkeit, Lebensverlaufsforschung, Institutioneneffekt, Geschlechterverhältnis, Statusübergang, individuelle Ressourcen, gesellschaftliche Institutionen.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet Lebensverlaufsstudien als empirische Methode zur Analyse von Partnerschafts- und Familienentscheidungen.
Welche zentralen Ergebnisse liefert die Studie?
Die zentralen Ergebnisse der Studie sind in den Kapiteln 2 und 3 zu finden und beziehen sich auf den Einfluss von Bildung, Erwerbstätigkeit und gesellschaftlichen Institutionen auf Entscheidungen bezüglich Partnerschaft und Familiengründung. Konkrete Ergebnisse sind im Text der Kapitelzusammenfassungen nachzulesen.
- Citar trabajo
- Laura Dahm (Autor), 1997, Familie im Lebensverlauf, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14692