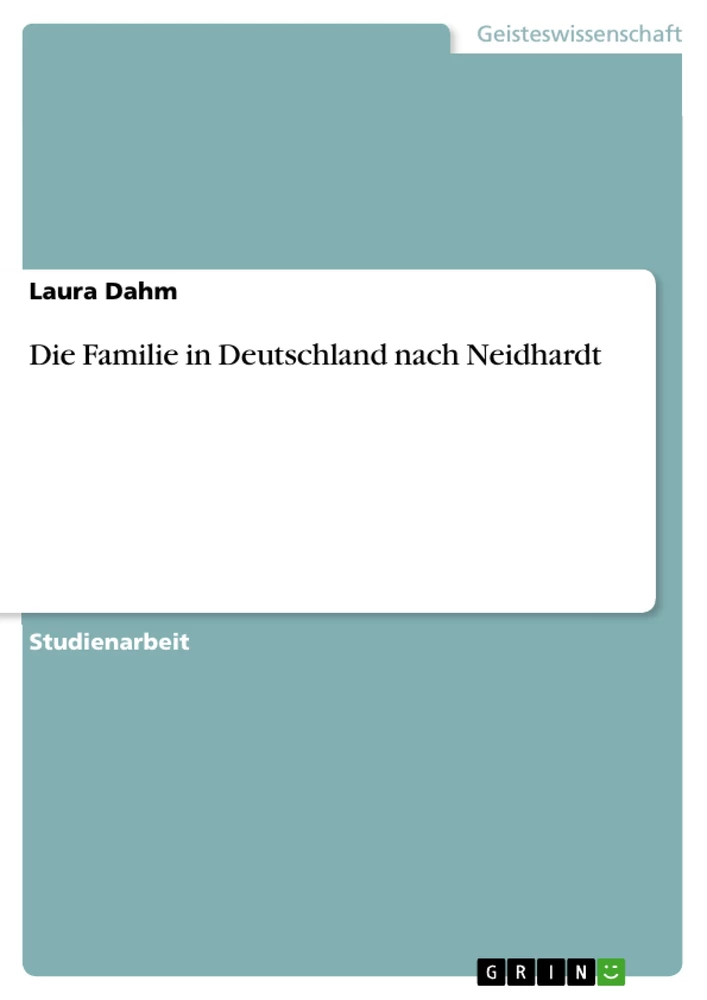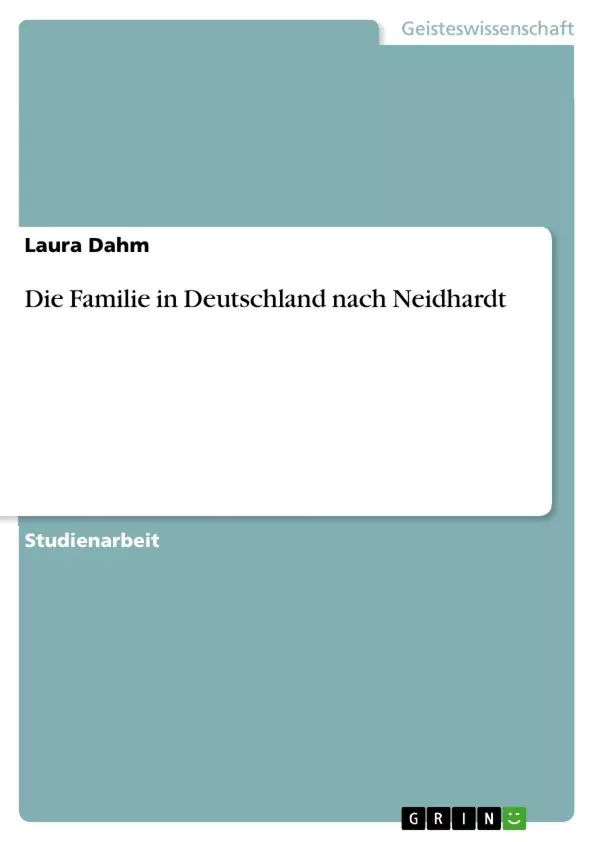Die Familie gilt als Inbegriff des Privaten, als ein sozialer Raum, in dem es sich auf sehr persönliche Weise leben läßt. Allerdings bleibt auch beim Gegenstand der Familie die Gesellschaft nicht draußen. Nur deshalb ist es schließlich auch möglich, Familiensoziologie zu betreiben, die versucht, „ die Macht des Gesellschaftlichen aufzuspüren“ (Neidhardt 1975a, S. 7). Es gilt nun zu zeigen, daß die gesellschaftlichen Zusammenhänge und Abhängigkeiten in den Raum der Familie hineinreichen. Zwar ist die Familie heute relativ privat, aber selbst diese Tatsache ist gesellschaftlich bedingt. So ist der einzelne in der Familie nicht frei von sozialen Normen und geregeltem Rollenspiel.
Erstens nehmen die Mitglieder der Familie soziale Positionen ein, die gesellschaftlich definiert sind und in einem bestimmten geregelten Zusammenhang stehen. Die Struktur, d.h. die Rechte und Pflichten der einzelnen Positionen, und wie sie gegeneinander abgegrenzt und aufeinander bezogen sind, stellen das System der Familie aus strukturanalytischer Sicht dar. Zweitens interessieren die Ursachen und Bedingungen verschiedener Familienstrukturen (Faktorenanalyse). Soziologisch bedeutsam sind die Einwirkungen der sozialen Umwelt. So verändert der gesellschaftliche Wandel auch die Stellung, Struktur und Leistung der Familie. Drittens stellt sich die Frage nach der Leistung der Familie für die Gesellschaft, also ihrer eigenen sozialen Wirkungen (Funktionsanalyse).
In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Familiensoziologie relativ früh etabliert, dennoch sind Umfang und Qualität der empirischen Sozialforschung noch nicht hinreichend ausgebildet. Auch die Familie selbst hat sich durch Industrialisierungs- und Demokatisierungsvorgänge und durch Kriegs- und Nachkriegswandlungen stark verändert. Die umfassendsten deutschen Familienuntersuchungen der 50er Jahre beschäftigen sich eben mit diesen Zuständen und Anpassungsvorgängen, die mittlerweile abgeschlossen sind. Heutige Tendenzen und Entwicklungen sind nur vereinzelt untersucht worden, so daß noch viel empirische Arbeit bzgl. innerfamilialer Beziehungen, Familienstörungen, Familienpolitik etc. zu tun ist.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Definition und Theorie der Familie
- 1.1. Ehe und Familie und ihre soziale Struktur
- 1.2. Verbreitung, Bedeutung und Institutionalisierung der Familie
- 1.3. Regeln der Partnerwahl und Familiengründung
- 1.4. Familie, Verwandtschaft und Gesellschaft
- 2. Problemfelder und Problembedingungen familialer Sozialisation
- 2.1. Grundleistungen der Familie im Sozialisationsprozess ihrer Kinder
- 2.2. Die gesellschaftliche Isolierung der Familie
- 2.3. Rollenprobleme der Mutter
- 2.4. Schichtungsprobleme familialer Sozialisation
- 2.4.1. Familieneffekte sozialer Ungleichheit
- 2.4.2. Probleme von Unterschichtenkindern
- 3. Fazit
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beleuchtet die Definition und Theorie der Familie sowie die Problemfelder und -bedingungen familialer Sozialisation. Ziel ist es, die Familie als Teil des Gesamtgesellschaftlichen Systems zu begreifen und ihre gesellschaftlichen Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu analysieren.
- Die Familie als Inbegriff des Privaten und ihr gesellschaftlicher Einfluss
- Die Definition und Veränderung der Familie im Wandel der Zeit
- Die soziale Struktur der Familie und die Bedeutung von Geschlechts- und Generationsmerkmalen
- Die Problemfelder der familialen Sozialisation, insbesondere die gesellschaftliche Isolierung und Schichtungsprobleme
- Die Bedeutung der Familie für die Gesellschaft und ihre Funktionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und unterstreicht die Relevanz der Familie als Forschungsgegenstand. Die Definition und Theorie der Familie wird im ersten Kapitel behandelt, wobei verschiedene Definitionen und das Konzept der Ehe als Grundlage der Familie beleuchtet werden. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Problemfeldern und -bedingungen familialer Sozialisation, wobei die Grundleistungen der Familie, ihre gesellschaftliche Isolierung, die Rollenprobleme der Mutter und die Schichtungsprobleme im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Familiensoziologie, Familie, Gesellschaft, Sozialisation, Ehe, Kernfamilie, Geschlechterrollen, Generationen, soziale Ungleichheit, Schichtung, Problemfelder, Funktionsanalyse, Strukturanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These von Neidhardt zur Familie?
Familie ist zwar ein privater Raum, aber dennoch stark von gesellschaftlichen Normen, Rollenspielen und sozialen Strukturen geprägt.
Welche Funktionen hat die Familie für die Gesellschaft?
Die Funktionsanalyse untersucht Leistungen wie die Sozialisation der Kinder, die emotionale Stabilisierung der Mitglieder und die Reproduktion der Gesellschaft.
Was sind Schichtungsprobleme familialer Sozialisation?
Die Arbeit beleuchtet, wie soziale Ungleichheit (z.B. Unterschichtzugehörigkeit) die Entwicklungschancen und Erziehungsmuster von Kindern beeinflusst.
Wie hat sich die Familie durch Industrialisierung verändert?
Es fand ein Wandel von der Großfamilie zur privatisierten Kernfamilie statt, verbunden mit veränderten Rollenbildern für Mütter und Väter.
Welche Rolle spielt die soziale Umwelt für die Familienstruktur?
Die Faktorenanalyse zeigt, dass gesellschaftlicher Wandel, Kriege und Nachkriegszeiten die Stabilität und Form der Familie massiv beeinflusst haben.
- Quote paper
- Laura Dahm (Author), 1997, Die Familie in Deutschland nach Neidhardt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14698