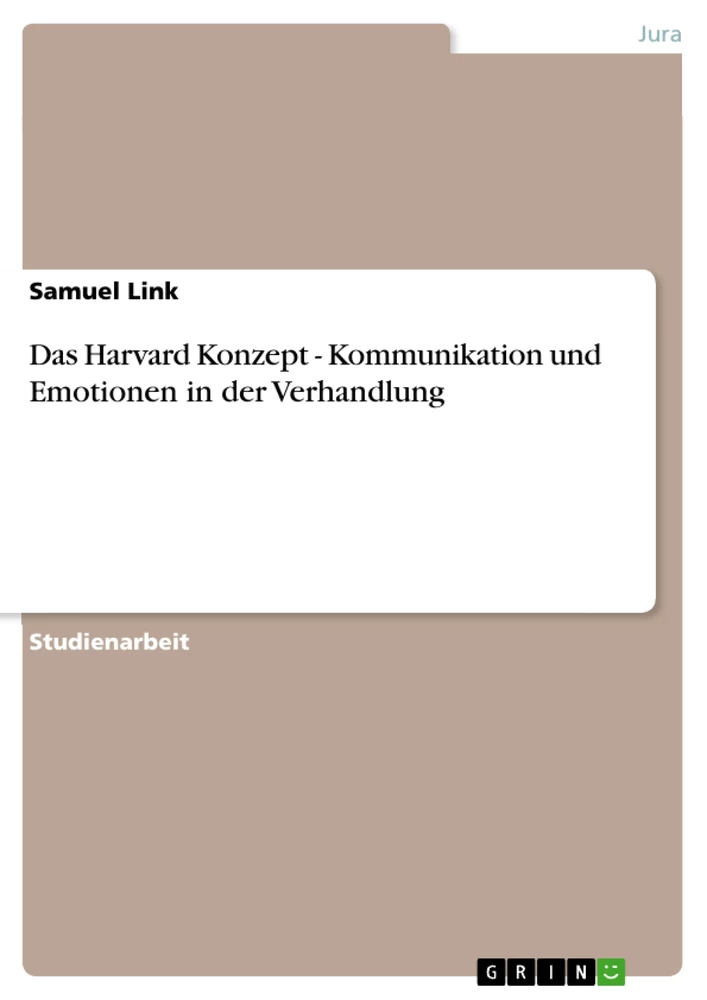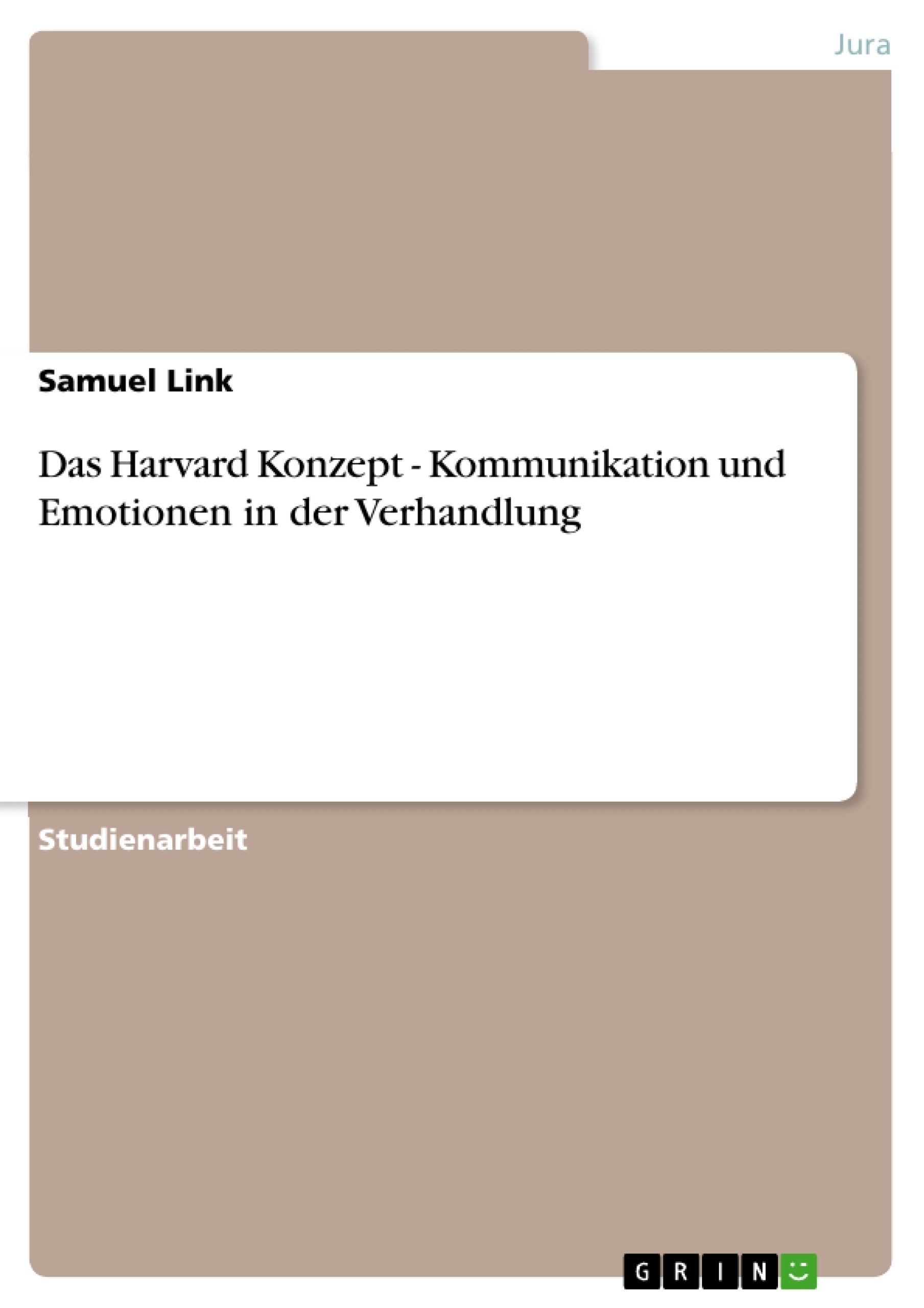Ziel dieser Arbeit ist es, die Methode des Harvard-Konzepts, unter Einbeziehung der 2005 erschienenen Erweiterung Beyond Reasons – Erfolgreicher verhandeln mit Gefühl und Verstand, darzustellen, die dahinterstehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, mit besonderem Augenmerk auf Psychologie und die Kommunikationsforschung, aufzuzeigen und die Methode kritisch zu hinterfragen.
Das Harvard-Konzept ist eine Verhandlungsmethode, die von Roger Fisher und William Ury an der Harvard Law School im Rahmen des Harvard Negotiation Project entwickelt wurde und durch das gleichnamige Buch weite Verbreitung erfahren hat. Bereits zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1981 war das Harvard-Konzept in zehn Sprachen erhältlich und wurde schon eine Viertelmillionen Mal verkauft. Auch in der heutigen Zeit ist es mit über 2 Millionen verkauften Exemplaren eines der erfolgreichsten Verhandlungsbücher aller Zeiten.
In § 779 BGB ist der Vergleich zweier Parteien als beiderseitiges Nachgeben definiert. Die Methode des Harvard-Konzepts verfolgt im Gegensatz dazu, getreu dem englischen Titel des Buches Getting to Yes: without giving in, das Ziel, neue Lösungsmöglichkeiten zu schaffen, die für beide Parteien vorteilhaft sind (Win-Win-Situation), so dass keine der Parteien nachgeben muss. Als Grundsatz dient dabei das sachbezogene Verhandeln (principled negotiation), um mit diesem, alle Anstrengungen der Parteien auf das Finden neuer Lösungen zu konzentrieren.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Die Verhandlung
- I. Intuitives Verhandeln
- II. Rationales Verhandeln
- C. Das Harvard-Konzept
- I. Menschen und Probleme getrennt voneinander behandeln
- 1. Die Kommunikation der Verhandlungspartner
- 2. Die Emotionen in einer Verhandlung
- II. Nicht Positionen, sondern Interessen in den Mittelpunkt stellen
- III. Vor der Entscheidung verschiedene Wahlmöglichkeiten zum beiderseitigen Vorteil entwickeln
- IV. Das Ergebnis auf objektiven Entscheidungsprinzipien aufbauen
- V. Best Alternative to Negotiated Agreement – BATNA
- D. Kritiken zum Harvard-Konzept
- E. Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Harvard-Verhandlungskonzept, einer Methode zur außergerichtlichen Streitbeilegung. Ziel ist die Darstellung des Konzepts, die Aufdeckung der zugrundeliegenden psychologischen und kommunikationswissenschaftlichen Erkenntnisse und eine kritische Auseinandersetzung mit der Methode. Die Arbeit bezieht dabei auch die Erweiterung "Beyond Reasons" mit ein.
- Das Harvard-Konzept als Verhandlungsmethode
- Kommunikation und Emotionsmanagement in Verhandlungen
- Die Rolle von Interessen und Positionen im Verhandlungsprozess
- Strategien zur Entwicklung beiderseitiger Vorteile
- Kritikpunkte und Grenzen des Harvard-Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung stellt das Harvard-Konzept als eine von Roger Fisher und William Ury entwickelte Verhandlungsmethode vor, die durch ihr gleichnamiges Buch große Verbreitung erlangt hat. Sie hebt das Ziel des Konzepts hervor, Win-Win-Situationen zu schaffen, ohne dass Parteien nachgeben müssen, im Gegensatz zum einfachen Vergleich nach § 779 BGB. Die Arbeit zielt darauf ab, das Konzept darzustellen, die zugrundeliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse aufzuzeigen und kritisch zu hinterfragen, unter Einbezug der Erweiterung "Beyond Reasons".
B. Die Verhandlung: Dieses Kapitel differenziert zwischen intuitivem und rationalem Verhandeln. Intuitives Verhandeln wird als die meistgebrauchte, aber oft ineffiziente Methode beschrieben, die auf unreflektierten Reaktionen und dem Feilschen um Positionen basiert. Es wird gezeigt, dass diese Methode zwar einfach ist, aber zu Macht- und Willenskämpfen, Konfliktverhärtungen und ineffektivem Zeitaufwand führen kann, sowie die Anwendung von Manipulationstechniken begünstigt. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Gegenüberstellung mit dem rationaleren Harvard-Konzept.
C. Das Harvard-Konzept: Dieses Kapitel erläutert die Kernprinzipien des Harvard-Konzepts. Der Fokus liegt auf der Trennung von Menschen und Problemen, wobei die Kommunikation der Verhandlungspartner und deren Emotionen im Detail analysiert werden. Die Bedeutung von aktivem Zuhören, Ich-Botschaften und der Berücksichtigung emotionaler Grundbedürfnisse wie Wertschätzung, Verbundenheit und Autonomie wird herausgestellt. Weiterhin wird die Wichtigkeit der Fokussierung auf Interessen anstatt Positionen sowie die Entwicklung verschiedener Lösungsoptionen und objektiver Entscheidungsprinzipien betont. Die Bedeutung der BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) wird ebenfalls erklärt.
D. Kritiken zum Harvard-Konzept: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Betrachtung des Harvard-Konzepts. Es werden Einwände bezüglich unsachgemäßer Generalisierung von Problemen, der Möglichkeit des Konzepts als Nullsummenspiel und der Berücksichtigung von Verhandlungsmacht diskutiert. Diese Kritikpunkte beleuchten die Grenzen und potenziellen Schwächen des Harvard-Konzepts in der Praxis.
Schlüsselwörter
Harvard-Konzept, Verhandlung, Kommunikation, Emotionen, Interessen, Positionen, Win-Win-Situation, aktives Zuhören, BATNA, Konfliktlösung, Verhandlungsstrategie, Psychologie, Kommunikationsforschung, kritische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Das Harvard-Verhandlungskonzept
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert das Harvard-Verhandlungskonzept, eine Methode zur außergerichtlichen Streitbeilegung. Sie beschreibt das Konzept, untersucht die zugrundeliegenden psychologischen und kommunikationswissenschaftlichen Prinzipien und bewertet kritisch seine Anwendbarkeit. Die Arbeit bezieht dabei auch die Erweiterung "Beyond Reasons" mit ein.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das Harvard-Konzept als Verhandlungsmethode; Kommunikation und Emotionsmanagement in Verhandlungen; die Rolle von Interessen und Positionen im Verhandlungsprozess; Strategien zur Entwicklung beiderseitiger Vorteile; und Kritikpunkte und Grenzen des Harvard-Konzepts.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über die Verhandlung (intuitiv vs. rational), eine ausführliche Darstellung des Harvard-Konzepts mit seinen Kernprinzipien, ein Kapitel mit Kritikpunkten am Harvard-Konzept und abschließend eine Stellungnahme. Jedes Kapitel wird in der vorliegenden Übersicht zusammengefasst.
Was sind die Kernprinzipien des Harvard-Konzepts?
Das Harvard-Konzept basiert auf vier Kernprinzipien: 1. Menschen und Probleme getrennt voneinander behandeln (inkl. Kommunikation und Emotionsmanagement); 2. Interessen statt Positionen in den Mittelpunkt stellen; 3. Vor der Entscheidung verschiedene Wahlmöglichkeiten zum beiderseitigen Vorteil entwickeln; und 4. Das Ergebnis auf objektiven Entscheidungsprinzipien aufbauen. Zusätzlich wird die Bedeutung der BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) hervorgehoben.
Wie unterscheidet sich intuitives von rationalem Verhandeln?
Intuitives Verhandeln ist die meistgebrauchte, aber oft ineffiziente Methode, die auf unreflektierten Reaktionen und dem Feilschen um Positionen basiert. Rationales Verhandeln, wie im Harvard-Konzept dargestellt, hingegen strebt nach Win-Win-Situationen durch Berücksichtigung von Interessen und konstruktiver Kommunikation.
Welche Kritikpunkte werden am Harvard-Konzept geäußert?
Die Kritikpunkte am Harvard-Konzept betreffen unter anderem die potenzielle Unsachgemäßheit bei der Generalisierung von Problemen, die Möglichkeit, dass das Konzept als Nullsummenspiel eingesetzt wird, und die unzureichende Berücksichtigung von Machtverhältnissen in Verhandlungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Harvard-Konzept, Verhandlung, Kommunikation, Emotionen, Interessen, Positionen, Win-Win-Situation, aktives Zuhören, BATNA, Konfliktlösung, Verhandlungsstrategie, Psychologie, Kommunikationsforschung, kritische Analyse.
Wo finde ich die Kapitelzusammenfassungen?
Die Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Einleitung, Die Verhandlung, Das Harvard-Konzept, Kritiken zum Harvard-Konzept) sind im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" dieser Übersicht enthalten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, das Harvard-Verhandlungskonzept darzustellen, die zugrundeliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse aufzuzeigen und das Konzept kritisch zu hinterfragen, unter Einbezug der Erweiterung "Beyond Reasons".
- Quote paper
- Samuel Link (Author), 2010, Das Harvard Konzept - Kommunikation und Emotionen in der Verhandlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147116