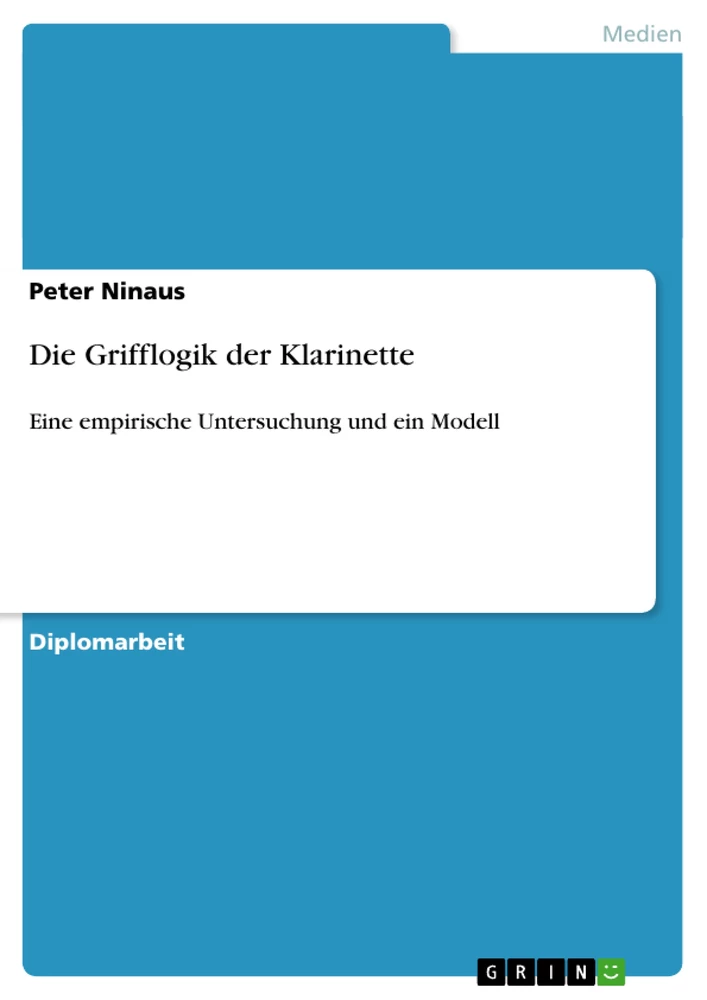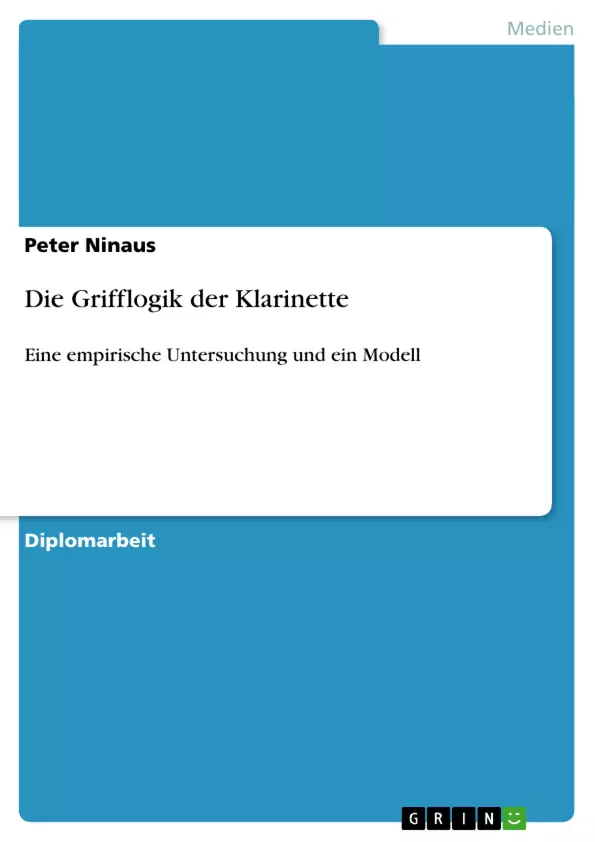Voruntersuchungen bei Klarinettenschülern ergaben einen Zusammenhang zwischen subjektiver Schwierigkeit und der Anzahl der in Verwendung befindlichen Finger bzw. der Veränderung und der daraus resultierenden Anzahl von Fingerbewegungen. Um diesen Umstand zu erklären, wurde eine Grifftabelle erstellt, die in 0-en für offen oder nicht gedrückt und in 1-en für geschlossen oder gedrückt umgeformt wurde (Konjunktoren). Mit dieser Tabelle war es möglich Griffbilder als Vektoren darzustellen und diese miteinander in ihrer Veränderung zu vergleichen. Über Vektor-Summen wurden die subjektiven Ergebnisse mit den errechneten Werten verglichen. Dieses Ergebnis ermöglicht es nun ein Vorhersage-Modell über optimale Grifffolgen für Musiker, Lehrer und Komponisten zu erstellen, ohne sich mit der Spielweise der Klarinette zu beschäftigen. Parallele Untersuchungen an Saxophonisten zeigen, dass dieses Modell auf andere Holzblasinstrumente anwendbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract (deutsch)
- Abstract (English)
- Danksagung
- Präambel
- 1. Einleitung und Definitionen
- 1.1 Wiener Klarinette
- 1.2 Entwicklung der Klarinetten
- 1.2.1 Geschichtliche Hintergründe
- 1.3 Grundsätze des Blasinstrumental-Spiels
- 1.4 Körper und Instrument als harmonische Einheit
- 1.5 Körperliche Voraussetzungen und Griffschwere
- 1.6 Haltung
- 1.7 Haltung im Stehen
- 1.8 Stärkung der Ausdauer
- 1.9 Drei Normen der aufrechten Haltung:
- 1.10 Mund- und Kieferbau (Ansatz) vs. Kontrollierte Finger-Koordination
- 1.11 Entwicklungsstand der Hände und Finger
- 1.12 Lotgerechte Haltung
- 1.13 Kindgerechte Instrumente
- 1.14 Der Begriff
- 1.15 Psychische Voraussetzungen des Instrumental-Unterrichts
- 1.16 Atmung, „Luft“
- 1.17 Fingergröße, Klappen- oder Lochgröße
- 1.18 Ausbildungsgrad, Alter, Reife
- 1.19 Blattlesefähigkeit
- 1.20 Körperlicher Entwicklungsstand, Muskulatur der Finger und Hände
- 2,1.21 Körpergröße / Instrumentengröße - Relation
- 2. Die Fragestellungen der Arbeit und ihre Relevanz
- 2.1 Ist der Schwierigkeitsgrad von Griffen und Grifffolgen berechenbar?
- 2.2 Der Beweis der subjektiven Griffschwere
- 2.3 Ist es möglich eine Vorhersage des Schwierigkeitsgrades eines Stückes zu machen und dabei die optimale Grifffolge zu berechnen?
- 2.4 Ist es möglich eine ästhetische Vorhersage des Spiels der Klarinette zu generieren?
- 2.5 Eine modellierte Klarinette kann ein Werkzeug für Komponisten oder auch für den Instrumentenbau sein.
- 3. Voruntersuchung 1: Explorativ
- 3.1 Frage 1: Methoden des Übens im Kopf. Welche Methoden gibt es und welche sind optimal?
- 3.2 Frage 2: Wie wird der Schweregrad eines Stückes festgestellt?
- 3.3 Voruntersuchung 2: Quantitativ, Qualitativ
- 3.4 These 1: Zusammenhang zwischen Schweregrad und Anzahl der verwendeten Finger
- 3.5 Voruntersuchung 3: Qualitativ
- 3.6 Hauptuntersuchung : Quantitative Untersuchung an Klarinettistinnen und Klarinettisten und an Saxophonistinnen und Saxophonisten. Auswertung der gewonnen Daten.
- 3.7 These 2: Zusammenhang zwischen Schweregrad und Fingerposition
- 3.8 These 3: Korrelation zwischen „Schwere-Akzeptanz“ und musikästhetischen Entscheidungen
- 3.9 Mögliche weitere Untersuchung: Einzelfallstudie, Stückanalyse
- 3.10 Fehler-Ursachen
- 3,4. Hauptuntersuchungen
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Methode
- 4.2.1 TeilnehmerInnen (Auswahl, Eigenschaften)
- 4.2.2 Versuchsplanung
- 4.2.3 Technische Mittel
- 4.2.4 Prozedere
- 4.2.5 Auswertung
- 4.3 Ergebnisse beider Befragungen
- 4.3.1 Ergebnisse: Klarinette
- 4.3.2 Ergebnisse: Saxophon
- 4.4 Diskussion
- 5. Beschreibung des Modells
- 5.1 Theorie
- 5.2 Mathematische Beschreibung
- 5.3 Vergleich zwischen Ergebnissen und Vorhersagen des Modells
- 5.4. Diskussion
- 6. Schluss
- 6.1 Versuchsplanung
- 6.2 Auswertungsmethoden (insb. Erklärung der angewendeten qualitativen Methoden)
- 6.3 methodenbezogene Ergebnisse
- 6.4. Generalisierbarkeit
- 6.5. Qualitative Analysen mit Zitaten, Kategorien
- 7. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
- 7.1 Erweiterung des Modells
- 8. Implikationen
- 8.1 Implikation für die Übetechnik
- 8.2 Implikation für Komposition und Verlagswesen
- 8.3 Implikation für Musikschulsysteme
- 9. Literatur (alphabetische Liste)
- 10. Anhang
- I. Voruntersuchung 1
- II. Voruntersuchung 2
- III. Der Vorversuch mit den Saxophonisten
- IV. Klarinettistinnen und Klarinettistenbefragung
- Die Zahlen
- V. Die Saxophonisten-Befragung
- Die Zahlen der Saxophon-Befragung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Grifflogik der Klarinette und verfolgt das Ziel, ein Modell zu entwickeln, das den Schwierigkeitsgrad von Griffen und Grifffolgen berechnen kann. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung, die Daten von Klarinettistinnen und Klarinettisten sowie Saxophonistinnen und Saxophonisten erhebt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen dazu beitragen, die Grifflogik der Klarinette besser zu verstehen und ein Werkzeug für Komponisten, Instrumentenbauer und Musiklehrer zu schaffen.
- Die subjektive Wahrnehmung von Griffschwierigkeiten
- Die Entwicklung eines Modells zur Berechnung des Schwierigkeitsgrades von Griffen und Grifffolgen
- Die Implikationen des Modells für die Übetechnik, Komposition und Musikschulsysteme
- Die Bedeutung der Körperhaltung und Fingerkoordination für das Klarinettenspiel
- Die Rolle der Musikästhetik bei der Bewertung von Grifffolgen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung definiert den Begriff der Grifflogik und stellt die Wiener Klarinette sowie die historische Entwicklung des Instruments vor. Sie beleuchtet die Grundsätze des Blasinstrumental-Spiels und die Bedeutung der Körperhaltung und Fingerkoordination. Die Fragestellungen der Arbeit werden formuliert und ihre Relevanz für die Musikwissenschaft, die Komposition und den Instrumentenbau erläutert.
Die Voruntersuchung analysiert verschiedene Methoden des Übens im Kopf und untersucht den Zusammenhang zwischen dem Schweregrad eines Stückes und der Anzahl der verwendeten Finger. Die Hauptuntersuchung präsentiert die Ergebnisse einer quantitativen Untersuchung an Klarinettistinnen und Klarinettisten sowie Saxophonistinnen und Saxophonisten. Die gewonnenen Daten werden ausgewertet und die Ergebnisse diskutiert.
Die Beschreibung des Modells erläutert die theoretischen Grundlagen und die mathematische Beschreibung des entwickelten Modells. Es wird ein Vergleich zwischen den Ergebnissen der Untersuchung und den Vorhersagen des Modells gezogen und die Ergebnisse diskutiert.
Der Schluss fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Implikationen des Modells für die Übetechnik, Komposition und Musikschulsysteme. Die Arbeit endet mit einem Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsarbeiten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Grifflogik der Klarinette, die subjektive Griffschwere, die Entwicklung eines Modells zur Berechnung des Schwierigkeitsgrades von Griffen und Grifffolgen, die empirische Untersuchung, die Körperhaltung, die Fingerkoordination, die Musikästhetik, die Implikationen für die Übetechnik, Komposition und Musikschulsysteme.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Grifflogik“ der Klarinette?
Die Grifflogik beschreibt den Zusammenhang zwischen der Fingerposition, der Anzahl der bewegten Finger und dem daraus resultierenden Schwierigkeitsgrad einer Grifffolge.
Kann man die Schwierigkeit eines Musikstücks berechnen?
Ja, die Arbeit stellt ein mathematisches Modell vor, das Griffe als Vektoren (0 für offen, 1 für geschlossen) darstellt und so optimale Grifffolgen und Schwierigkeitsgrade vorhersagbar macht.
Welche Rolle spielt die Körperhaltung beim Klarinettenspiel?
Eine lotgerechte, aufrechte Haltung ist essenziell für die harmonische Einheit von Körper und Instrument sowie für eine kontrollierte Finger-Koordination.
Gilt das Modell auch für andere Instrumente?
Parallele Untersuchungen zeigen, dass das für die Klarinette entwickelte Modell auch auf andere Holzblasinstrumente wie das Saxophon anwendbar ist.
Welchen Nutzen hat die Arbeit für Komponisten?
Komponisten können das Modell nutzen, um technisch spielbare Werke zu schreiben, ohne selbst die Spielweise der Klarinette im Detail beherrschen zu müssen.
- Quote paper
- Mag. phil. Bakk. art. Peter Ninaus (Author), 2008, Die Grifflogik der Klarinette, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147124