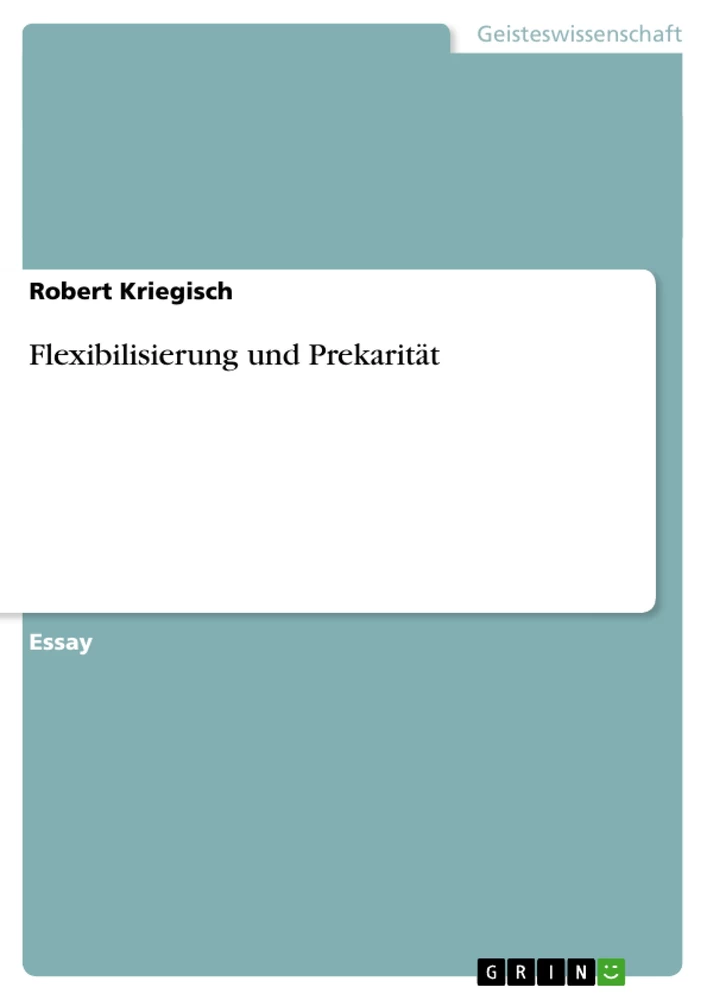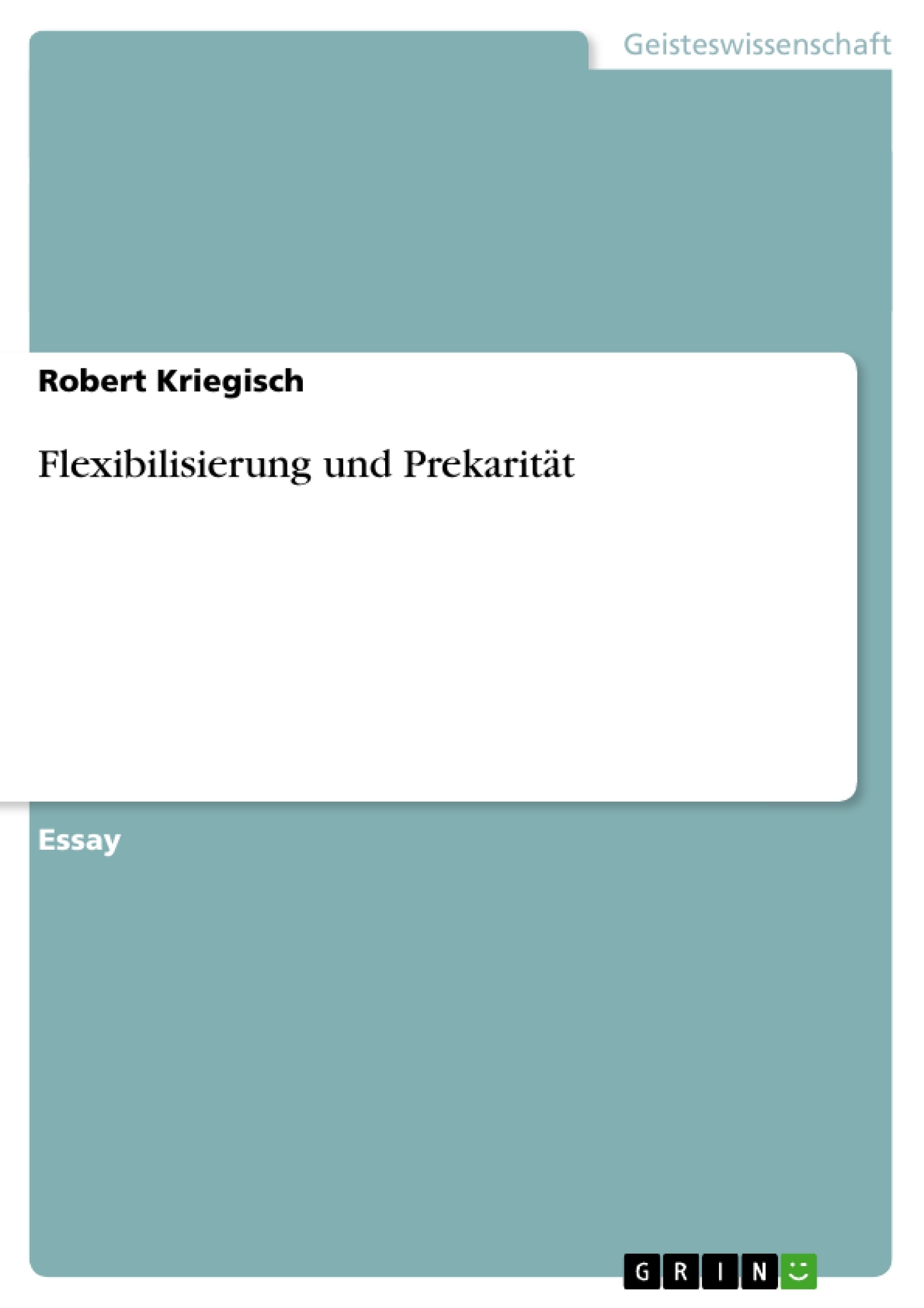Mit den Bundestagswahlen im September 2009 und der damit einhergehenden Koalitionsbildung zwischen der FDP und der CDU/CSU reagierten die Wähler auf die Bedrohung durch die aktuelle Wirtschaftskrise. Dies war eine klare Entscheidung für eine mehr marktliberale Politik, in der der Großteil der Bevölkerung einen Weg aus der Krise zu sehen glaubte, auch wenn dies bei der Betrachtung der Ursachen der Krise zunächst kontrovers erscheint. Dies kommt einer gesellschaftlichen Umbruchsituation gleich, in welcher, wie sich momentan abzuzeichnen scheint, der sozialstaatlich‐institutionelle Rahmen erschüttert und transformiert wird. In einer solchen Situation gewinnt laut Brinkmann et al. soziale Unsicherheit für große Bevölkerungsgruppen eine existenzielle Bedeutung. Da die dominante Position der gegenwärtigen arbeitsmarktpolitischen Diskussion die Überregulierung des deutschen Arbeitsmarktes als eine wesentliche Ursache steigender Arbeitslosigkeit sieht, lautet die Empfehlung, die verschiedenen Formen flexibler Arbeit auszuweiten. Dies gibt somit dem Wahlergebnis bei näherer Betrachtung mehr Sinn und deckt sich auch mit den marktliberalen Thesen der FDP, die immer mehr Autonomie für die deutsche Marktwirtschaft einfordert und somit eine steigende Liberalisierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes anstrebt, allerdings als Gegeneffekt auch eine Prekarisierung mit sich bringt. Um diese komplizierten Mechanismen begreifen zu können, muss allerdings erst möglichst genau abgegrenzt werden, was unter prekärer Beschäftigung überhaupt verstanden werden soll, auch wenn dies auf Grund der Weite des Begriffs nicht ganz einfach scheint. Des Weiteren soll darauf eingegangen werden, was die wesentlichen Gründe und Triebkräfte der Prekarisierung sind. Schlussendlich soll noch besonderes Augenmerk auf die selbständig Erwerbstätigen gerichtet werden, um zu klären, ob und inwiefern auch sie die zunehmende Prekarisierung betrifft.
Inhaltsverzeichnis
- Eine sehr politische Definition des Begriffs geht ursprünglich auf Pierre Bordieu zurück. So beschreibt er Prekarität als eine gesellschaftliche Tendenz zur Verallgemeinerung sozialer Unsicherheit, deren Ursprung im ökonomischen und Erwerbsystem der Gesellschaft zu verorten ist. Brinkmann et al. bezeichnen mit einer mehr wissenschaftlich-analytischen Intention ein Erwerbsverhältnis dagegen dann als prekär, wenn die Beschäftigten auf Grund ihrer Tätigkeit deutlich unter ein Einkommens-, Schutz- und soziales Integrationsniveau sinken, das in der Gegenwartgesellschaft als Standard definiert und mehrheitlich anerkannt wird. Janowitz beschreibt das Prekariat plakativer als die breite Grenzzone der Unsicherheit zwischen Gewinnern und Verlierern im „Neuen Kapitalismus“. Dies entspricht auch der Klassenbildung, die Dörre und Fuchs zur Abgrenzung des Prekariats vornehmen, wobei angemerkt werden muss, dass hier die Klassengrenzen stark verschwimmen und keineswegs unüberwindlich sind. Sie unterscheiden hier ferner zwischen der „Zone der Entkoppelten“, also den arbeitslosen ,,Abgehängten“ und den „Veränderungswilligen“ auf der untersten Ebene, der „Zone der Prekarität“ in der Mitte, der die „Hoffenden", die „Realistischen“ und die „Zufriedenen" angehören und auf der obersten Stufe die „Zone der Integration", die die in einem Normalarbeitsverhältnis angestellten „Gesicherten", ,,Unkonventionellen" ,,Selbstmanager“, aber auch die „Verunsicherten“ und die „Abstiegsbedrohten“ angehören. Genau hier spiegelt sich wieder, wie schwer es ist, eine trennscharfe Abgrenzung des Prekariats vorzunehmen. Brinkmann et al. würden wohl auch die zwei letzt genannten Gruppen noch zu den Prekariern zählen, da für sie Erwerbstätigkeit auch prekär ist, sobald sie subjektiv mit Sinnverlusten, Anerkennungsdefiziten und Planungsunsicherheit in einem Ausmaß verbunden ist, das gesellschaftliche Standards deutlich zu Ungunsten der Beschäftigten korrigiert. Ich werde im Folgenden den Begriff eines prekären Berufs allerdings nur im Zusammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen verwenden, die nicht dem traditionellen Standard entsprechen, d.h. die also keines der Merkmale Vollzeit, Tariflohn, Unbefristetheit und Kündigungsschutz erfüllen. Die Hauptgruppen dieser prekären Berufe sind laut dem Statistischen Bundesamt somit Leih- oder Zeitarbeiter, befristet oder geringfügig Beschäftigte, Teilzeitarbeiter und Niedriglohnbeschäftigte.
- Nun drängt sich die Frage auf, wie es überhaupt zu einem Anstieg des Anteils der Beschäftigtenzahlen in prekären Berufen um insgesamt 22% auf über 7,72 Mio. im Jahr 2008 laut Hans Böckler Stiftung kommen konnte und welche Kräfte diese Entwicklung so stark forciert haben. Wie bei Brinkmann et al. nachzulesen ist, müssen die Gründe für die fortschreitende Marktsteuerung und Prekarisierung der Erwerbsarbeit hauptsächlich in Ökonomie und Politik gesucht werden, da eine Flexibilisierung der Arbeit und somit die Umfunktionierung zur Ware, die frei gehandelt werden kann, die Funktionsbedingung für ein neokapitalistisches Modell im postfordistischen Sinne ist, welches bekanntermaßen die Steigerung der ökonomischen Dynamik zum Ziel hat. Im Sinne dieser Dynamik wurde dem Faktor Arbeit eine gewisse Liquidität geradezu aufgezwungen und Löhne, Arbeitszeiten und -bedingungen sind nun frei verhandelbar. Durch die daraus entstandene Konkurrenz unter den Arbeitnehmern wurden zwangsläufig auch die Beschäftigungsverhältnisse flexibilisiert und letztendlich prekarisiert. Auch die Hans-Böckler-Stiftung sieht die Deregulierung der Märkte als Triebkraft der Prekarisierung. Sie benennt ganz klar einige Liberalisierungstendenzen wie beispielsweise die Abschaffung des Synchronisationsverbotes, das Beschäftigungsförderungsgesetz, sowie das 2. Hartz-Gesetz und die Abschaffung der begrenzten Überlassungsdauer von Leiharbeitern, die zum Bedeutungsverlust der Normalarbeitsverhältnisse geführt haben. Diese Triebkräfte führen nun dazu, dass die marktgetriebene Flexibilisierung betrieblicher Arbeitsverhältnisse immer weniger durch eine robuste sozialstaatliche Regulationsweise abgefedert wird, was wiederum dazu führt, dass es zu einem immer stärkeren Verlust an Sicherheiten in den Betrieben und vor allem in der Gesellschaft selbst kommt. Die erhofften Beschäftigungseffekte bleiben derweil aus, da selbst in Zeiten hoher Konjunktur nicht etwa mehr Leute beschäftigt werden, sondern Produktionsspitzen mit flexiblen Arbeitszeiten, multifunktional einsetzbaren Arbeitskräften, befristet Beschäftigten oder Leih- und Zeitarbeitern abgefedert werden. Im Umkehrschluss merkt Janowitz hier noch an, dass prekär Beschäftigte die Ersten sind, denen in Krisenzeiten die Entlassung droht. Prekarisierung scheint somit die unerwartete Kehrseite der Flexibilisierung zu sein.
- Im Folgenden soll nun die Bedeutung der Prekarisierung für selbständig Berufstätige näher betrachtet werden. Wie allgemein bekannt ist, sind gerade Selbständige in besonderem Maße unsicheren Zukunftsperspektiven ausgesetzt. Der Wettbewerb ist oft sehr stark und gerade hohe Qualifikation und ein ausgeprägtes soziales und kulturelles Kapital gelten als Erfolgsfaktoren auf dem umkämpften Markt. Dem Begriff Selbständigkeit liegt aber auch immanenterweise keine Festanstellung zu Grunde. Die Flexibilisierung der Märkte ist hier also einerseits Basis, andererseits Herausforderung und oft auch zwangsläufiger Grund der eigenverantwortlichen Arbeit. Bei der Betrachtung dieser Selbständigen fällt also auf, dass die im Allgemeinen prekären Arbeitsverhältnisse im Einzelnen nicht unbedingt zwangsläufig schlecht sein müssen. Wie bei Janowitz nachzulesen ist, gibt es gerade im Milieu der „Neuen Selbständigen“ beispielsweise in den Medienberufen vielfach gut bezahlte Tätigkeiten, die allerdings unter prekären Umständen geleistet werden. Hier hat also die Flexibilisierung durchaus positiven Einfluss, auch wenn die Berufe immer noch von Unsicherheit geprägt sind, solange keine Etablierung auf dem Markt geschafft wurde. Dagegen ist die Existenz von Freiberuflern, Ich-AG's, Beratern und abhängigen Selbständigen oft weitaus unsicherer. Leiva schreibt zusätzlich, dass sich gerade Scheinselbständige in einer weitaus prekäreren Lage befinden. Obwohl sie de facto abhängig Beschäftigte sind, werden sie trotzdem als Selbständige betrachtet und haben somit die Pflichten und Aufgaben der abhängig Beschäftigten, ohne jedoch deren Rechte zu besitzen. Diese Gegenüberstellung zeigt, wie kontrovers dieser Diskurs ist und bringt uns zurück auf den von Brinkmann et al. ergänzten Punkt der subjektiven Unsicherheitsempfindung. Wird bei Dörre und Fuchs von einem Teil der Beschäftigten in einem Normalarbeitsverhältnis gesprochen, der sich ebenfalls unsicher fühlt aber trotzdem der „Zone der Integration" zugerechnet wird, wird dieser Teil bei Brinkmann et al. dem Prekariat zugerechnet, obwohl er nicht die Merkmale einer atypischen Beschäftigung aufweist. Dies bringt mich bei Betrachtung der Selbständigen folglich ebenfalls zu dem Umkehrschluss, dass die Berufsmerkmale diese zwar objektiv gesehen zu atypisch und somit prekär Beschäftigten machen, subjektiv betrachtet sieht sich aber wohl auch ein Teil der Selbständigen durchaus in keiner prekären Lage. Hier muss man meiner Meinung sogar noch weiter gehen und betonen, dass das Grundverständnis von Selbständigkeit ja gerade eben auf Nicht-Abhängigkeit, Flexibilität, liberalem Marktverständnis und in erster Linie auf Autonomie beruht. All dies wäre in einem Normalarbeitsverhältnis undenkbar.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit dem Thema der Flexibilisierung und Prekarität von Arbeit im Kontext der aktuellen Wirtschaftskrise und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Umbrüche. Der Autor analysiert die Ursachen und Folgen der Prekarisierung, insbesondere im Hinblick auf die Ausweitung flexibler Arbeitsformen und die Auswirkungen auf verschiedene Berufsgruppen, insbesondere Selbständige.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Prekarität“
- Ursachen und Triebkräfte der Prekarisierung
- Auswirkungen der Prekarisierung auf verschiedene Berufsgruppen
- Die Rolle der Flexibilisierung im Kontext der Prekarisierung
- Die Bedeutung der subjektiven Unsicherheitsempfindung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel des Essays befasst sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs „Prekarität“. Der Autor stellt verschiedene Definitionen und Perspektiven auf den Begriff vor, darunter die von Pierre Bordieu, Brinkmann et al. und Janowitz. Er diskutiert die Schwierigkeiten, eine klare Abgrenzung des Prekariats vorzunehmen, insbesondere im Hinblick auf die subjektive Unsicherheitsempfindung.
- Das zweite Kapitel analysiert die Ursachen und Triebkräfte der Prekarisierung. Der Autor argumentiert, dass die fortschreitende Marktsteuerung und die Flexibilisierung der Arbeit die Hauptgründe für die Prekarisierung sind. Er beleuchtet die Rolle der Politik und der Ökonomie in diesem Prozess und diskutiert die Auswirkungen der Deregulierung der Märkte auf die Arbeitsverhältnisse.
- Das dritte Kapitel untersucht die Bedeutung der Prekarisierung für selbständig Berufstätige. Der Autor stellt fest, dass Selbständige in besonderem Maße unsicheren Zukunftsperspektiven ausgesetzt sind, aber auch von der Flexibilisierung profitieren können. Er diskutiert die unterschiedlichen Erfahrungen von Selbständigen und die Herausforderungen, denen sie im Kontext der Prekarisierung gegenüberstehen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Flexibilisierung, Prekarität, Arbeitsmarkt, Wirtschaftskrise, Selbständigkeit, atypische Beschäftigung, soziale Unsicherheit, Neoliberalismus, Deregulierung, subjektive Unsicherheitsempfindung, gesellschaftliche Segregation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter prekärer Beschäftigung?
Ein Erwerbsverhältnis gilt als prekär, wenn es deutlich unter gesellschaftlich anerkannte Standards bezüglich Einkommen, Schutz und sozialer Integration sinkt (z. B. Leiharbeit, Befristung).
Was sind die Hauptursachen für die zunehmende Prekarisierung?
Die Hauptgründe liegen in der Marktsteuerung, der politischen Deregulierung (z. B. Hartz-Gesetze) und der erzwungenen Flexibilisierung der Arbeit als Ware.
Sind auch Selbstständige von Prekarität betroffen?
Ja, insbesondere Scheinselbstständige und "neue Selbstständige" in unsicheren Branchen erleben Prekarität, wobei hier oft die subjektive Wahrnehmung der Autonomie eine Rolle spielt.
Wie hängen Flexibilisierung und Prekarität zusammen?
Prekarisierung wird oft als die "unerwartete Kehrseite" der Flexibilisierung beschrieben, da der Verlust an Sicherheiten die ökonomische Dynamik erkauft.
Welche Rolle spielt die subjektive Unsicherheit?
Laut Brinkmann et al. ist Arbeit auch dann prekär, wenn sie subjektiv mit Sinnverlust, Anerkennungsdefiziten und Planungsunsicherheit verbunden ist.
- Quote paper
- Robert Kriegisch (Author), 2010, Flexibilisierung und Prekarität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147139