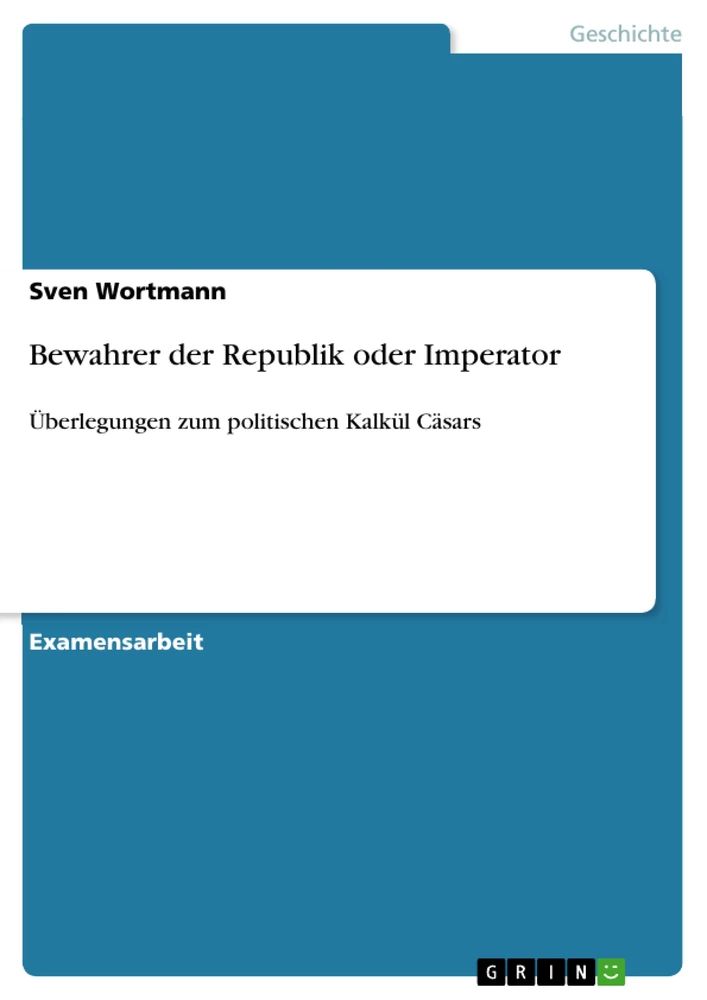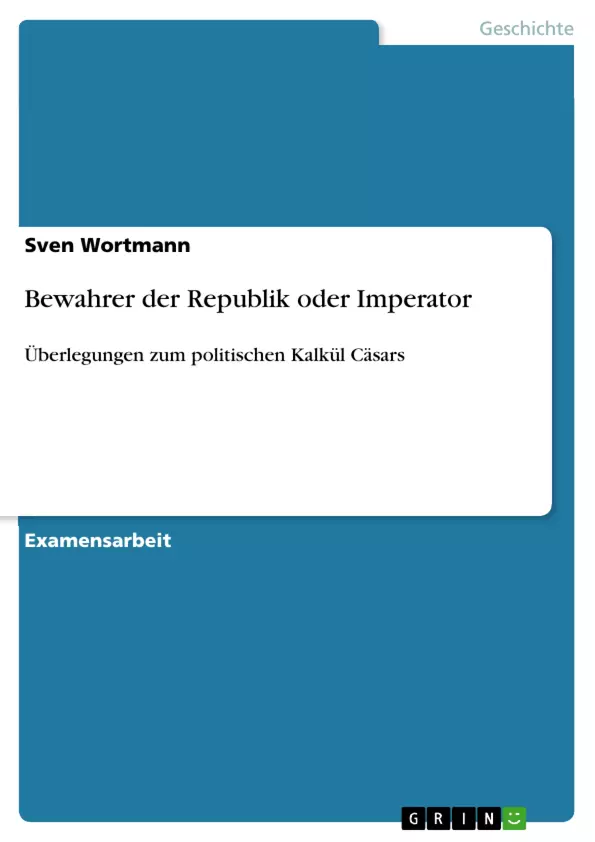Betrachtet man das weite Feld von antiken Feldherren und Herrschern, so entsteht schnell der Eindruck, Gaius Julius Caesar überstrahle alle. Sowohl zu Lebzeiten als auch in den vergangenen Jahrhunderten bis heute haben Gelehrte versucht, diese herausragende Persönlichkeit zu durchleuchten. Caesar, dieser geniale Feldherr, der im ersten vorchristlichen Jahrhundert das römische Volk und dessen Staat lenkte und leitete, zieht Wissenschaftler und Laien gleichermaßen in seinen Bann. Dabei stellt sich zu Beginn der Betrachtung die Frage, ob er nun von Anfang an Alleinherrscher sein wollte, oder einfach nur situationsbedingt entschieden hat. Hierzu haben sich in den vergangenen Jahren zwei wissenschaftliche Tendenzen manifestiert: Während vornehmlich ältere Wissenschaftler wie etwa Eduard Meyer, der festen Überzeugung sind, der Plan Caesars sei es gewesen, schlussendlich die res publica durch eine Tyrannis zu ersetzen, scheint seit einigen Jahren die neure Forschung indes eine andere Auffassung zu vertreten: Caesar habe sich mit der von ihm errichteten dictatura perpetua zufrieden gegeben, nicht zuletzt weil er damit die Befugnisse einer „de-facto-Monarchie“ innehatte, ohne sich der anrüchigen dominatio verdächtig zu machen. Da diese kurze Exkursion in die Caesar-Forschung nicht ausreicht, die Frage nach der politischen Motivation Cesars zu erklären und dies auch gar nicht soll, versucht die Arbeit anhand von historischen Quellen wie Plutarch, Sueton, Cicero, Appian und Ceasar selbst sowie den Caesarbiographien von Matthias Gelzer, Martin Jehne und Kurt Raaflaub, einen Einblick in die immer noch bestehende Diskussion um Caesars Motivation zu geben. Im Weiteren stützt sich diese Arbeit auf die Veröffentlichungen von Hermann Strasburger, Hinnerk Bruhn, Luciano Canfora sowie Astrid Kraaz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Caesar-Familie mit politischen Ansprüchen
- Der politische Aufstieg
- Aedil oder Tyrann?
- Pontifex Maximus
- Der Fall Catilina - Cicero gegen Caesar
- 59 v. Chr.: Entscheidung für das Volkswohl oder gegen die res publica
- Das Proconsulat
- Caeser in Gallien - Blick auf Rom
- Die Krise von 50/49 v. Chr. - Caeser gegen den Senat
- Politische Verwirrungen in Rom – Bürgerkrieg, Afrika-Feldzug und Ideale
- Die Dictatur und ihre Folgen
- Die Iden des März – Hintergründe, Tatsachen und Mutmaßungen
- Ausblick auf Augustus „Erbe"
- Resümee
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der politischen Motivation Gaius Julius Caesars und untersucht, ob er von Anfang an die Alleinherrschaft anstrebte oder ob seine Entscheidungen situationsbedingt getroffen wurden. Die Arbeit analysiert Caesars politische Karriere und seine Handlungen im Kontext der römischen Republik, um seine Motivationen und Ziele zu beleuchten.
- Caesars Aufstieg in der römischen Politik
- Caesars Rolle im Fall Catilina
- Caesars Entscheidung für das Volkswohl oder gegen die res publica
- Caesars Feldzüge in Gallien und die Auswirkungen auf Rom
- Caesars Dictatur und ihre Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und beleuchtet die unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven auf Caesars politische Motivation. Sie führt in die historische und wissenschaftliche Debatte um Caesars Rolle in der römischen Republik ein.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Caesars Familie und deren politischem Einfluss. Es beleuchtet die familiäre Herkunft Caesars und die Rolle seiner Familie in der römischen Gesellschaft.
Das dritte Kapitel beschreibt Caesars politischen Aufstieg und seine frühen Erfolge. Es analysiert seine politischen Strategien und seine Beziehungen zu wichtigen Persönlichkeiten der römischen Republik.
Das vierte Kapitel untersucht Caesars Amtszeit als Aedil und die damit verbundenen Herausforderungen. Es beleuchtet seine politische Positionierung und seine Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit Caesars Ernennung zum Pontifex Maximus und den damit verbundenen Aufgaben und Pflichten. Es analysiert die Bedeutung dieses Amtes für Caesars politische Karriere.
Das sechste Kapitel beleuchtet den Fall Catilina und Caesars Rolle in diesem politischen Skandal. Es analysiert die Beziehung zwischen Caesar und Cicero und die Auswirkungen des Skandals auf Caesars politische Karriere.
Das siebte Kapitel befasst sich mit Caesars Entscheidung für das Volkswohl oder gegen die res publica im Jahr 59 v. Chr. Es analysiert seine politischen Entscheidungen und die Auswirkungen auf die römische Republik.
Das achte Kapitel beschreibt Caesars Proconsulat und seine Feldzüge in Gallien. Es beleuchtet seine militärischen Erfolge und die Auswirkungen auf die römische Gesellschaft.
Das neunte Kapitel analysiert Caesars Feldzüge in Gallien und deren Auswirkungen auf die politische Situation in Rom. Es beleuchtet die Spannungen zwischen Caesar und dem Senat.
Das zehnte Kapitel befasst sich mit der Krise von 50/49 v. Chr. und Caesars Konflikt mit dem Senat. Es analysiert die Ursachen des Konflikts und die politischen Entscheidungen Caesars.
Das elfte Kapitel beschreibt die politischen Verwirrungen in Rom während des Bürgerkriegs und Caesars Feldzug in Afrika. Es beleuchtet die politischen und militärischen Ereignisse dieser Zeit.
Das zwölfte Kapitel analysiert Caesars Dictatur und ihre Folgen. Es beleuchtet die Auswirkungen der Dictatur auf die römische Republik und die politische Landschaft.
Das dreizehnte Kapitel befasst sich mit den Hintergründen, Tatsachen und Mutmaßungen rund um die Ermordung Caesars. Es analysiert die Ereignisse des 15. März 44 v. Chr. und die politischen Folgen.
Das vierzehnte Kapitel beleuchtet den Ausblick auf Augustus „Erbe" und die Auswirkungen von Caesars Herrschaft auf die römische Geschichte. Es analysiert die politische und gesellschaftliche Entwicklung nach Caesars Tod.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Gaius Julius Caesar, politische Motivation, römische Republik, Dictatur, Bürgerkrieg, Feldzüge, politische Entscheidungen, Macht, Einfluss, Senat, Volk, res publica, Tyrannis, historische Quellen, Plutarch, Sueton, Cicero, Appian, Caesarbiographien, Matthias Gelzer, Martin Jehne, Kurt Raaflaub, Hermann Strasburger, Hinnerk Bruhn, Luciano Canfora, Astrid Kraaz.
Häufig gestellte Fragen
Wollte Julius Caesar von Anfang an Alleinherrscher werden?
Dies ist eine zentrale Debatte der Forschung. Ältere Historiker glauben an einen langfristigen Plan zur Tyrannis, während neuere Forschung oft situationsbedingte Entscheidungen sieht.
Was bedeutet „dictatura perpetua“?
Es bezeichnet die Diktatur auf Lebenszeit, die Caesar kurz vor seinem Tod innehatte und die faktisch das Ende der traditionellen römischen Republik bedeutete.
Welche Rolle spielte der Fall Catilina für Caesars Aufstieg?
In diesem Skandal positionierte sich Caesar gegen Cicero, was seine politische Ambition und seine Nähe zum Volk (Popularen) deutlich machte.
Warum wurde Caesar an den Iden des März ermordet?
Verschwörer im Senat fürchteten die endgültige Zerstörung der res publica und die Errichtung einer absoluten Monarchie durch Caesar.
Was war der Unterschied zwischen „dominatio“ und Caesars Herrschaft?
Dominatio galt als verpönte Gewaltherrschaft. Caesar versuchte, seine Macht durch Ämter wie die Diktatur zu legitimieren, um den Anschein der Legalität zu wahren.
Welche antiken Quellen sind für die Caesar-Forschung wichtig?
Wichtige Quellen sind die Schriften von Plutarch, Sueton, Cicero, Appian und Caesars eigene Kommentare (z.B. zum Gallischen Krieg).
- Citar trabajo
- Sven Wortmann (Autor), 2009, Bewahrer der Republik oder Imperator, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147177