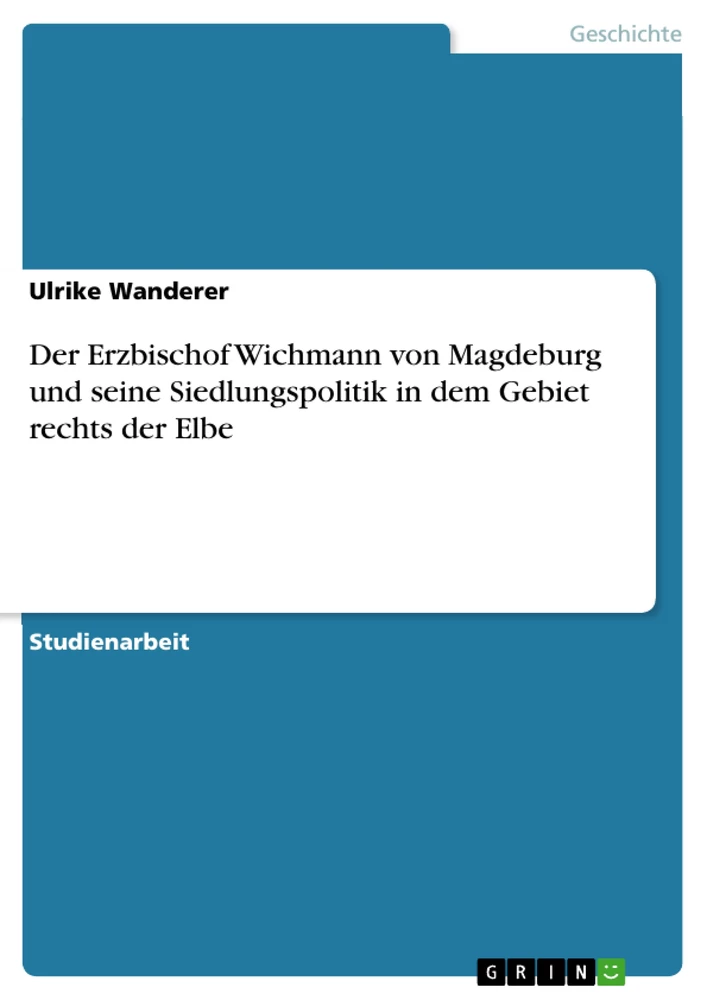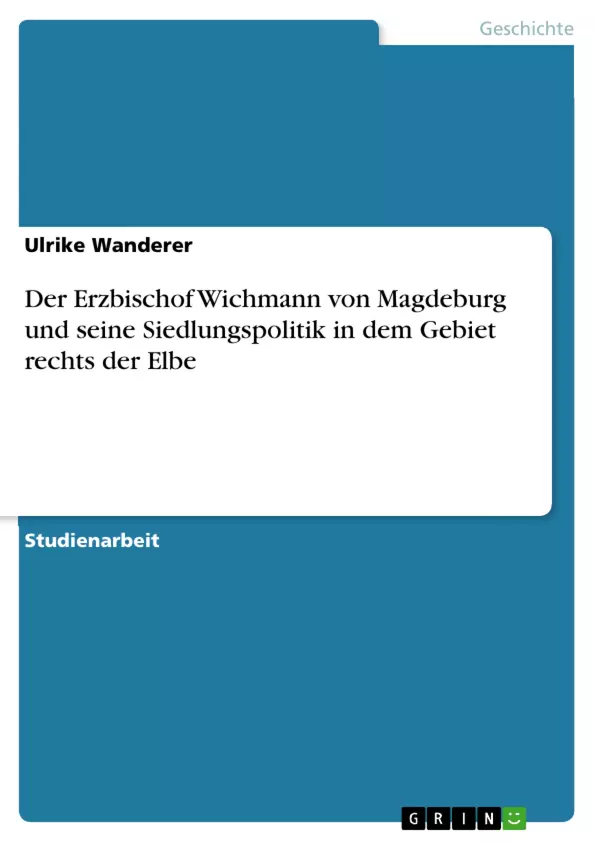Seit dem 11.Jahrhundert kam es in Mitteleuropa zu einer entscheidenden Veränderung der bestehenden Verhältnisse. Die Steigerung der Produktivität, die Trennung der gewerblichen von der agrarischen Produktion, der Bevölkerungszuwachs und die zunehmende Geld-Ware-Wirtschaft förderten einerseits die vermehrte Entstehung und Entwicklung von Städten und dem "städtischen Bürgertum", andererseits eine teilweise Modifizierung der Herrschafts- und Hörigkeitsverhältnisse ("Stadtluft macht frei") und der damit verbundenen Mobilität von Teilen der Bevölkerung. Im Zuge der einsetzenden Ostexpansion ergab sich vor allem für die unteren Gesellschaftsschichten die Möglichkeit, ihre rechtliche und wirtschaftliche Situation zu verbessern. Zudem kam es, bedingt durch andauernde Streitigkeiten der Deutschen Könige mit dem Papsttum und dem Fehlen einer starken königlichen Zentralgewalt im Deutschen Reich, zum Erstarken der regionalen Fürstengewalten, die nun immer mehr versuchten, sich der Königsgewalt gegenüber zu behaupten. Die Ostexpansion, welche Sache der einzelnen Landesherren war, bot ihnen die Möglichkeit, ihr Einflussgebiet zu vergrößern. Ihre Überlegenheit gegenüber den slawischen Nachbarn begünstigte diese Entwicklung. Östlich der Elbe und Saale waren an diesem Prozess vor allem die Askanier, Welfen und Wettiner als weltliche Fürsten, aber auch geistliche Landherren, wie die Erzbischöfe von Magdeburg, beteiligt. Einer der letztgenannten, der Erzbischof Wichmann von Magdeburg und seine Expansions- und Siedlungspolitik soll in dieser Arbeit näher beschrieben werden. Obwohl Wichmann auch eine bedeutende Rolle in der Reichspolitik gespielt hat, wird dieses weitgehend unbeachtet bleiben, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Das Bistum Magdeburg, ursprünglich als Missionserzbistum für die slawischen Gebiete östlich der Elbe und Saale gegründet, hatte schon seit Otto dem Großen eine ranghohe Grenzposition inne.
In dieser Arbeit soll die Art und Weise der Expansions- und Siedlungspolitik Wichmanns, teilweise auch im Zusammenhang mit der seiner unmittelbaren Nachbarn, den Askaniern und den Wettinern, dargestellt werden. Außerdem wird versucht, anhand der vorliegenden Quellen und Literatur den Umfang seines Vorstoßes zu rekonstruieren.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Zur Person Wichmann von Magdeburg
- Die Siedlungspolitik des Wichmann von Magdeburg
- Die Besiedlung des Land Jüterbog
- Der östliche Siedlungsvorstoß bis zum Land Dahme
- Der nordöstliche Siedlungsvorstoß bis auf den Barnim
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Expansions- und Siedlungspolitik des Erzbischofs Wichmann von Magdeburg im Gebiet rechts der Elbe. Sie analysiert seine Rolle bei der Ausdehnung des Erzbistums Magdeburg nach Osten und beleuchtet seine Methoden zur Förderung der Besiedlung neuer Gebiete.
- Wichmanns Person und seine frühen Jahre
- Die Rolle Wichmanns als Kolonisator und seine Strategien
- Die Gebiete, die Wichmann in seine Herrschaft einband
- Wichmanns Beziehungen zu den Askaniern und Wettinern
- Wichmanns Bedeutung für die Entwicklung der Kirchenprovinz Magdeburg
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort stellt den historischen Kontext der Ostexpansion und die Bedeutung von Wichmann für die Entwicklung der Kirchenprovinz Magdeburg dar.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit der Person Wichmanns, seinem Lebensweg und seinen frühen Jahren.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die Siedlungspolitik des Wichmann von Magdeburg, insbesondere die Besiedlung des Land Jüterbog, der östliche Siedlungsvorstoß bis zum Land Dahme und der nordöstliche Siedlungsvorstoß bis auf den Barnim.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Ostexpansion, Siedlungspolitik, Kolonisator, Erzbischof Wichmann von Magdeburg, Land Jüterbog, Askanier, Wettiner, Bistum Magdeburg, Kirchenprovinz, und die Einbindung neuer Gebiete in die Herrschaft des Erzbistums.
- Arbeit zitieren
- Ulrike Wanderer (Autor:in), 2004, Der Erzbischof Wichmann von Magdeburg und seine Siedlungspolitik in dem Gebiet rechts der Elbe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147205