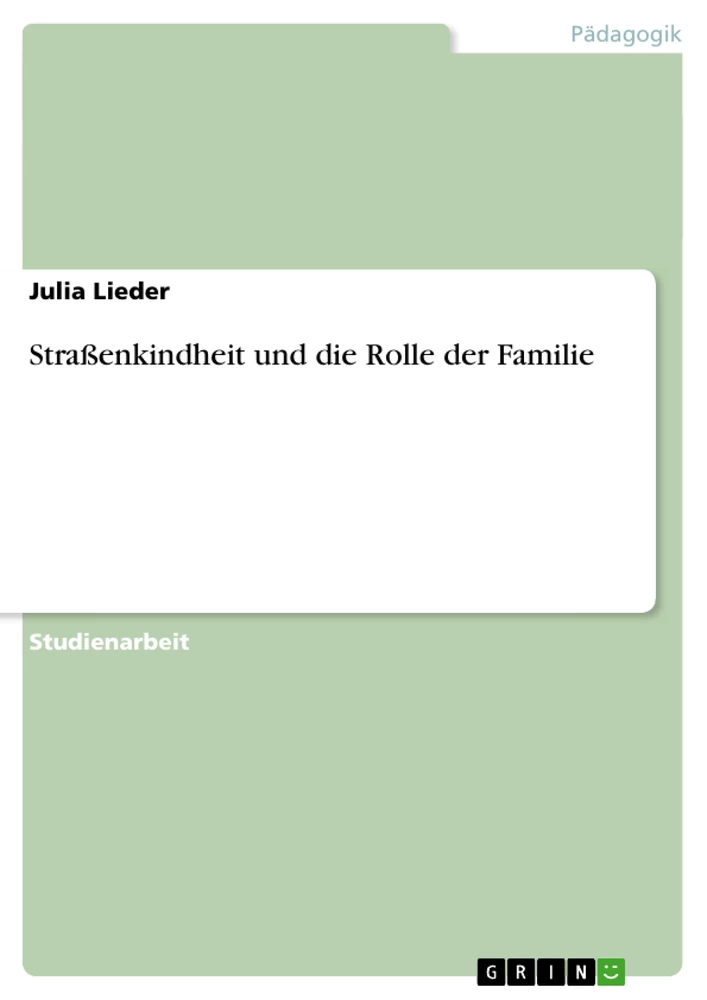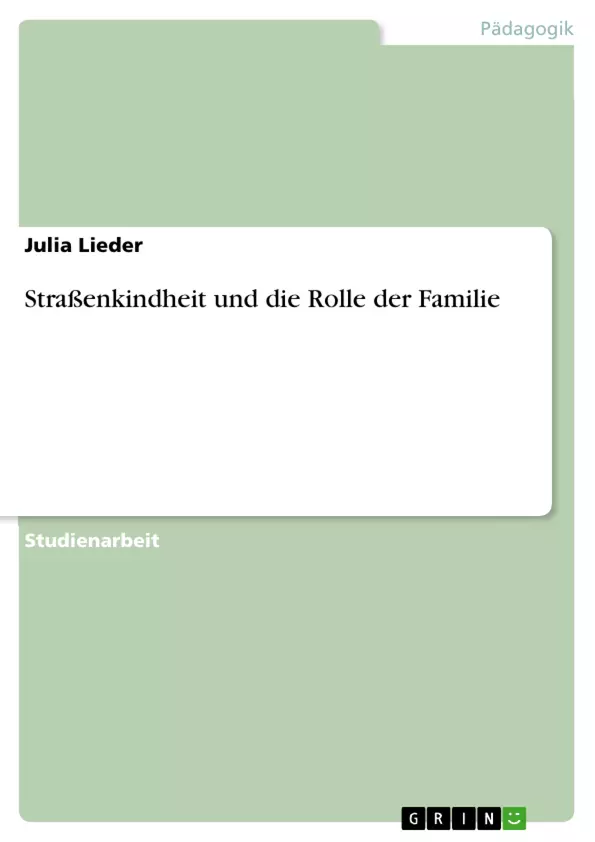Über Kinder und Kindheit wird in diesen Tagen viel und auch kontrovers diskutiert, vor allem darüber, was sich ändern muss, um das Aufwachsen von Kindern besser zu gestalten.
Ein wichtiger Grund für dieses Interesse ist, dass „die Kindheit“ in unserer Gesellschaft offensichtlich Veränderungen und Einschränkungen unterliegt, die die Altersphase unter Umständen zu einer großen Risikophase werden lässt.
Heute und in Zukunft entsteht immer mehr eine Kindheit, in der Kinder so viele Chancen haben, wie keine Generation vor ihnen. Gleichzeitig wächst die Gefahr Opfer von Veränderungen zu werden, die sie weder beeinflussen noch alleine bewältigen können. Unter diesem Gesichtspunkt rückt die Erziehung und der Einfluss der Eltern in den Mittelpunkt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Phänomen Straßenkindheit in Deutschland
- Definition
- Soziographie
- Risikokonstellationen
- Risikofaktor Familie als Ursache für „Straßenkindheit“
- Risikophase Jugend
- Beziehungsarmut in Familien
- Pluralität familiärer Lebensgemeinschaften
- Besondere Problemlagen in Stieffamilien
- Besondere Problemlagen alleinerziehender Elternteile
- Sexueller Missbrauch, Gewalterfahrung und Suchtverhalten in der Familie
- Ausstoßungsprozesse und Anziehungseffekte
- Zwischenfazit
- Ein systemischer Erklärungsansatz
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Straßenkindheit in Deutschland, insbesondere mit der Rolle der Familie als Risikofaktor. Sie untersucht die Ursachen und Folgen von Kinderflucht aus dem familiären Umfeld und beleuchtet die Bedeutung der Familie in der Orientierungsphase der Jugend. Die Arbeit strebt danach, ein systemisches Verständnis für das Fluchtverhalten von Jugendlichen aus dem System Familie zu entwickeln.
- Definition von "Straßenkindheit" in Deutschland
- Soziographie der Straßenkindheit
- Risikofaktoren innerhalb der Familie
- Beziehungsarmut und Pluralität familiärer Lebensgemeinschaften
- Systemischer Erklärungsansatz für das Fluchtverhalten von Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle gesellschaftliche Diskussion über Kindheit und Erziehung, wobei insbesondere die Problematik der „Straßenkindheit“ im Fokus steht. Das zweite Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs „Straßenkindheit“ und liefert einen Überblick über die soziographischen Aspekte dieses Phänomens in Deutschland. Im dritten Kapitel wird der Einfluss der Familie als Risikofaktor für Straßenkindheit näher betrachtet, wobei verschiedene Risikokonstellationen, wie die Risikophase der Jugend, Beziehungsarmut, Pluralität familiärer Lebensgemeinschaften, sexueller Missbrauch, Gewalterfahrung und Suchtverhalten in der Familie, sowie Ausstoßungsprozesse und Anziehungseffekte analysiert werden. Kapitel vier präsentiert einen systemischen Erklärungsansatz, der die Flucht von Jugendlichen aus dem System Familie aus einer umfassenden Perspektive betrachtet.
Schlüsselwörter
Straßenkindheit, Familie, Risikofaktoren, Beziehungsarmut, Jugend, Orientierungsphase, Fluchtverhalten, Systemischer Ansatz, Soziographie, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Ursachen für "Straßenkindheit" in Deutschland?
Häufige Ursachen sind familiäre Krisen, Beziehungsarmut, Gewalt, sexueller Missbrauch oder Suchtprobleme im Elternhaus.
Welche Rolle spielt die Familie als Risikofaktor?
Die Familie kann durch Instabilität, Ausstoßungsprozesse oder mangelnde emotionale Unterstützung zur Flucht von Jugendlichen beitragen.
Was ist ein systemischer Erklärungsansatz für Straßenkinder?
Dieser Ansatz betrachtet das Fluchtverhalten als Reaktion auf Störungen innerhalb des sozialen Systems Familie, statt nur das Individuum zu fokussieren.
Gibt es Unterschiede in der Problemlage bei Alleinerziehenden?
Die Arbeit beleuchtet spezifische Belastungen in Ein-Eltern-Familien oder Stieffamilien, die das Risiko für Konflikte erhöhen können.
Warum wird Kindheit heute oft als Risikophase gesehen?
Trotz vieler Chancen sind Kinder heute stärker von gesellschaftlichen Veränderungen betroffen, die sie ohne elterliche Hilfe nicht bewältigen können.
- Quote paper
- Julia Lieder (Author), 2006, Straßenkindheit und die Rolle der Familie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147211