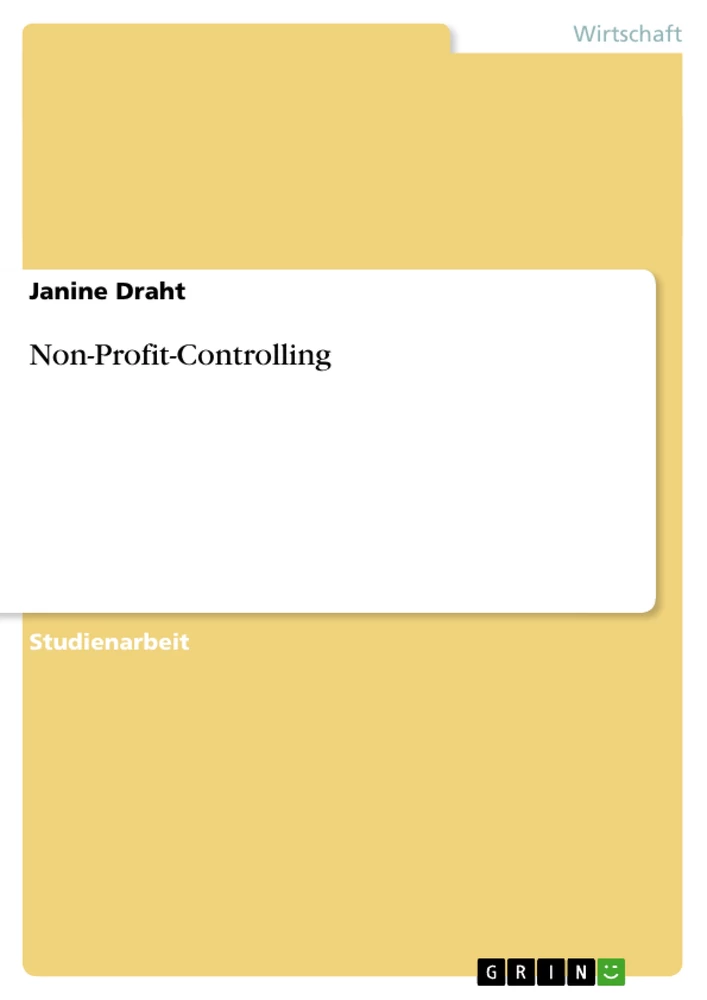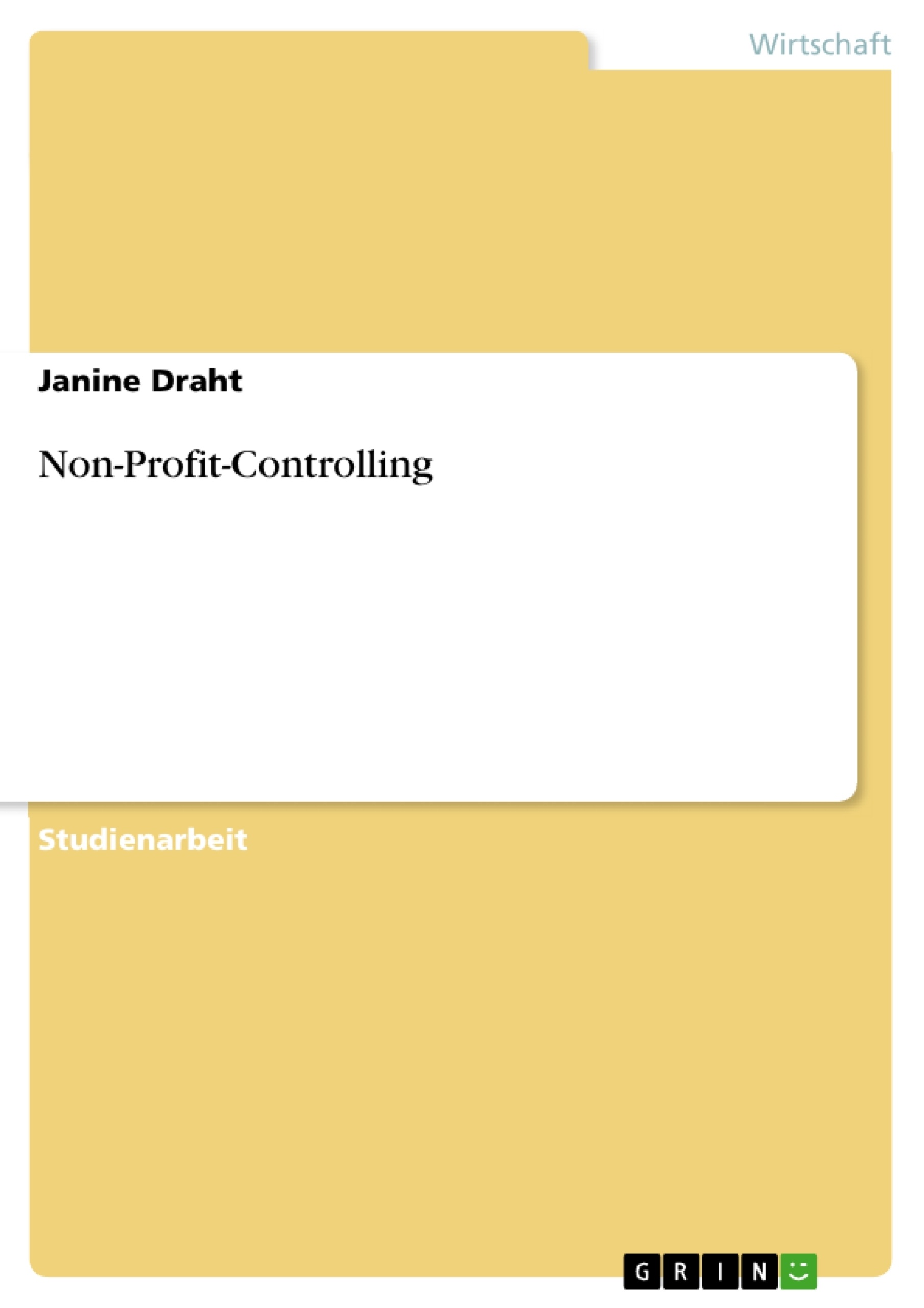Non-Profit-Organisationen (NPO) genießen häufig eine Art Vorschussvertrauen seitens sozialer Investoren und anderer Interessensgruppen. Der gute Zweck oder allgemein ausgedrückt die Gemeinwohlorientierung reicht meist als Entscheidungskriterium aus und führte in der Vergangenheit dazu, dass soziale Investoren eher weniger Nachweise über die Ansätze ihrer Arbeit und erzielten Wirkungen eingefordert haben.
In jüngerer Zeit hat sich in diesem Bereich jedoch viel entwickelt. Unsachgemäße Verwendung von Spendengeldern und das Wachsen dieser Organisationen haben dazu beigetragen, dass auch in diesem Bereich über mehr Transparenz diskutiert wird.
Dem gemeinnützigen Sektor werden fünf Prozent des Bruttoinlandproduktes zugeschrieben, er stellt 1,7 Millionen Arbeitsplätze und darüber hinaus spenden Bürger Ihre Zeit, um diese Einrichtungen zu unterstützen in einem Stundenvolumen, dass das Stundenvolumen des öffentlichen Dienstes um zehn Prozent übersteigt.
Es wird deutlich, welchen Stellenwert gemeinwohlorientierte Unternehmen im gesamtwirtschaftlichen Rahmen einnehmen. Daher ist es nur nachvollziehbar, dass die Stimmen lauter werden, die einen Nachweis über den effizienten und wirkungsvollen Einsatz der Mittel fordern.
Non-Profit-Organisationen übernehmen Aufgaben, die zur sozialen Stabilität und sozialen Gerechtigkeit beitragen. Sich dieser Aufgabe bewusst annehmend, versuchen immer mehr dieser Organisationen Resultate und Wirkungen zu analysieren und zu belegen. Diese Ergebnisse tragen dazu bei, sozialen Investoren Effektivität zu zeigen und in die eigene Entwicklung im Sinne der Gemeinnützigkeit zu investieren.
Aus dieser Betrachtung heraus entwickelte sich diese Seminararbeit zum Thema Non-Profit-Controlling. Ziel dieser Seminararbeit ist es die Kritik am Non-Profit-Sektor darzustellen und Richtlinien und Umsetzungswege auszuarbeiten, die dieser entgegen wirken. Dabei soll auf die externe Einflussnahme unabhängiger Institutionen, die daraus resultierende Notwendigkeit des Controllings und die spezifischen Umsetzungs-möglichkeiten eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff der Non-Profit-Organisation
- Die Probleme der Begriffsabgrenzung
- Definition
- Interessens- und Anspruchsgruppen – Eine Darstellung der Stakeholder
- Externe Richtlinien für mehr Transparenz und Milderung von Informationsasymmetrien
- Notwendigkeit externer Richtlinien
- Intermediärer Ansatz am Beispiel des Spenden-Siegels des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen
- Kurzdarstellung des DZI
- Auszüge aus den Leitlinien zur Selbstverpflichtung
- Auszüge aus den Ausführungsbestimmungen
- Voraussetzungen
- Grundlagen des Controlling in Non-Profit-Organisationen
- Notwendigkeit
- Besonderheiten und Herausforderungen
- Strategisches Controlling
- Einordnung
- Portfolio-Analyse
- Balanced Scorecard
- Operatives Controlling
- Einordnung
- Social Return on Investment
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Non-Profit-Controlling und analysiert die Kritik am Non-Profit-Sektor. Ziel ist es, Richtlinien und Umsetzungswege zu entwickeln, die dieser Kritik entgegenwirken. Die Arbeit beleuchtet dabei die externe Einflussnahme unabhängiger Institutionen, die daraus resultierende Notwendigkeit des Controllings und die spezifischen Umsetzungs-möglichkeiten.
- Transparenz und Kontrolle im Non-Profit-Sektor
- Externe Richtlinien und Standards zur Verbesserung der Transparenz
- Notwendigkeit und Bedeutung des Controllings in Non-Profit-Organisationen
- Spezifische Herausforderungen und Möglichkeiten des Controllings im Non-Profit-Bereich
- Der Einsatz von Instrumenten wie Portfolio-Analyse und Balanced Scorecard im Non-Profit-Controlling
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Non-Profit-Controlling ein und beleuchtet die zunehmende Kritik am Non-Profit-Sektor sowie die Notwendigkeit von Transparenz und Kontrolle. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Non-Profit-Organisation, analysiert die Probleme der Begriffsabgrenzung und definiert die wesentlichen Merkmale von NPOs. Das dritte Kapitel behandelt die Interessens- und Anspruchsgruppen von NPOs und stellt die verschiedenen Stakeholder vor. Das vierte Kapitel befasst sich mit externen Richtlinien zur Verbesserung der Transparenz und Milderung von Informationsasymmetrien, wobei das Beispiel des Spenden-Siegels des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) im Detail betrachtet wird. Das fünfte Kapitel skizziert die Voraussetzungen für ein effektives Non-Profit-Controlling. Die Kapitel sechs und sieben widmen sich den Grundlagen des Controllings in Non-Profit-Organisationen, wobei sowohl strategisches als auch operatives Controlling beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Non-Profit-Organisationen, Non-Profit-Controlling, Transparenz, Informationsasymmetrien, Stakeholder, externe Richtlinien, Spenden-Siegel, Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), strategisches Controlling, operatives Controlling, Portfolio-Analyse, Balanced Scorecard, Social Return on Investment.
Häufig gestellte Fragen zum Non-Profit-Controlling
Warum benötigen Non-Profit-Organisationen (NPO) ein Controlling?
NPOs müssen gegenüber Spendern und dem Staat nachweisen, dass sie ihre Mittel effizient, wirkungsvoll und zweckgebunden einsetzen, um Vertrauen und Transparenz zu sichern.
Was ist das DZI-Spenden-Siegel?
Es ist ein Gütesiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, das Organisationen bescheinigt, dass sie sorgfältig mit Spendengeldern umgehen und transparent berichten.
Was bedeutet "Social Return on Investment" (SROI)?
SROI ist eine Methode des operativen Controllings, die versucht, den gesellschaftlichen Mehrwert einer Investition in Geldwerten oder messbaren sozialen Wirkungen darzustellen.
Welche Instrumente nutzt das strategische NPO-Controlling?
Häufig eingesetzte Instrumente sind die Balanced Scorecard (zur Steuerung nach verschiedenen Perspektiven) und die Portfolio-Analyse (zur Bewertung von Projekten).
Was sind Informationsasymmetrien im Spendenwesen?
Es beschreibt den Zustand, dass Spender weniger über die tatsächliche Arbeit und Wirkung einer NPO wissen als die Organisation selbst, was durch Transparenzrichtlinien ausgeglichen werden soll.
- Arbeit zitieren
- Janine Draht (Autor:in), 2009, Non-Profit-Controlling, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147280