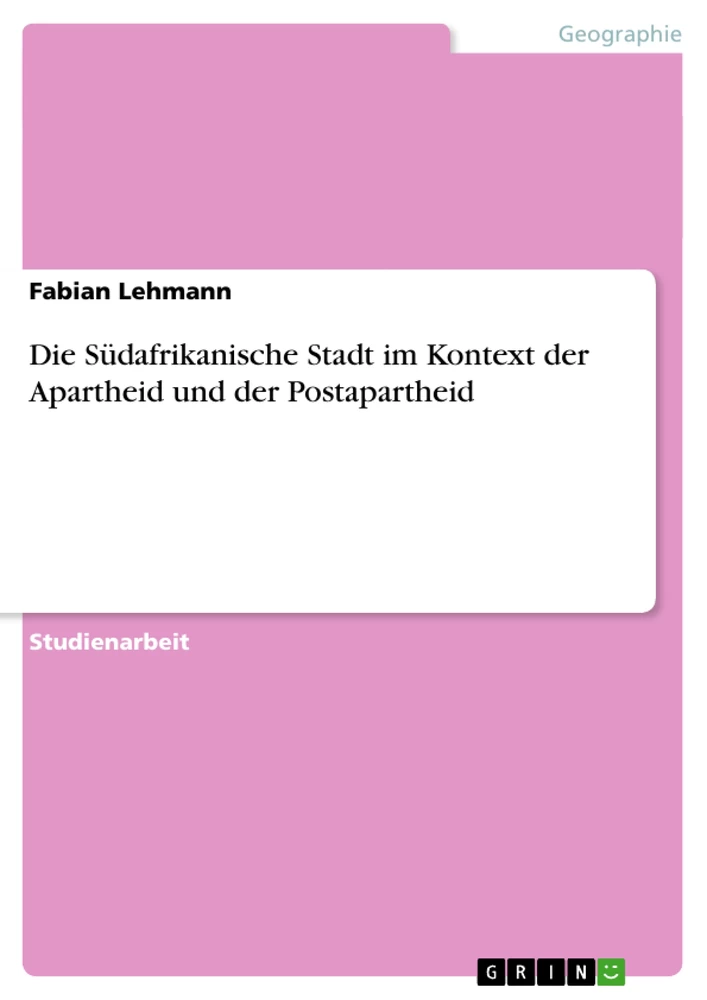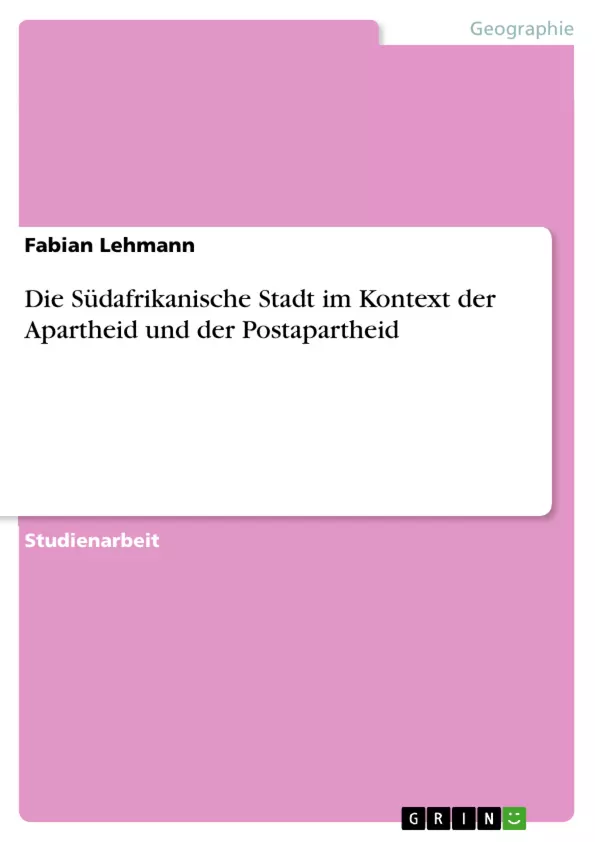Das Afrikaans Wort Apartheid geht auf die niederländische Bezeichnung für Trennung oder Teilung zurück. Dieses Wort steht seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vielmehr für das südafrikanische politische System der weißen Minderheitsherrschaft, die über vier Jahrzehnte währte. Mit dem Wahlsieg der National Party 1948 manifestierte sich ein System, das zu einer politischen, kulturellen und ökonomischen Trennung der als Rassen bezeichneten Bevölkerungsgruppen führte. Diese systematische und von höchster staatlicher Ebene verfolgte Politik hatte vor allem auch konkrete Auswirkungen auf die Physis der Städte. Um die Entwicklung der urbanen Zentren in Südafrika in den letzten fünf Jahrzehnten soll es in dieser Arbeit gehen. Ebenso werden die Jahre nach der offiziellen Auflösung dieses politischen Systems 1990 von zentraler Bedeutung sein.
Um zu verstehen, durch welche Mittel sich ein kolonialer Staat in den südafrikanischen Apartheidsstaat verwandeln konnte, muss zunächst kurz der historischen Entwicklung Südafrikas Rechnung gezollt werden. Dabei wird der gesetzliche Rahmen von Bedeutung sein, der Voraussetzung für die Schaffung eines Systems der Isolierung und Unterdrückung der schwarzafrikanischen Bevölkerung war. Daraufhin werden die Auswirkungen dieser Politik auf die schwarze Bevölkerung Afrikas näher betrachtet werden, die sich in bestimmten Siedlungsformen wie Townships, Homelands oder informellen Siedlungen äußerten. Ferner soll die quantitative und qualitative Entwicklung der urbanen Zentren in den Homelands untersucht werden, die von zentraler Bedeutung für die Segregation im Apartheids-Südafrika waren. Um die historische Entwicklung der urbanen Siedlungen während und nach der Ära der Apartheid in Südafrika besser nachvollziehen zu können, wird Kapstadt als konkretes Beispiel dienen. Zuletzt soll die Situation des Postapartheid-Südafrika vorgestellt werden. Dabei wird die Frage nach den Auswirkungen der Apartheidspolitik nach deren Ende von zentraler Bedeutung sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Weg zur Apartheid
- 3. Die Politik der Apartheid
- 3.1 Kurzer historischer Überblick der Siedlungspolitik
- 3.2 Restriktionen und deren Folgen
- 3.3 Die Urbanisierung in den Homelands
- 4. Die Apartheidsstadt im Modell
- 5. Das Beispiel Kapstadt
- 6. White Suburbs / Black Townships: Die Jahrzehnte nach dem Ende der Apartheid
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung südafrikanischer Städte im Kontext der Apartheid und der Postapartheid-Ära. Das Ziel ist es, die Auswirkungen der Apartheidpolitik auf die physische Struktur der Städte und die Lebensbedingungen der schwarzen Bevölkerung zu analysieren und die Situation nach dem Ende der Apartheid zu beleuchten.
- Der Weg zur Apartheid und die Rolle rassistischer Ideologien
- Die Auswirkungen der Apartheidpolitik auf die räumliche Segregation
- Die Entwicklung der Townships, Homelands und informellen Siedlungen
- Kapstadt als Fallbeispiel für die Auswirkungen der Apartheid
- Die Herausforderungen des Postapartheid-Südafrikas
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der südafrikanischen Städte im Kontext der Apartheid und Postapartheid ein. Sie definiert den Begriff Apartheid und beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Entwicklung urbaner Zentren in den letzten fünf Jahrzehnten, mit besonderem Augenmerk auf die Zeit nach 1990. Die Einleitung umreißt die zentralen Fragestellungen der Arbeit und skizziert den methodischen Ansatz.
2. Der Weg zur Apartheid: Dieses Kapitel untersucht die historischen Wurzeln der Apartheid. Es beleuchtet die Rolle des Rassenbewusstseins im frühen 20. Jahrhundert, die Anwendung darwinistischer Theorien zur Rechtfertigung der Segregation und die Bedeutung des Immigrants Regulation Act von 1913 sowie des Natives (Urban Areas) Act von 1923. Das Kapitel analysiert, wie wirtschaftliche Interessen an billigen Arbeitskräften mit rassistischen Ideologien verknüpft waren, um die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung zu rechtfertigen und die Entstehung der Homelands zu erklären. Die wirtschaftliche Nicht-Überlebensfähigkeit der Homelands wird als entscheidender Faktor für die anhaltende Abhängigkeit der schwarzen Bevölkerung von Südafrika dargestellt.
3. Die Politik der Apartheid: Dieses Kapitel beschreibt die systematische Apartheidpolitik nach dem Wahlsieg der National Party 1948. Es analysiert den Group Areas Act von 1950 und weitere Maßnahmen zur vollständigen Segregation der Bevölkerung. Der Fokus liegt auf der gezielten Segregation der schwarzen Bevölkerung als Reaktion auf deren Migration in die Städte und die damit verbundene Bedrohung der weißen Minderheit. Die Kapitel unterstreichen die physische Ausprägung der Segregation durch Landenteignung und Zwangsumsiedlung. Der Population Registration Act von 1950 und die hierarchische Einteilung der Bevölkerung in rassisch definierte Gruppen werden ebenfalls ausführlich behandelt. Die Kapitel verdeutlichen, wie diese Maßnahmen den rasanten Anstieg des afrikanischen Anteils in den Städten zu verringern versuchten.
4. Die Apartheidsstadt im Modell: [Da der Text keine Information zu Kapitel 4 enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden].
5. Das Beispiel Kapstadt: [Da der Text keine Information zu Kapitel 5 enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden].
6. White Suburbs / Black Townships: Die Jahrzehnte nach dem Ende der Apartheid: [Da der Text keine Information zu Kapitel 6 enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden].
Schlüsselwörter
Apartheid, Südafrika, Urbanisierung, Segregation, Rassismus, Homelands, Townships, Siedlungspolitik, Postapartheid, Kapstadt, soziale Ungleichheit, räumliche Disparitäten.
Häufig gestellte Fragen zu: Südafrikanische Städte im Kontext der Apartheid und Postapartheid
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung südafrikanischer Städte während der Apartheid und in der Postapartheid-Ära. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen der Apartheidpolitik auf die städtische Struktur und die Lebensbedingungen der schwarzen Bevölkerung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Weg zur Apartheid, die Rolle rassistischer Ideologien, die Auswirkungen der Apartheidpolitik auf die räumliche Segregation (z.B. durch den Group Areas Act), die Entwicklung von Townships, Homelands und informellen Siedlungen, Kapstadt als Fallbeispiel und die Herausforderungen des Postapartheid-Südafrikas. Es werden auch der Immigrants Regulation Act von 1913 und der Natives (Urban Areas) Act von 1923 analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in diesen?
Die Arbeit umfasst sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein. Kapitel 2 (Der Weg zur Apartheid) untersucht die historischen Wurzeln der Apartheid und die Verknüpfung wirtschaftlicher Interessen mit rassistischen Ideologien. Kapitel 3 (Die Politik der Apartheid) beschreibt die systematische Apartheidpolitik nach 1948, inklusive des Group Areas Act und weiterer segregativer Maßnahmen. Kapitel 4, 5 und 6 (Die Apartheidsstadt im Modell, Das Beispiel Kapstadt, White Suburbs / Black Townships: Die Jahrzehnte nach dem Ende der Apartheid) werden im vorliegenden Textzusammenfassung nicht beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Apartheid, Südafrika, Urbanisierung, Segregation, Rassismus, Homelands, Townships, Siedlungspolitik, Postapartheid, Kapstadt, soziale Ungleichheit, räumliche Disparitäten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Apartheidpolitik auf die physische Struktur der Städte und die Lebensbedingungen der schwarzen Bevölkerung und beleuchtet die Situation nach dem Ende der Apartheid.
Welche Methoden werden (vermutlich) angewendet?
Die Einleitung erwähnt einen methodischen Ansatz, welcher jedoch im vorliegenden Text nicht näher erläutert wird.
- Quote paper
- Fabian Lehmann (Author), 2008, Die Südafrikanische Stadt im Kontext der Apartheid und der Postapartheid, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147310