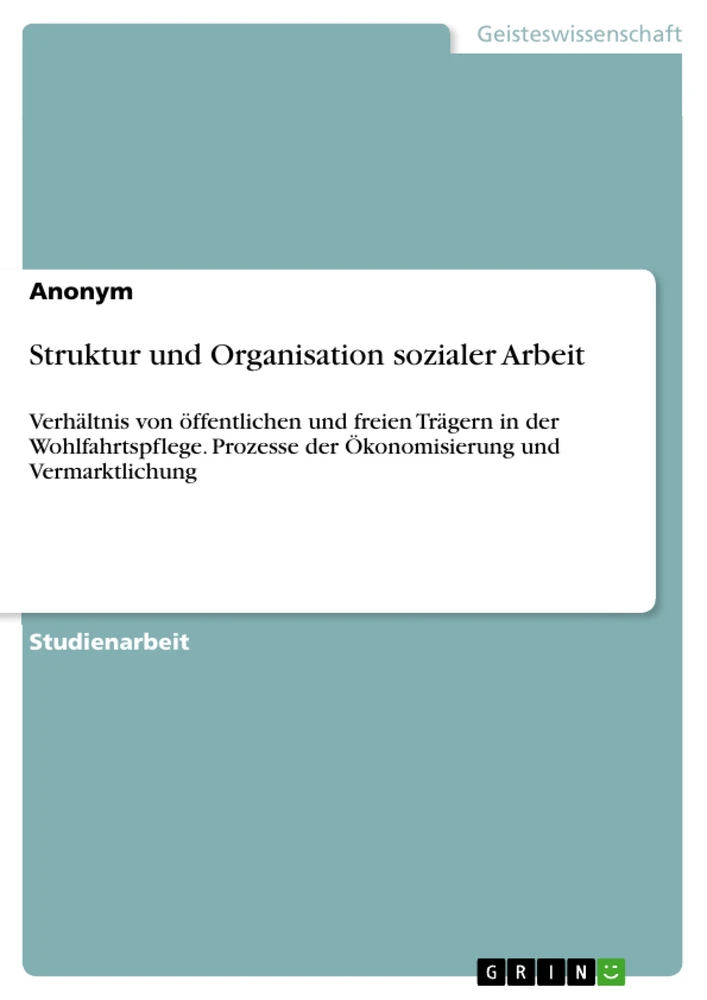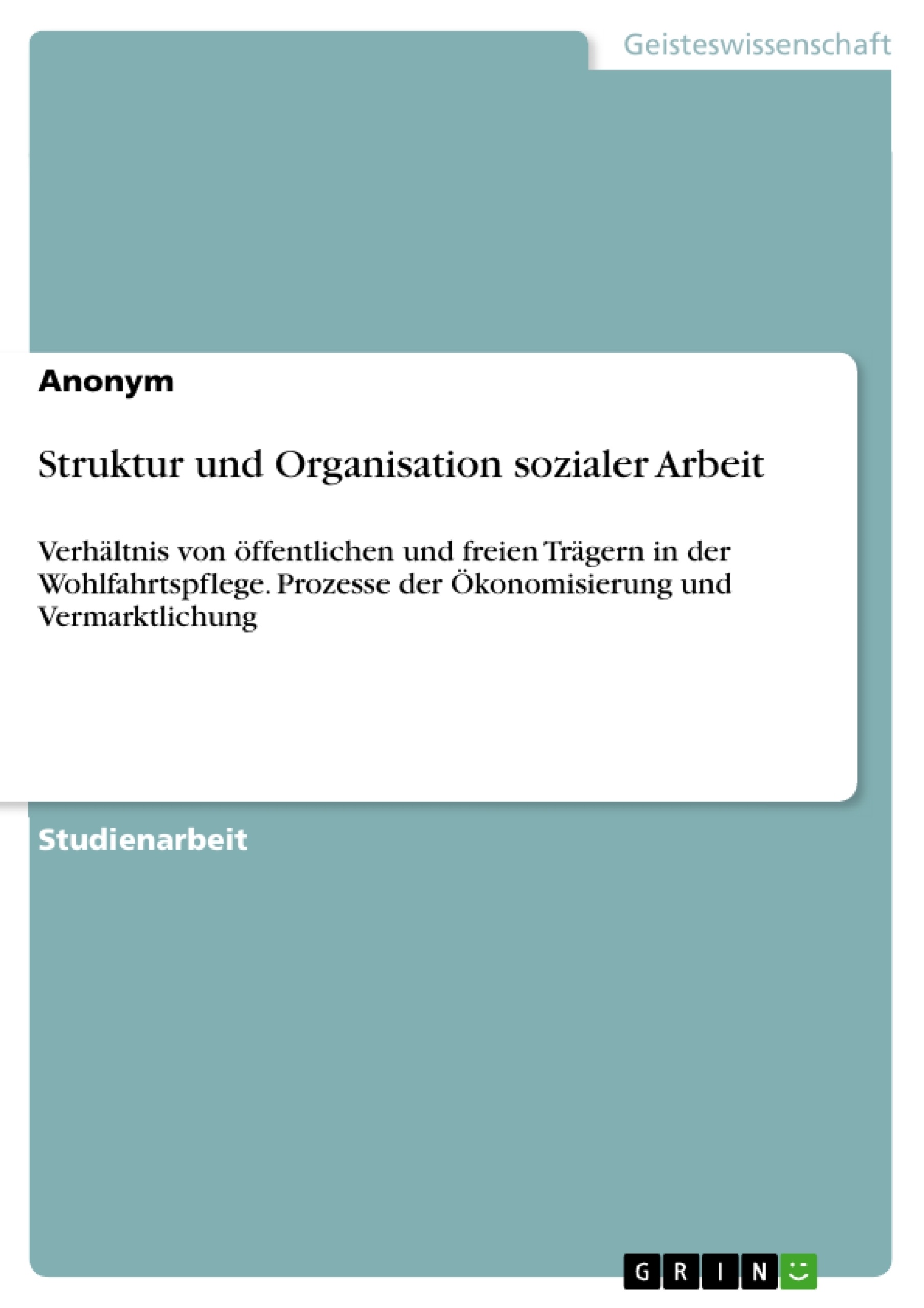Das Verhältnis öffentlicher (i. d. R. Kommune) und freier Träger (z. B. Einrichtung für Men-schen mit Behinderungen) wird in den einzelnen Sozialgesetzbüchern definiert. Bei der Ko-operation mit gemeinnützigen und unabhängigen Institutionen und Organisationen streben die öffentlichen Träger als Leistungsträger danach, dass ihre Aktivitäten in effektiver Weise zum Nutzen der Leistungsempfänger mit den Tätigkeiten der genannten Einrichtungen und Orga-nisationen zusammenwirken. Dabei ist darauf zu achten, dass die Selbstständigkeit dieser Einrichtungen in Bezug auf Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben respektiert wird. Die Überprüfung der zweckentsprechenden Verwendung von öffentlichen Mitteln bleibt dabei un-berührt (vgl. § 17 Abs. 3 SGB I).
Inhaltsverzeichnis
- Verhältnis von öffentlichen und freien Trägern in der Wohlfahrtspflege
- Nützliche Aspekte für die Adressat*Innen
- Gefahren für Adressat*Innen
- Nützliche Aspekte und Gefahren für Fachkräfte
- Beilspiel einer Einrichtung und die Eingebundenheit in das System der öffentlichen und freien Träger
- Prozesse der Ökonomisierung und Vermarktlichung
- Verhältnis von öffentlichen und freien Trägern der Wohlfahrtspflege im Kontext der Ökonomisierung und Vermarktlichung
- Fallverstehen in der Sozialen Arbeit
- Der Fall Ralf Dierks im Kontext des Fallverstehens
- Der Fall Falko im Kontext Fallverstehen
- Strukturelle Verantwortungslosigkeit
- Ralf Dierks im Kontext der strukturellen Verantwortungslosigkeit und geplantem Vandalismus
- Problemkarrieren und mögliche alternative Vorgehensweisen im Fall Ralf Dierks
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Verhältnis zwischen öffentlichen und freien Trägern in der Wohlfahrtspflege im Kontext der Prozesse der Ökonomisierung und Vermarktlichung. Im Fokus steht die Frage, welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf die Arbeit mit den Adressat*Innen und die Fachkräfte in der Sozialen Arbeit haben.
- Das Verhältnis von öffentlichen und freien Trägern in der Wohlfahrtspflege
- Die Auswirkungen der Ökonomisierung und Vermarktlichung auf die Wohlfahrtspflege
- Fallverstehen in der Sozialen Arbeit
- Strukturelle Verantwortungslosigkeit
- Mögliche alternative Vorgehensweisen in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel befasst sich mit dem Verhältnis von öffentlichen und freien Trägern in der Wohlfahrtspflege. Es wird die historische Entwicklung des Verhältnisses beleuchtet und die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Rolle des Subsidiaritätsprinzips erörtert. Darüber hinaus werden die nützlichen Aspekte und Gefahren für Adressat*Innen und Fachkräfte im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern analysiert.
- Das zweite Kapitel widmet sich den Prozessen der Ökonomisierung und Vermarktlichung in der Wohlfahrtspflege. Es wird untersucht, wie sich diese Entwicklungen auf das Verhältnis von öffentlichen und freien Trägern auswirken und welche Folgen sie für die Arbeit mit den Adressat*Innen und die Fachkräfte in der Sozialen Arbeit haben.
- Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Fallverstehen in der Sozialen Arbeit. Anhand von zwei Fallbeispielen (Ralf Dierks und Falko) wird erläutert, wie das Fallverstehen in der Praxis funktioniert und welche Herausforderungen sich im Kontext der strukturellen Verantwortungslosigkeit stellen.
- Das vierte Kapitel analysiert das Phänomen der strukturellen Verantwortungslosigkeit und untersucht, inwiefern es im Fall von Ralf Dierks zu einer Problemkarriere geführt hat. Zudem werden mögliche alternative Vorgehensweisen diskutiert, die geeignet wären, um Problemkarrieren zu verhindern.
Schlüsselwörter
Öffentliche Träger, freie Träger, Wohlfahrtspflege, Ökonomisierung, Vermarktlichung, Fallverstehen, strukturelle Verantwortungslosigkeit, Problemkarrieren, Sozialgesetzbuch, Subsidiaritätsprinzip, Adressat*Innen, Fachkräfte, Jugendhilfe.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2023, Struktur und Organisation sozialer Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1474032