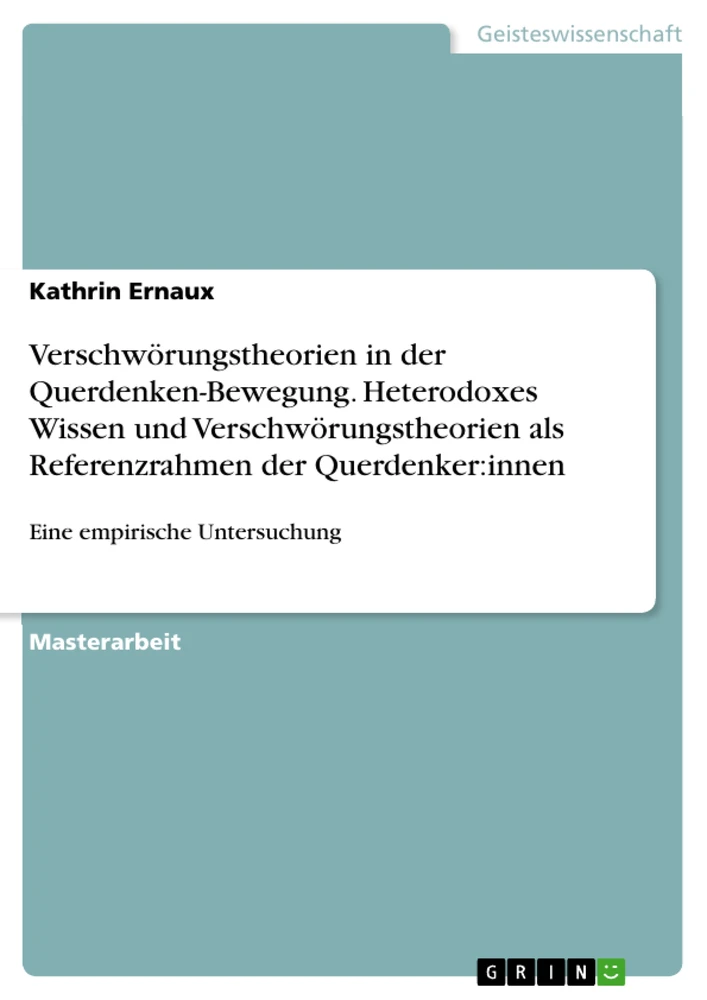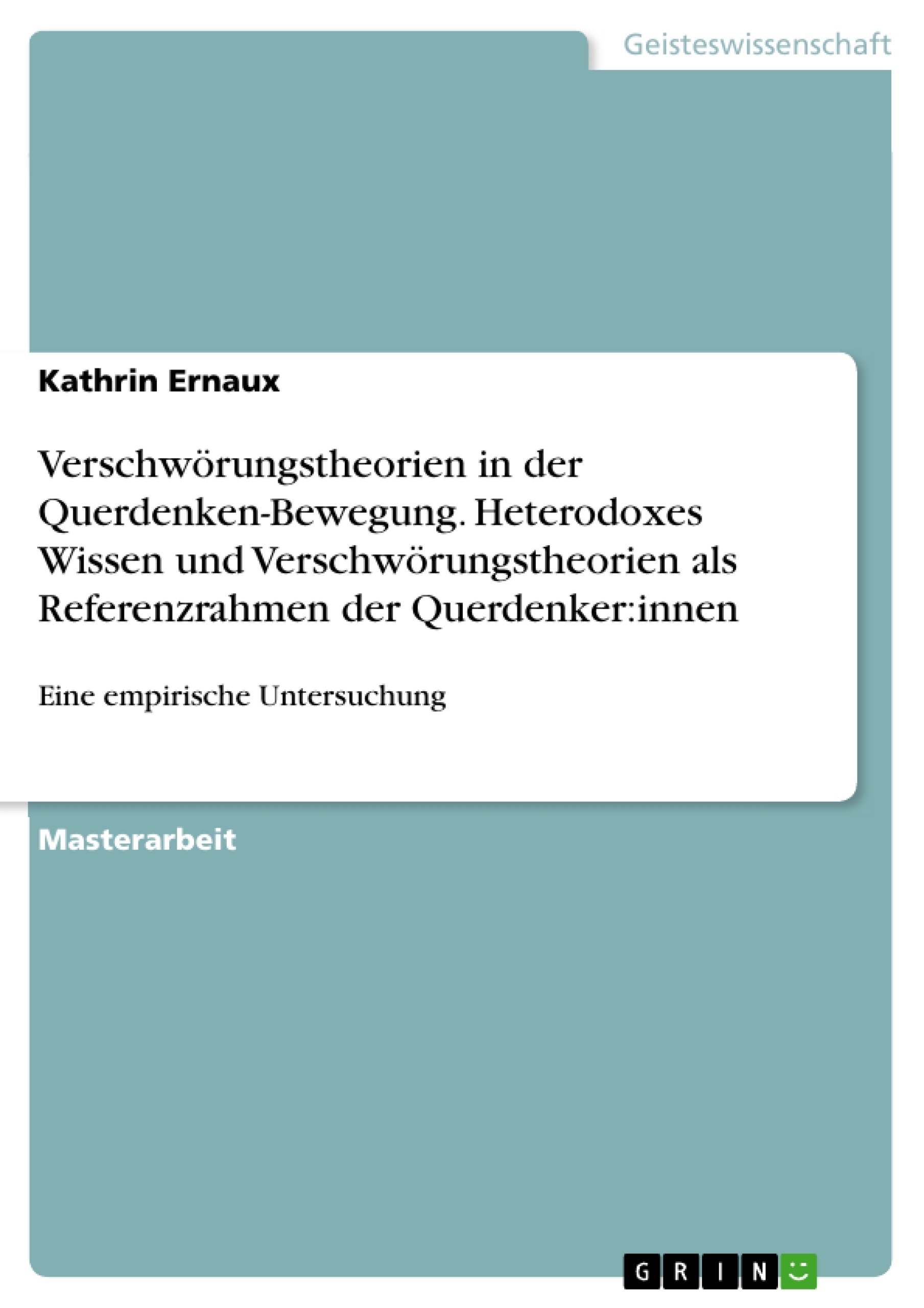Im Zuge der Covid-19-Pandemie beschloss die Bundesregierung zahlreiche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Die Maßnahmen wirkten sich auf die Lebensgewohnheiten jedes Bundesbürgers aus. Es entstanden Unsicherheiten bedingt durch finanzielle Ungewissheit, den Einbruch von Routinen, Einschränkungen des sozialen Lebens und die zukunftsbezogene Planungsunsicherheit. Vor diesem Hintergrund bildete sich Anfang 2020 die Querdenken-Bewegung, die sich als Protestbewegung gegen die von der Regierung verhängten Maßnahmen versteht. Die Mitglieder organisieren sich deutschlandweit in lokalen Ortsgruppen über den Messenger-Dienst Telegram. Medial sorgten die Proteste durch die heterogene Zusammensetzung der Teilnehmenden, die Sichtbarkeit von Verschwörungstheoretiker:innen und die zunehmende Radikalisierung für große Aufmerksamkeit. In dieser Forschungsarbeit wurde den Fragen nachgegangen, welche Einstellungsmerkmale den Referenzrahmen der Querdenker:innen bilden und welchen Einfluss die Nutzung von Netzwerkmedien auf die Rezeption heterodoxer Verschwörungstheorien hat. Es wurden Interviewanfragen in zwölf Ortsgruppen der Querdenken-Chatgruppen gepostet. Dadurch konnten sieben Personen (N=7) rekrutiert werden, die mittels leitfadengestützter E-Mail-Interviews befragt wurden. Die Transkripte wurden mit der Analysesoftware MAXQDA kodiert und durch die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Die Ergebnisse zeigten, dass die Befragten neben den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auch die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien sowie die Impfung ablehnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Begriffsherkunft und lexikalische Begriffsbestimmung
- Zusammenfassung
- Begriffsdiskussion
- Soziales Phänomen oder Pathologie des Einzelnen?
- Wissenssoziologische Perspektive
- Wissenssoziologie nach Berger und Luckmann
- Heterodoxe und orthodoxe Verschwörungstheorien
- Arbeitsdefinition
- Verschwörungstheorien in den Netzwerkmedien
- Unterscheidungsmerkmale zu Massenmedien
- Filterblasen, Echokammern und Filter Clash
- Auswirkungen der Verbreitung von Verschwörungstheorien auf die Pandemiebekämpfung
- Entstehungsgeschichte der Querdenken-Bewegung
- Entstehungskontext
- Initiatoren und Inhalte
- Teilnehmer:innen
- Verschwörungstheorien und Netzwerkmedien der Querdenken-Bewegung
- Covid-19-Verschwörungstheorien
- Verschwörungstheorien am Beispiel QAnon
- Verschwörungstheorien am Beispiel Bill Gates
- Netzwerkmedien der Querdenken-Bewegung
- Verbreitung von Verschwörungstheorien
- Die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien
- Hypothesen und Forschungsfrage
- Forschungsdesign
- Methodendiskussion und Auswahl
- Stichprobe und Rekrutierung
- Leitfadenentwicklung
- Durchführung der Interviews
- Datenauswertung
- Grenzen der Methodik
- Ergebnisse
- Reaktionen auf die Anfrage
- Einstellungsmerkmale
- Einstellung zum Coronavirus
- Einstellung zur Impfung
- Einstellung zu den Maßnahmen
- Einstellung zu den öffentlich-rechtlichen Medien
- Mediennutzung
- Glaube an Verschwörungstheorien
- Beantwortung der Forschungshypothesen
- Diskussion
- Beantwortung der Forschungsfrage
- Interpretation der Ergebnisse
- Limitationen und Reflektion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Verschwörungstheorien in der Querdenken-Bewegung. Sie untersucht die Verbreitung und Rezeption von Verschwörungstheorien in den Netzwerkmedien und analysiert die Rolle dieser Theorien im Kontext der Pandemiebekämpfung.
- Begriffliche Klärung und Abgrenzung von Verschwörungstheorien
- Wissenschafts- und Wissenssoziologische Perspektiven auf Verschwörungstheorien
- Die Rolle von Netzwerkmedien in der Verbreitung von Verschwörungstheorien
- Analyse der Querdenken-Bewegung im Kontext von Verschwörungstheorien
- Empirische Untersuchung der Einstellungen und Mediennutzung von Teilnehmer:innen der Querdenken-Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Verschwörungstheorien und erläutert den theoretischen Rahmen der Untersuchung. Es werden verschiedene Definitionen und Abgrenzungen von Verschwörungstheorien diskutiert, sowie die wissenschaftssoziologische Perspektive auf dieses Phänomen beleuchtet. Kapitel 3 widmet sich der Rolle von Netzwerkmedien in der Verbreitung von Verschwörungstheorien, wobei die Besonderheiten dieser Medien im Vergleich zu Massenmedien hervorgehoben werden. Kapitel 4 untersucht die Entstehungsgeschichte der Querdenken-Bewegung und analysiert die Verbreitung von Verschwörungstheorien innerhalb dieser Bewegung.
Kapitel 5 befasst sich mit der Forschungsfrage der Arbeit und erläutert das Forschungsdesign. Die empirische Studie basiert auf Interviews mit Teilnehmer:innen der Querdenken-Bewegung und untersucht deren Einstellungen zu Verschwörungstheorien, zur Pandemiebekämpfung und zu den öffentlich-rechtlichen Medien. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Kapitel 6 präsentiert und interpretiert. In der Diskussion werden die Ergebnisse der Forschungsfrage beantwortet und die Limitationen der Studie reflektiert. Abschließend werden ein Fazit und Ausblick auf weitere Forschungsfelder gegeben.
Schlüsselwörter
Verschwörungstheorien, Querdenken-Bewegung, Netzwerkmedien, Pandemiebekämpfung, Wissenssoziologie, Heterodoxie, Orthodoxie, empirische Forschung, Interviews, Einstellungen, Mediennutzung
- Arbeit zitieren
- Kathrin Ernaux (Autor:in), 2021, Verschwörungstheorien in der Querdenken-Bewegung. Heterodoxes Wissen und Verschwörungstheorien als Referenzrahmen der Querdenker:innen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1474088