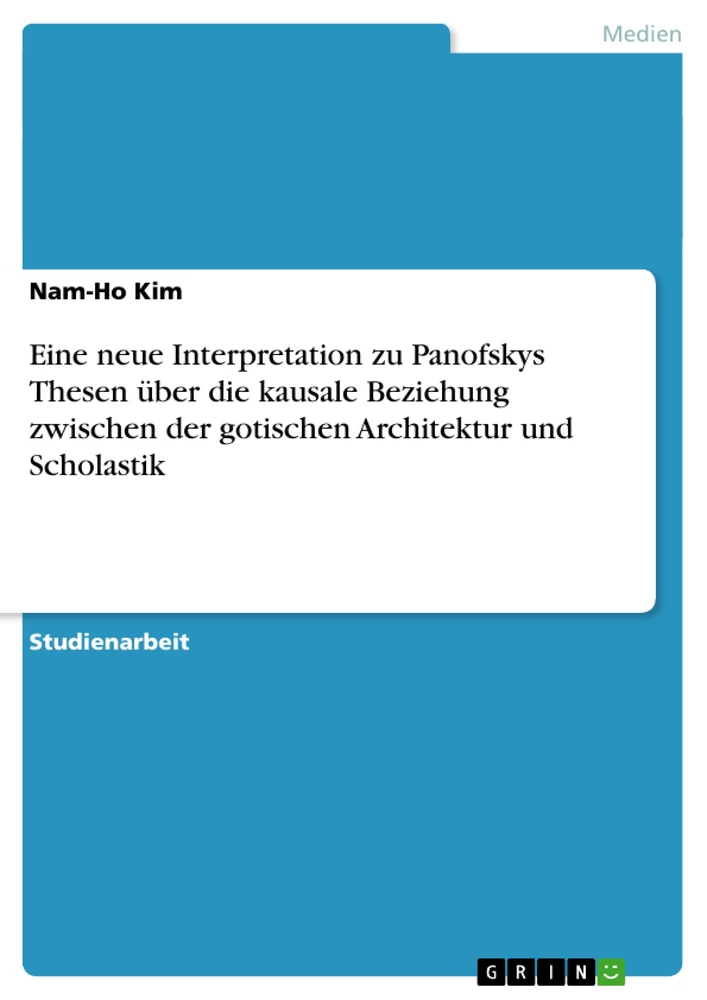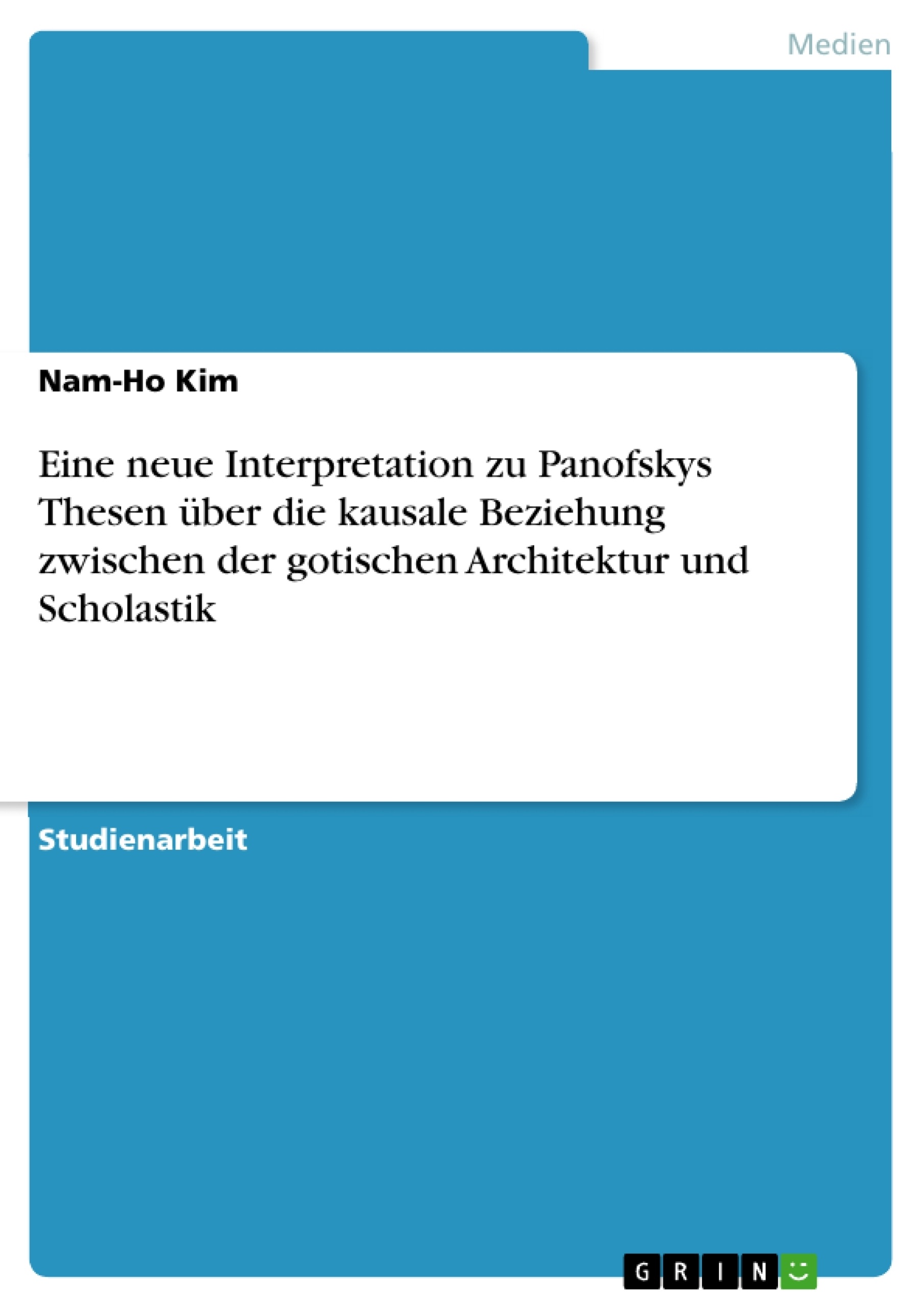Diese Studie zielt darauf ab, Panofskys Thesen über die kausale Beziehung zwischen der
Denkgewohnheit und dem Kunststil, die in seinem Buch Gotische Architektur und Scholastik
verdeutlicht wurde, sprachanalytisch zu interpretieren. Im oben genannten Buch versucht
Panofsky, aufzuzeigen, dass es eine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen der
Scholastik und der gotischen Architektur gibt. Die zentrale Frage für die Studie ist, was das
eigentlich bedeutet, dass eine Denkgewohnheit die Entstehung eines Kunststils oder einen
Kunststilwechsel verursacht. Die bisherige Kritik an Panofskys These basierte auf den
historischen Wahrheiten. Die Untersuchung der Bedeutung der kausalen Beziehung ist im
Prinzip kein Thema für den Kunsthistoriker. Aber die kunsthistorische Untersuchung reicht
nicht aus, um die Bedeutung von Panofskys These verstehen zu können.
Daher wird in dieser Studie vorgeschlagen, die Beziehung zwischen dem Kunststil und der
Denkgewohnheit als die Supervenienzbeziehung, die seit langem im Bereich der Philosophie
der Geistes viel diskutiert wurde, zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die zwei Kernthesen
- 2.1. Die erste These
- 2.2. Die zweite These
- 3. Die Beziehung zwischen Kunststil und Denkgewohnheit als Supervenienzbeziehung
- 3.1. Supervenienzbegriff
- 3.2. Eine Interpretation von Panofskys Thesen
- 3.3. Die Probleme
- 4. Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie zielt auf eine sprachanalytische Interpretation von Panofskys Thesen zur kausalen Beziehung zwischen gotischer Architektur und Scholastik ab. Die zentrale Frage ist die Bedeutung einer vermeintlichen kausalen Beziehung zwischen Denkgewohnheit und Kunststil. Die Studie geht über die reine kunsthistorische Betrachtung hinaus und nutzt den philosophischen Supervenienzbegriff zur Analyse.
- Sprachanalytische Interpretation von Panofskys Thesen
- Anwendung des Supervenienzbegriffs auf die Beziehung zwischen Kunststil und Denkgewohnheit
- Untersuchung der logischen Struktur von Panofskys Argumentation
- Analyse der zeitlichen Parallelität zwischen gotischer Architektur und Scholastik
- Erörterung der Grenzen von Panofskys Position
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung der Studie: eine sprachanalytische Interpretation von Panofskys Thesen zur kausalen Beziehung zwischen gotischer Architektur und Scholastik. Sie problematisiert die bisherige kunsthistorische Kritik an Panofsky und argumentiert für die Notwendigkeit einer philosophischen Perspektive, in diesem Fall der Supervenienz. Die zentralen Forschungsfragen werden formuliert und die drei Hauptthesen der Studie werden vorgestellt. Die Einleitung legt den Grundstein für die folgende detaillierte Analyse.
2. Die zwei Kernthesen: Dieses Kapitel analysiert zwei zentrale Thesen aus Panofskys "Gotische Architektur und Scholastik". Es wird die These der zeitlichen Parallelität zwischen der Entwicklung der Scholastik und der Gotik untersucht. Panofskys Beispiele (karolingische Renaissance und Johannes Scotus, Früh- und Hochgotik im Vergleich zur Früh- und Hochscholastik) werden nicht auf ihren historischen Wahrheitsgehalt hin geprüft, sondern auf ihre logische Bedeutung und ihren Beitrag zu Panofskys Argumentation. Die zweite These behandelt die postulierte kausale Beziehung zwischen Scholastik und Gotik, die im Mittelpunkt der weiteren Analyse steht.
3. Die Beziehung zwischen Kunststil und Denkgewohnheit als Supervenienzbeziehung: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es wird der Supervenienzbegriff eingeführt und auf die Beziehung zwischen Kunststil und Denkgewohnheit angewendet. Die Studie interpretiert Panofskys These unter Rückgriff auf den Supervenienzbegriff neu. Die Stärken und Schwächen dieses Ansatzes werden diskutiert, inklusive der Probleme, die bei einer stark reduktionistischen Interpretation der Supervenienzbeziehung auftreten können. Diese Diskussion bereitet den Weg für das abschließende Kapitel.
Schlüsselwörter
Gotische Architektur, Scholastik, Erwin Panofsky, Supervenienz, Kausalität, Kunststil, Denkgewohnheit, Sprachanalyse, Logische Wahrheit, Historische Wahrheit, Ikonologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Gotische Architektur und Scholastik: Eine sprachanalytische Interpretation von Panofskys Thesen"
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Studie analysiert Erwin Panofskys Thesen zur Beziehung zwischen gotischer Architektur und Scholastik. Sie geht dabei über eine rein kunsthistorische Betrachtung hinaus und verwendet den philosophischen Begriff der Supervenienz, um die vermeintliche kausale Beziehung zwischen Denkgewohnheit und Kunststil zu untersuchen.
Welche Methode wird in dieser Studie angewendet?
Die Studie verwendet eine sprachanalytische Methode, um Panofskys Argumentation zu interpretieren. Sie konzentriert sich auf die logische Struktur seiner Argumentation und die Bedeutung seiner Beispiele, anstatt deren historischen Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Der Supervenienzbegriff dient als analytisches Werkzeug zur Untersuchung der Beziehung zwischen Kunststil und Denkgewohnheit.
Welche zentralen Thesen werden in Panofskys Werk untersucht?
Die Studie untersucht zwei Kernthesen Panofskys: die These der zeitlichen Parallelität zwischen der Entwicklung der Scholastik und der Gotik und die These einer kausalen Beziehung zwischen beiden. Die Studie analysiert die logische Struktur und die Bedeutung dieser Thesen im Kontext von Panofskys Argumentation.
Was ist der Supervenienzbegriff und wie wird er in dieser Studie angewendet?
Der Supervenienzbegriff beschreibt ein Verhältnis, in dem Eigenschaften eines Systems (z.B. Kunststil) von Eigenschaften eines anderen Systems (z.B. Denkgewohnheit) abhängen. Die Studie wendet diesen Begriff an, um die Beziehung zwischen gotischer Architektur und Scholastik neu zu interpretieren und die Stärken und Schwächen dieses Ansatzes zu diskutieren.
Welche Kapitel umfasst die Studie und worum geht es in ihnen?
Die Studie besteht aus vier Kapiteln: Eine Einleitung, die das Thema und die Forschungsfragen einführt; ein Kapitel zur Analyse der zwei Kernthesen Panofskys; ein zentrales Kapitel zur Anwendung des Supervenienzbegriffs; und ein abschließendes Kapitel. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und trägt zur umfassenden Analyse bei.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Studie?
Die Studie untersucht die logische Struktur von Panofskys Argumentation und die Anwendbarkeit des Supervenienzbegriffs auf die Beziehung zwischen Kunststil und Denkgewohnheit. Sie diskutiert sowohl die Stärken als auch die Grenzen dieses Ansatzes und bietet eine neue Perspektive auf Panofskys Thesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie am besten?
Gotische Architektur, Scholastik, Erwin Panofsky, Supervenienz, Kausalität, Kunststil, Denkgewohnheit, Sprachanalyse, Logische Wahrheit, Historische Wahrheit, Ikonologie.
Für wen ist diese Studie gedacht?
Diese Studie richtet sich an Wissenschaftler und Studenten, die sich mit Kunstgeschichte, Philosophie und Sprachanalyse befassen. Sie bietet eine interdisziplinäre Perspektive auf die Beziehung zwischen Kunst und Denken.
- Quote paper
- Nam-Ho Kim (Author), 2010, Eine neue Interpretation zu Panofskys Thesen über die kausale Beziehung zwischen der gotischen Architektur und Scholastik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147481