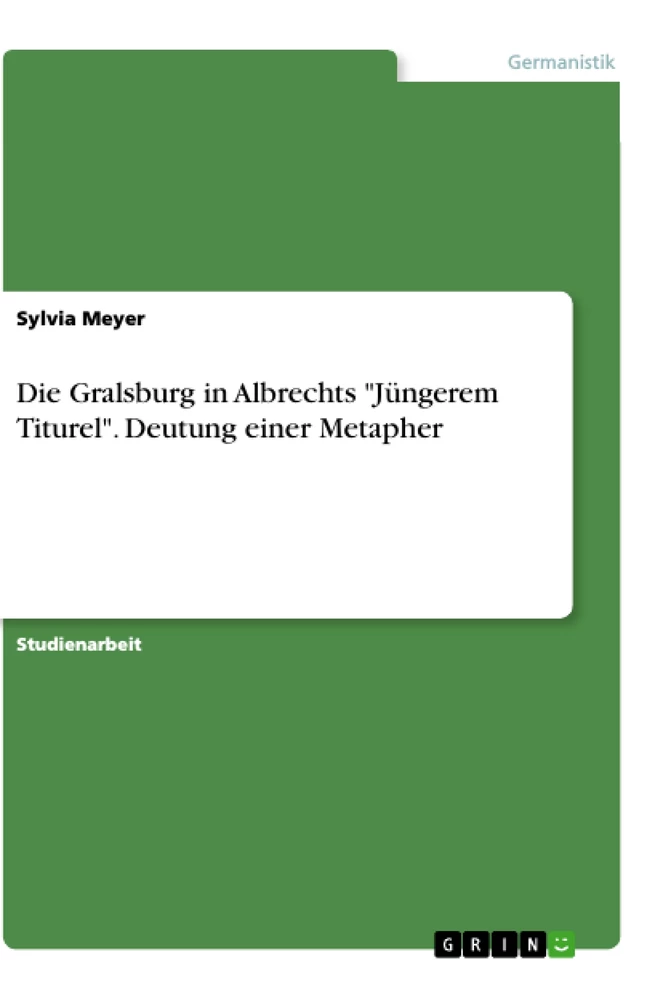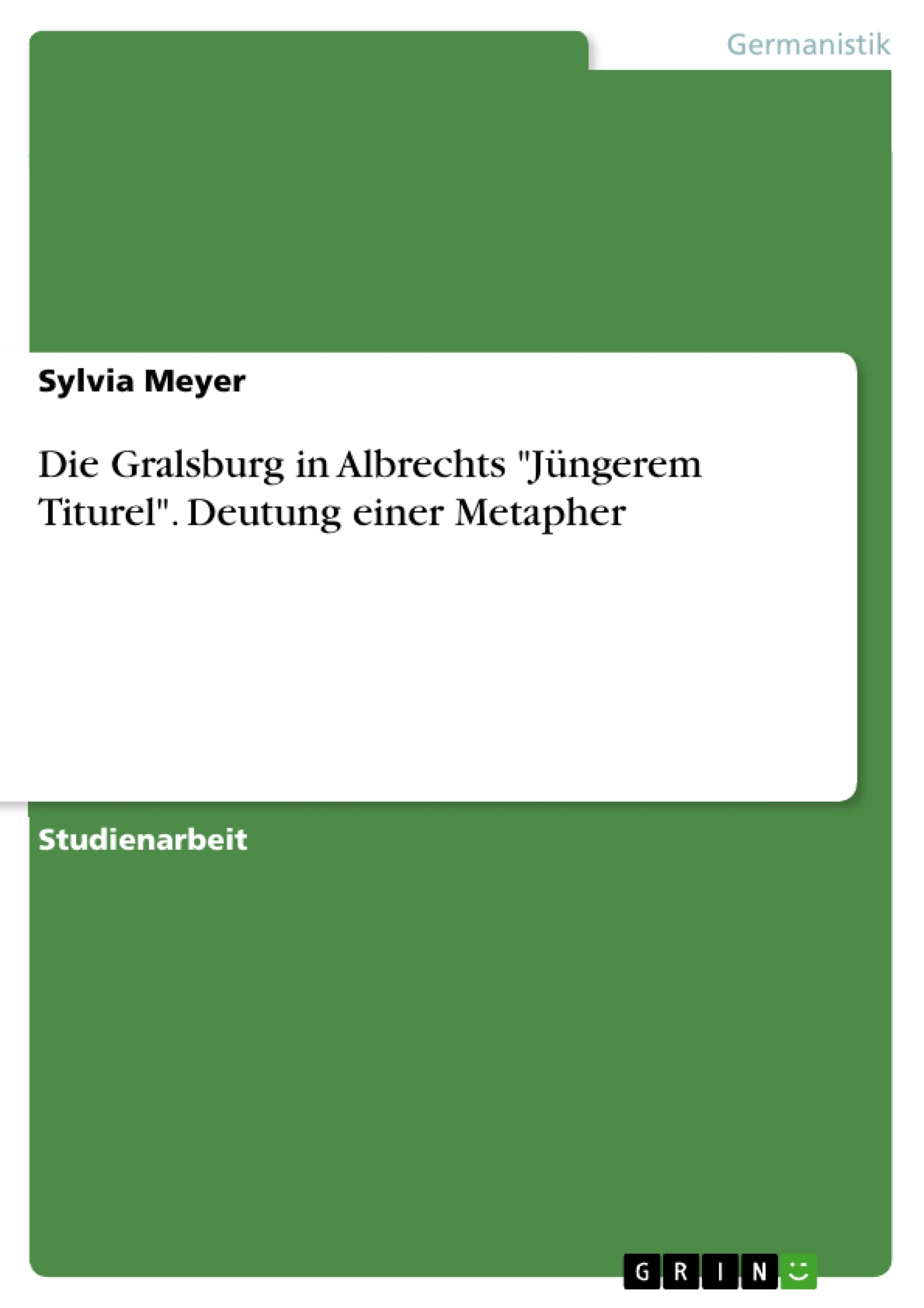Albrecht liefert uns mit seiner Beschreibung des Gralstempels die
einzige architektonische Beschreibung des zum Gral gehörigen Heiligtums in der deutschen Literatur des Mittelalters. Und so ist es auch nicht verwunderlich, daß viele Wissenschaftler sich in ihren Arbeiten zum einen mit der Frage auseinandergesetzt haben, inwie weit der Tempel des Heiligen
Gral einer tatsächlichen, architektonischen Realität entsprach. Wieder andere dagegen, versuchten zu klären, ob und, wenn dies zu bejahen ist, wie die von Albrecht beschriebene Tempelanlage zu einer Realität gemacht werden können.
So interessant und unterhaltsam diese Ausführungen im Einzelnen auch sein mögen, wird sich diese Arbeit dennoch jenseits dieser eher kunstgeschichtlichen oder architektonischen Fragestellungen bewegen.
Im Zentrum dieses Aufsatzes steht also der Gralstempel als literarische Idee, als Metapher, deren Bedeutung sich über die einzelnen Komponenten der Beschreibung erschließen und zu einem harmonischen Gesamtbild zusammenfügen läßt. Dabei spielen intertextuelle Beziehungen eine ebenso große Rolle wie Aussagen des Autors selbst. Obwohl die Fragestellung primär auf den Gralstempel als solchen abhebt, darf jedoch keineswegs die
geographische Lage des Heiligtums vernachlässigt werden.
Deswegen wird ein kurzes Kapitel über die Lage des Gralstempels
voranstehen, gefolgt von Abschnitten, die ihr Augenmerk auf spezielle Fragen richten: zum einen soll die Zahlensymbolik des Grastempels untersucht werden, daraufhin müssen die im Tempel verwendeten Materialen einer Untersuchung in Bezug auf ihren allegorischen Gehalt unterzogen werden, darüber hinaus dürfen einige wichtige Aspekte der Tiersymbolik nicht vernachlässigt werden. Zudem muß das Verhältnis der Teile zum Ganzen beleuchtet werden. Daneben muß gefragt werden, in welchem Verhältnis die Tempelbeschreibung als Ganzes oder auch nur Teile davon Teil einer literarischen Tradition sind, die es zu beleuchten gilt.
Um dies erreichen zu können, wird sich die Arbeit vom Äußeren des
Gralstempels in das Innere vorarbeiten, wobei keine der oben genannten Komponenten einzeln betrachtet werden soll. Vielmehr muß bereits in den Anfängen das Zusammenspiel der Einzelteile Betrachtung finden.
Daraufhin soll eine Sythese der einzelnen Funde versucht werden, bevor kurz die Frage nach möglichen Vorbildern, realen als auch literarisch-theologischen, gestellt werden soll. ...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Name und geographische Lage der Burg
- Der Name Munsalvaeshe
- Die geographische Lage - Terre de Salvaesche
- Das Äußere des Tempels
- Das Fundament
- Die Türme
- Das Innere des Tempels
- Die Dreigliedrigkeit des Innenbereiches
- Die untere Zone - Das künstliche Meer
- Die mittlere Zone - Der künstliche Garten
- Die obere Zone - Der künstliche Himmel
- Zwischenfazit
- Die Kapellen und das Allerheiligste
- Die Bedeutung des Tempelbaus – Das himmlische Jerusalem
- Die Dreigliedrigkeit des Innenbereiches
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Gralstempel in Wolfram von Eschenbachs "Parzival" als literarische Idee und Metapher. Sie analysiert die Bedeutung der einzelnen Beschreibungselemente und untersucht, wie sie zu einem harmonischen Gesamtbild zusammengefügt werden. Dabei spielen intertextuelle Beziehungen und Aussagen des Autors eine wichtige Rolle. Der Fokus liegt auf der symbolischen Bedeutung des Tempels und seiner Umgebung, wobei die geographische Lage des Heiligtums ebenfalls berücksichtigt wird.
- Die symbolische Bedeutung des Gralstempels
- Die Rolle der Zahlensymbolik im Tempel
- Die allegorische Bedeutung der verwendeten Materialien
- Die Bedeutung der Tiersymbolik im Tempel
- Das Verhältnis der Teile zum Ganzen im Tempel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Gralstempels als literarische Idee ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Forschungsansätze zum Thema und betont die Relevanz der intertextuellen Beziehungen und der symbolischen Bedeutung des Tempels. Das Kapitel "Name und geographische Lage der Burg" analysiert die Bedeutung des Namens Munsalvaeshe und untersucht die geographische Lage des Gralstempels im Kontext des "locus secretus".
Schlüsselwörter
Gralstempel, Wolfram von Eschenbach, "Parzival", literarische Idee, Metapher, Symbol, Zahlensymbolik, Materialsymbolik, Tiersymbolik, intertextuelle Beziehungen, locus secretus, himmlisches Jerusalem
Häufig gestellte Fragen
Was symbolisiert der Gralstempel im „Jüngeren Titurel“?
Der Tempel wird als literarische Metapher für das Himmlische Jerusalem und als Zentrum einer sakralen Ordnung verstanden, dessen Architektur tiefe allegorische Bedeutungen trägt.
Was bedeutet der Name „Munsalvaeshe“?
Der Name der Gralsburg wird oft als „Heilsberg“ oder „Wilder Berg“ gedeutet und verweist auf die geographische und spirituelle Abgeschiedenheit des Heiligtums (locus secretus).
Welche Rolle spielt die Zahlensymbolik in Albrechts Beschreibung?
Zahlen bestimmen die Proportionen des Tempels und verweisen auf theologische Konzepte, wie die Dreifaltigkeit oder die Vollkommenheit der göttlichen Schöpfung.
Was stellt die Dreigliedrigkeit des Innenbereiches dar?
Die Zonen (künstliches Meer, Garten, Himmel) spiegeln den Kosmos wider. Der Tempel fungiert somit als Abbild der gesamten Schöpfung unter dem Schutz des Grals.
Gibt es reale architektonische Vorbilder für den Gralstempel?
Wissenschaftler diskutieren Einflüsse zeitgenössischer Kirchenbauten, jedoch bleibt der Tempel primär eine literarische Idee, die über die physische Realität hinausgeht.
- Arbeit zitieren
- MA Sylvia Meyer (Autor:in), 2008, Die Gralsburg in Albrechts "Jüngerem Titurel". Deutung einer Metapher, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147536