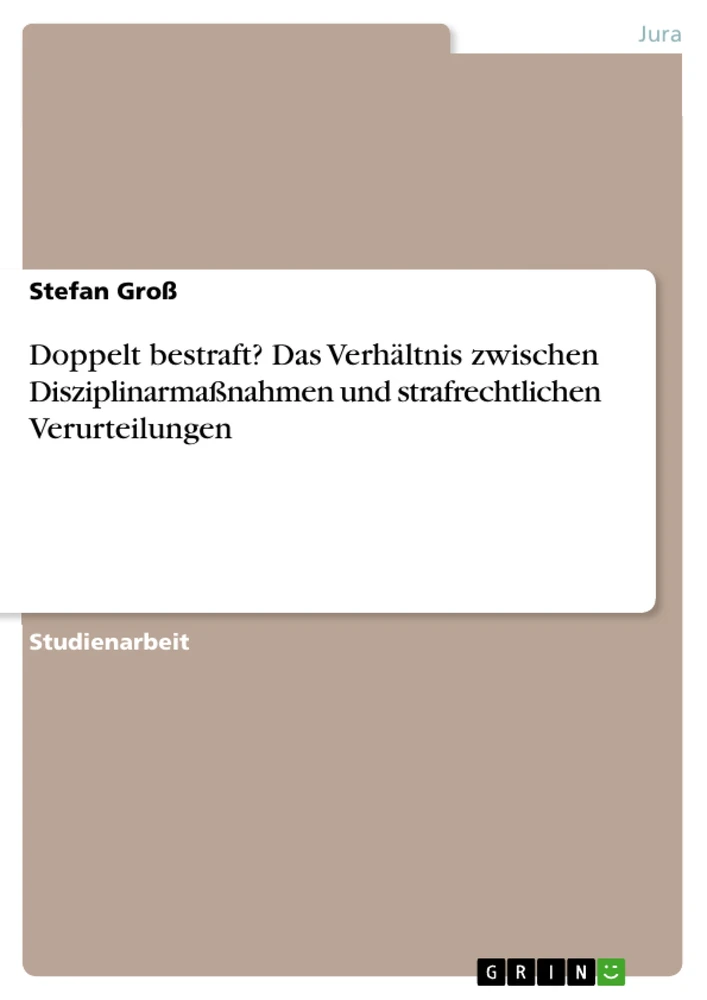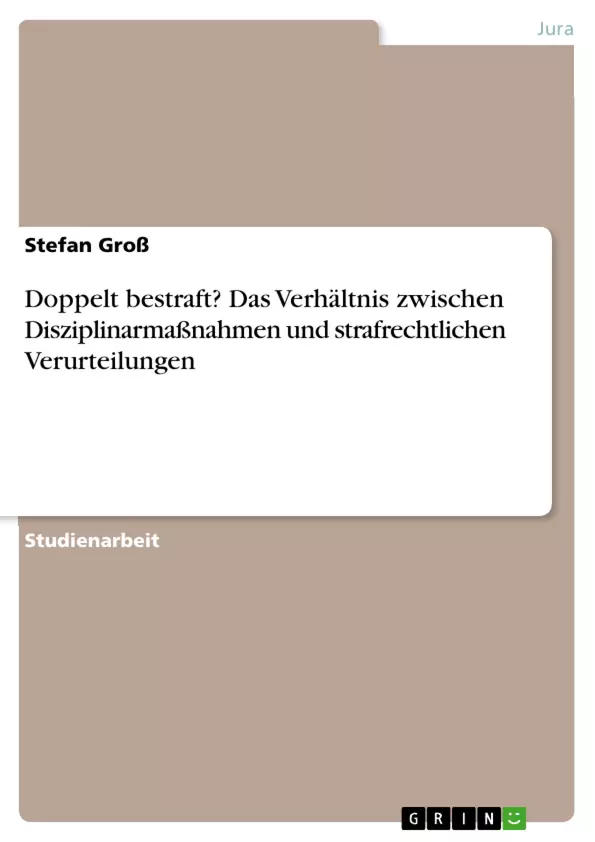Beamte, die aufgrund einer begangenen Straftat verurteilt wurden, sehen in dem anschließenden beamtenrechtlichen Disziplinarverfahren häufig eine weitere Verfolgung und damit eine unzulässige Doppelbestrafung.
Die vorliegende Ausarbeitung beschreibt das Verhältnis einer Strafe aus einem Strafverfahren zu der Sanktionierung aus einem Disziplinarverfahren und der daraus resultierenden hypothetischen Annahme einer Doppelbestrafung. Als Basis dient der Grundsatz ne bis in idem, der als wesentlicher Grundpfeiler im rechtsstaatlichen Gebilde auch in dieser Arbeit einen entsprechend gewichtigen Anteil hat. Zunächst wird das Verbot der Doppelbestrafung kurz erläutert und auf die Verortung im Grundgesetz, sowie dessen Systematik eingegangen. Nach einer begrifflichen Konkretisierung, möglichen Ausnahmen von dem Grundsatz und einer eingehenden Betrachtung seiner Voraussetzungen, wird die Entstehungsgeschichte beleuchtet. Das darauffolgende Kapitel beschäftigt sich mit der Kollision des Straf- und Disziplinarrechts, also deren Zusammenhänge und Abhängigkeiten, sowie Gegenläufigkeiten mit alleinigem Bezug zum Bundesbeamtentum. Thematisiert wird die Zweckbestimmung der beiden Rechtsgebiete, grundsätzliche Verfahrensweisen, wie der Verfolgungsgrundsatz und dessen Aussetzung, Ermittlungsbeschränkungen und etwaige Disziplinarhemmung durch Freispruch. In einer Schlussbetrachtung wird das Verhältnis der Rechtsgebiete zueinander resümiert und auf die Hypothese der Doppelbestrafung eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- A. Grundsatz ne bis in idem
- I. Überblick des Art. 103 Abs. 3 GG
- II. Grundsatz und Systematik
- III. Ausnahmen
- IV. Mehrfachverfolgungsverbot als begriffliche Konkretisierung
- V. Elemente und Anwendungsvoraussetzung
- VI. Entstehung und historischer Verlauf des Mehrfachbestrafungsverbots
- B. Kollision von Straf- und Disziplinarverfahren
- I. Zweckbestimmung des Disziplinar- und Strafrecht
- II. Verfolgungsgrundsatz und dessen Aussetzung
- III. Gesetzliche Ermittlungsbeschränkungen im Disziplinarverfahren
- IV. Die Auswirkungen des Maßnahmenverbots des § 14 Abs. 1 BDG
- V. Keine Disziplinarhemmung durch Freispruch
- VI. Pflichtermahnungsbedürfnis gegenüber dem Beamtem
- C. Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Verhältnis von strafrechtlichen Verurteilungen und disziplinarischen Maßnahmen. Sie analysiert, ob eine Verurteilung aufgrund einer Straftat als Doppelbestrafung im Sinne des Grundsatzes „ne bis in idem“ anzusehen ist, wenn im Anschluss ein disziplinarisches Verfahren eingeleitet wird.
- Grundsatz ne bis in idem
- Kollision von Straf- und Disziplinarrecht
- Zweckbestimmung von Straf- und Disziplinarrecht
- Verfolgungsgrundsatz und Ermittlungsbeschränkungen im Disziplinarverfahren
- Disziplinarhemmung durch Freispruch
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich dem Grundsatz ne bis in idem, seiner Verortung im Grundgesetz und seiner Systematik. Es beleuchtet die Ausnahmen von diesem Prinzip sowie die Entstehung und den historischen Verlauf des Mehrfachbestrafungsverbots.
Das zweite Kapitel analysiert die Kollision von Straf- und Disziplinarrecht im Kontext des Bundesbeamtenrechts. Es thematisiert die Zweckbestimmung der beiden Rechtsgebiete, Verfolgungsgrundsätze, Ermittlungsbeschränkungen im Disziplinarverfahren, die Auswirkungen des Maßnahmenverbots und die Frage, ob ein Freispruch im Strafverfahren zu einer Disziplinarhemmung führt.
Schlüsselwörter
Strafrecht, Disziplinarrecht, ne bis in idem, Doppelbestrafung, Mehrfachverfolgung, Bundesbeamtenrecht, Verfolgungsgrundsatz, Ermittlungsbeschränkungen, Disziplinarhemmung, Freispruch.
- Quote paper
- Stefan Groß (Author), 2023, Doppelt bestraft? Das Verhältnis zwischen Disziplinarmaßnahmen und strafrechtlichen Verurteilungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1475487