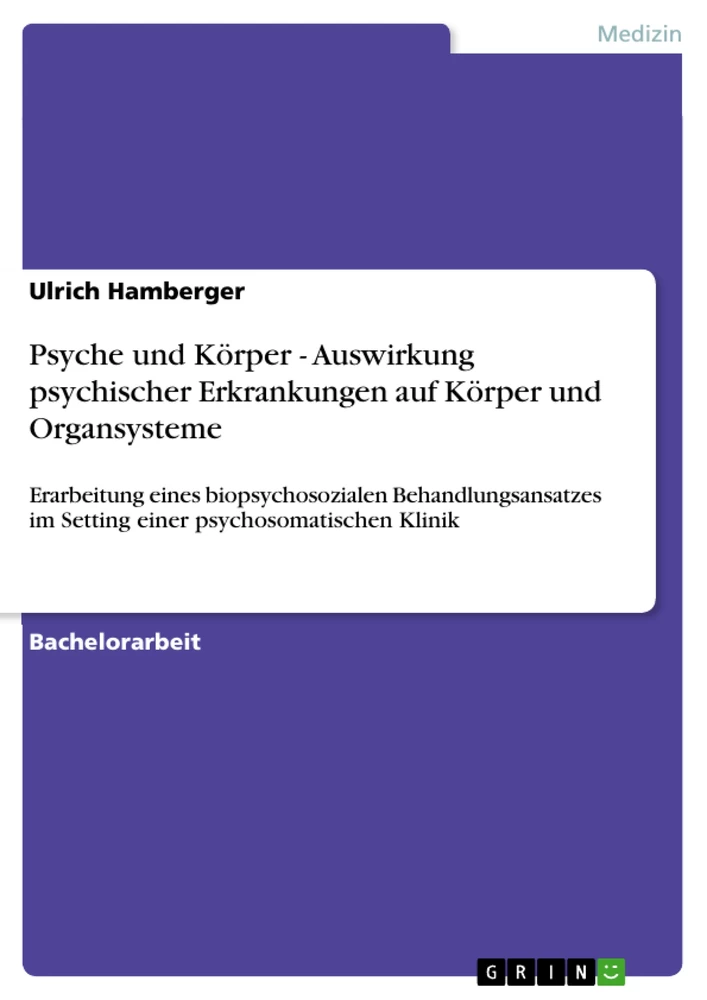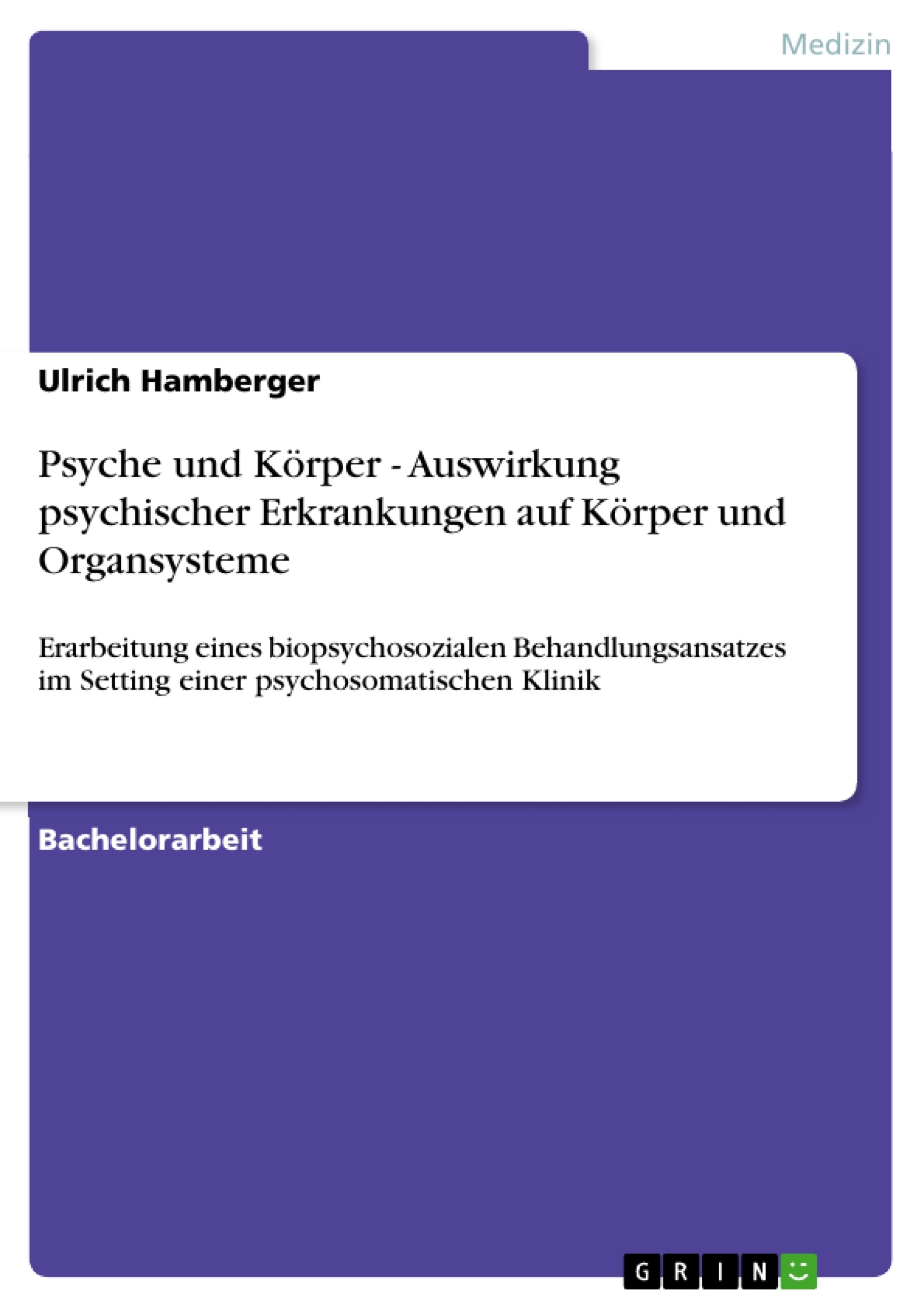Zunehmende Spezialisierung im Gesundheitswesen, vermeintlich aussagekräftige apparative Diagnostik, das Bestreben jede Krankheitsform eindeutig benennen zu müssen, geben medizinische Handlungssicherheit und rechtliche Absicherung. Der
Blick für das Wesentliche jedoch, das menschliche Individuum als Ganzes, geht dadurch verloren. Im Rahmen der klassischen Medizin überwiegt nach wie vor die Tendenz, Erkrankungen entweder der körperlichen, oder der psychischen Seite zuzuordnen. Der Patient erfährt vordergründig Sicherheit in Form einer klaren
Diagnosestellung. Diese wandelt sich jedoch in zunehmende Verunsicherung, wenn sich zu der Einen mehrere, unterschiedliche Diagnosen hinzugesellen. Komorbiditäten sind in der individuellen Krankheitskarriere keine Seltenheit. Zusammenhänge werden weder vom Patienten, noch vom jeweils behandelnden Spezialisten in der Zusammenschau erkannt, bzw. benannt.
Die psychosomatische Medizin, deren Aufgabe das Erkennen und Therapieren psychisch und körperlich einhergehender Krankheitsformen ist, steht nach wie vor im Schatten der Anerkennung klassischer Fachrichtungen im Gesundheitswesen. Gerade komplexe Krankheitsformen können nicht immer eindeutigen Krankheitsbildern zugeordnet werden. In der bürokratischen Ordnung unseres Gesundheitswesens erfolgt eine Anerkennung und somit Kostenerstattung allerdings nur, wenn die Erkrankung der
Klassifikation im Leistungskatalog auch zuordenbar ist. Eine fragwürdige Situation, in der die formelle Korrektheit, das Krankheitsbild bestimmt.
Neben persönlichem Leid verursachen Herz–Kreislauferkrankungen und die epidemieartige Entwicklung im Bereich psychischer Erkankungen, hohen wirtschaftlichen Schaden. Bis zum Jahr 2020 wird die Depression zur zweithäufigsten Krankheitsursache weltweit (vgl. WHO 2006). Treten psychische und physische
Erkrankungen in Kombination auf, vervielfachen sich die Kosten. Unter diesen Voraussetzungen wirksam zu Intervenieren bedeutet, frühzeitig zu Erkennen und adäquat zu Behandeln. Gerade bei der Vergesellschaftung psychischer- und somatischer Erkrankungen ist Dies von großer Wichtigkeit. Denn die Kuration der Einen, kann
schon die Prävention der Anderen bedeuten.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 2 Zielsetzung
- 3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
- 3.1 Verbindung zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen
- 3.2 Neurobiologische Zusammenhänge
- 3.3 Modifizierbare Risikofaktoren und gesundheitliche Auswirkungen
- 3.4 Ökonomische Kennziffern
- 4 Methodik
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Depression und Metabolisches Syndrom
- 5.2 Geeignete Interventionsmassnahmen
- 5.3 Ökonomische Auswirkungen
- 6 Diskussion
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis untersucht die Auswirkungen psychischer Erkrankungen, insbesondere Depression, auf den Körper und verschiedene Organsysteme. Ziel ist die Erarbeitung eines biopsychosozialen Behandlungsansatzes im Kontext einer psychosomatischen Klinik. Die Arbeit betrachtet sowohl die neurobiologischen Zusammenhänge als auch modifizierbare Risikofaktoren und deren ökonomische Implikationen.
- Verbindung zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen (Komorbiditäten)
- Neurobiologische Grundlagen psychischer Erkrankungen und deren körperlicher Manifestationen
- Modifizierbare Risikofaktoren und präventive Interventionsmöglichkeiten
- Ökonomische Aspekte psychischer und somatischer Erkrankungen
- Entwicklung eines biopsychosozialen Behandlungsansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung beleuchtet die zunehmende Spezialisierung im Gesundheitswesen und den daraus resultierenden Verlust des ganzheitlichen Blicks auf den Patienten. Sie kritisiert die Tendenz, Erkrankungen entweder körperlich oder psychisch zuzuordnen, was insbesondere bei Komorbiditäten zu Verunsicherung führt. Die psychosomatische Medizin, die sich mit dem Zusammenspiel psychischer und körperlicher Erkrankungen befasst, wird als unterrepräsentiert dargestellt, wobei die bürokratische Ordnung des Gesundheitswesens eine Rolle spielt. Die hohen wirtschaftlichen Kosten von Herz-Kreislauferkrankungen und psychischen Erkrankungen, insbesondere Depression, werden hervorgehoben, und die Notwendigkeit frühzeitiger Erkennung und adäquater Behandlung wird betont.
3 Gegenwärtiger Kenntnisstand: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen. Es beleuchtet die Verbindung zwischen Depression und metabolischem Syndrom, inklusive Diabetes mellitus und kardiovaskulären Erkrankungen, sowie die damit verbundene Mortalität. Neurobiologische Zusammenhänge, wie Traumatisierung, evolutionsbedingte Mechanismen (HPA-Achse), Neuroplastizität und Hyperkortisolismus, werden detailliert erörtert. Des Weiteren werden modifizierbare Risikofaktoren wie körperliche Aktivität, kognitive Verhaltenstherapie, Ernährung und Medikamente diskutiert, sowie die ökonomischen Aspekte der Erkrankungen und Interventionen beleuchtet.
5 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es wird auf die Ergebnisse der Analyse zum Zusammenhang zwischen Depression und metabolischem Syndrom eingegangen, wobei Depression als Risikofaktor für körperliche internistische Erkrankungen identifiziert wird. Ein neurobiologisches Krankheitsentstehungsmodell wird vorgestellt. Darüber hinaus werden geeignete Interventionsmassnahmen wie körperliche Aktivierung, Verhaltenstherapie, Ernährungsumstellung und Medikation erörtert. Schliesslich werden die ökonomischen Auswirkungen dieser Interventionen bewertet.
Schlüsselwörter
Depression, Metabolisches Syndrom, Psychosomatik, Komorbidität, Neurobiologie, HPA-Achse, Neuroplastizität, Modifizierbare Risikofaktoren, Interventionen, Kosten-Nutzen-Analyse, Biopsychosozialer Ansatz, Gesundheitsmanagement.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelor-Arbeit: Auswirkungen psychischer Erkrankungen auf den Körper
Was ist der Fokus dieser Bachelor-Arbeit?
Diese Bachelor-Arbeit untersucht die Auswirkungen psychischer Erkrankungen, insbesondere Depression, auf den Körper und verschiedene Organsysteme. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung eines biopsychosozialen Behandlungsansatzes im Kontext einer psychosomatischen Klinik. Die Arbeit betrachtet neurobiologische Zusammenhänge, modifizierbare Risikofaktoren und deren ökonomische Implikationen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Verbindung zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen (Komorbiditäten), die neurobiologischen Grundlagen psychischer Erkrankungen und deren körperlicher Manifestationen, modifizierbare Risikofaktoren und präventive Interventionsmöglichkeiten, ökonomische Aspekte psychischer und somatischer Erkrankungen und die Entwicklung eines biopsychosozialen Behandlungsansatzes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung und Problemstellung, Zielsetzung, Gegenwärtiger Kenntnisstand (inkl. Verbindung zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen, neurobiologische Zusammenhänge, modifizierbare Risikofaktoren und ökonomische Kennziffern), Methodik, Ergebnisse (inkl. Depression und Metabolisches Syndrom, geeignete Interventionsmaßnahmen und ökonomische Auswirkungen), Diskussion und Zusammenfassung.
Was sind die Kernergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit identifiziert Depression als Risikofaktor für körperliche internistische Erkrankungen und präsentiert ein neurobiologisches Krankheitsentstehungsmodell. Sie erörtert geeignete Interventionsmaßnahmen wie körperliche Aktivierung, Verhaltenstherapie, Ernährungsumstellung und Medikation und bewertet deren ökonomische Auswirkungen. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung eines biopsychosozialen Behandlungsansatzes.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Depression, Metabolisches Syndrom, Psychosomatik, Komorbidität, Neurobiologie, HPA-Achse, Neuroplastizität, Modifizierbare Risikofaktoren, Interventionen, Kosten-Nutzen-Analyse, Biopsychosozialer Ansatz, Gesundheitsmanagement.
Welche Kritikpunkte werden in der Einleitung angesprochen?
Die Einleitung kritisiert die zunehmende Spezialisierung im Gesundheitswesen, den Verlust des ganzheitlichen Blicks auf den Patienten und die Tendenz, Erkrankungen entweder körperlich oder psychisch zuzuordnen. Die Unterrepräsentation der psychosomatischen Medizin und die hohen wirtschaftlichen Kosten von Herz-Kreislauferkrankungen und psychischen Erkrankungen werden hervorgehoben.
Was wird im Kapitel "Gegenwärtiger Kenntnisstand" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen. Es beleuchtet die Verbindung zwischen Depression und metabolischem Syndrom, neurobiologische Zusammenhänge (Traumatisierung, HPA-Achse, Neuroplastizität, Hyperkortisolismus), modifizierbare Risikofaktoren und die ökonomischen Aspekte.
- Quote paper
- Ulrich Hamberger (Author), 2008, Psyche und Körper - Auswirkung psychischer Erkrankungen auf Körper und Organsysteme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147612