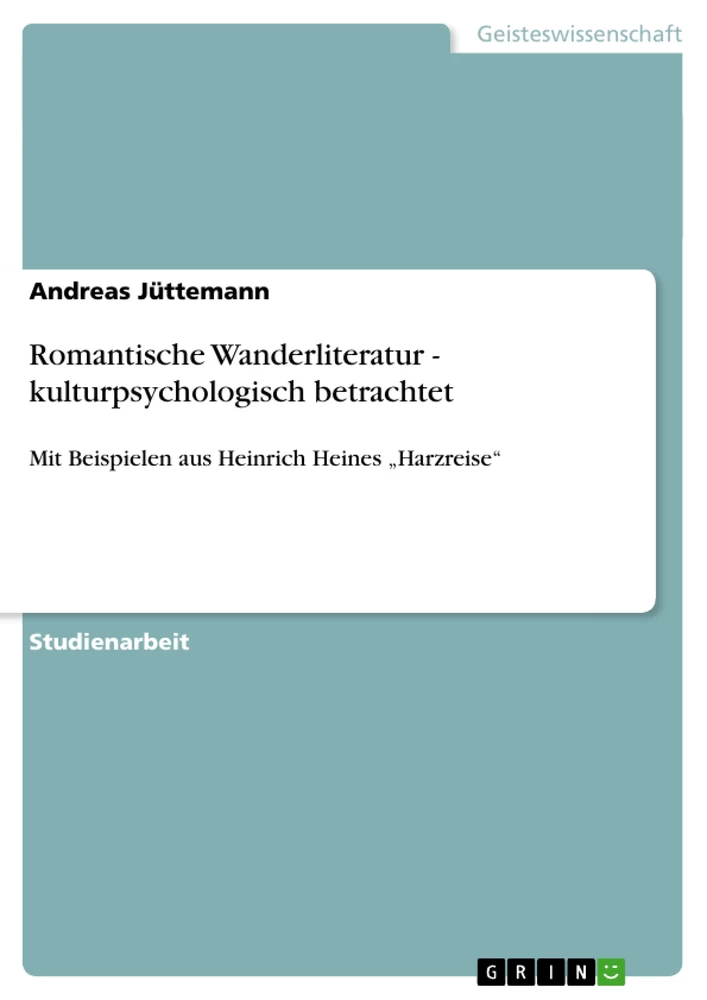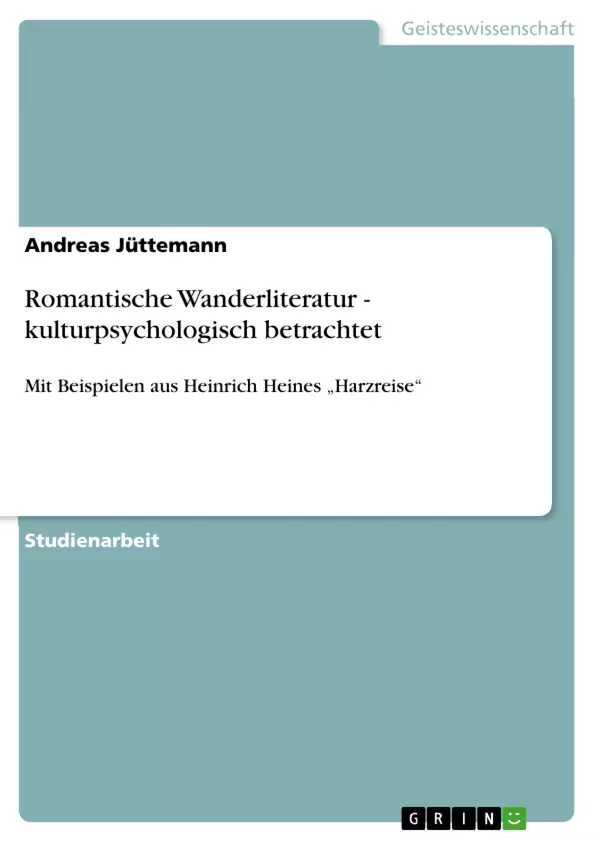Für den Beginn des Zeitalters der zweckfreien Wanderung wird ein festes Datum angegeben. Im Jahre 1336 bestieg Francesco Petrarca mit seinem Bruder den Mont Ventoux in der Provence und verfasste darüber eine Erzählung, die große Beachtung fand und die auch heute noch als ausschlaggebend für die Entstehung eines neuen Naturgefühls sowie einer damit verbundenen Bewegungsform verstanden wird.
Als literarisches Element existiert das „Wandermotiv“ seit der Frühromantik (etwa 1795 bis 1804). Zu dieser Zeit wurde das Wandern als eine Möglichkeit der Lebensgestaltung wiederentdeckt. In der Literatur zeigte sich dies an ersten Veröffentlichungen mit einem Wanderer als Protagonisten.
Inhaltsverzeichnis
- Die Geschichte des Wanderns
- In der Antike
- Von der Waldfahrt zur Wallfahrt
- Die Tradition der Handwerksburschen: Die Walz
- Die „zweckfreie“ Wanderung
- Das „Wandermotiv“ in der Romantik
- Die Wanderung als Suche
- Die Wanderung als Abschied
- Das Wandermotiv heute
- Heines „Reisebilder“
- Heines „Harzreise“
- Das universitäre Milieu
- Der Aspekt der Naturbegeisterung
- Gesellschaftkritische Elemente
- Philosophische Implikationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Wanderliteratur der Romantik aus kulturpsychologischer Sicht. Er untersucht das „Wandermotiv“ als literarisches Element und seine Entwicklung von der Antike bis ins 19. Jahrhundert. Dabei werden die verschiedenen Facetten des Wanderns, wie die Suche nach Selbstfindung, der Abschied von der Zivilisation und die Naturbegeisterung, beleuchtet. Der Text stellt die „Harzreise“ von Heinrich Heine als Beispiel für romantische Wanderliteratur vor und analysiert ihre gesellschaftkritischen und philosophischen Implikationen.
- Die Entwicklung des Wanderns als kulturelles Phänomen
- Das „Wandermotiv“ in der romantischen Literatur
- Die „Harzreise“ von Heinrich Heine als Beispiel für romantische Wanderliteratur
- Naturbegeisterung und Gesellschaftskritik in der romantischen Wanderliteratur
- Philosophische Implikationen des „Wandermotivs“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Geschichte des Wanderns
Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung des Wanderns von der Antike bis zum 19. Jahrhundert. Es beleuchtet die verschiedenen Wandertypen, wie z.B. die Waldfahrt, die Wallfahrt und die Handwerksgesellen-Walz. Weiterhin wird die Entstehung der „zweckfreien“ Wanderung im 14. Jahrhundert mit Francesco Petrarcas Besteigung des Mont Ventoux in Verbindung gebracht.
Das „Wandermotiv“ in der Romantik
Dieses Kapitel fokussiert auf die Bedeutung des Wanderns in der Romantik. Es werden die verschiedenen Bedeutungen des „Wandermotivs“ in der Literatur der Zeit beleuchtet, wie z.B. die Suche nach Selbstfindung, der Abschied von der Zivilisation und die Naturbegeisterung. Es werden auch die Verbindungen des Wanderns zu religiösen und gesellschaftlichen Themen der Romantik dargestellt.
Heines „Reisebilder“
(Zusammenfassung fehlt, da der Text keine konkreten Informationen zu Heines „Reisebilder“ bietet.)
Heines „Harzreise“
Dieses Kapitel analysiert Heinrich Heines „Harzreise“ als Beispiel für romantische Wanderliteratur. Es werden die verschiedenen Aspekte der Reise, wie z.B. das universitäre Milieu, die Naturbegeisterung und die gesellschaftkritischen Elemente, beleuchtet. Weiterhin werden die philosophischen Implikationen der „Harzreise“ diskutiert.
Schlüsselwörter
Romantische Wanderliteratur, „Wandermotiv“, Heinrich Heine, „Harzreise“, Naturbegeisterung, Gesellschaftskritik, Selbstfindung, Abschied, Kulturpsychologie, Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Wann begann die Geschichte des „zweckfreien“ Wanderns?
Als Geburtsstunde gilt das Jahr 1336, in dem Francesco Petrarca den Mont Ventoux bestieg und darüber eine Erzählung verfasste, die ein neues Naturgefühl begründete.
Welche Bedeutung hat das „Wandermotiv“ in der Romantik?
In der Romantik (ca. 1795–1804) symbolisiert das Wandern die Suche nach Selbstfindung, den Abschied von der Zivilisation und eine tiefe Sehnsucht nach Natur.
Warum wird Heinrich Heines „Harzreise“ als Beispiel herangezogen?
Heines „Harzreise“ ist ein klassisches Werk der Wanderliteratur, das Naturbegeisterung mit scharfer Gesellschaftskritik und philosophischen Reflexionen verbindet.
Welche historischen Wandertypen werden im Text unterschieden?
Der Text beleuchtet verschiedene Formen wie die Waldfahrt der Antike, die religiöse Wallfahrt und die traditionelle Walz der Handwerksburschen.
Was ist der kulturpsychologische Aspekt des Wanderns?
Es wird untersucht, wie die Bewegung durch die Natur als Ausdruck innerer Zustände, wie Sehnsucht oder Flucht aus gesellschaftlichen Zwängen, verstanden werden kann.
Welche Rolle spielt das universitäre Milieu in Heines Werk?
In der „Harzreise“ nutzt Heine seine Wanderung, um das steife und verkrustete universitäre Milieu seiner Zeit kritisch und satirisch zu kommentieren.
- Arbeit zitieren
- Andreas Jüttemann (Autor:in), 2008, Romantische Wanderliteratur - kulturpsychologisch betrachtet, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147728