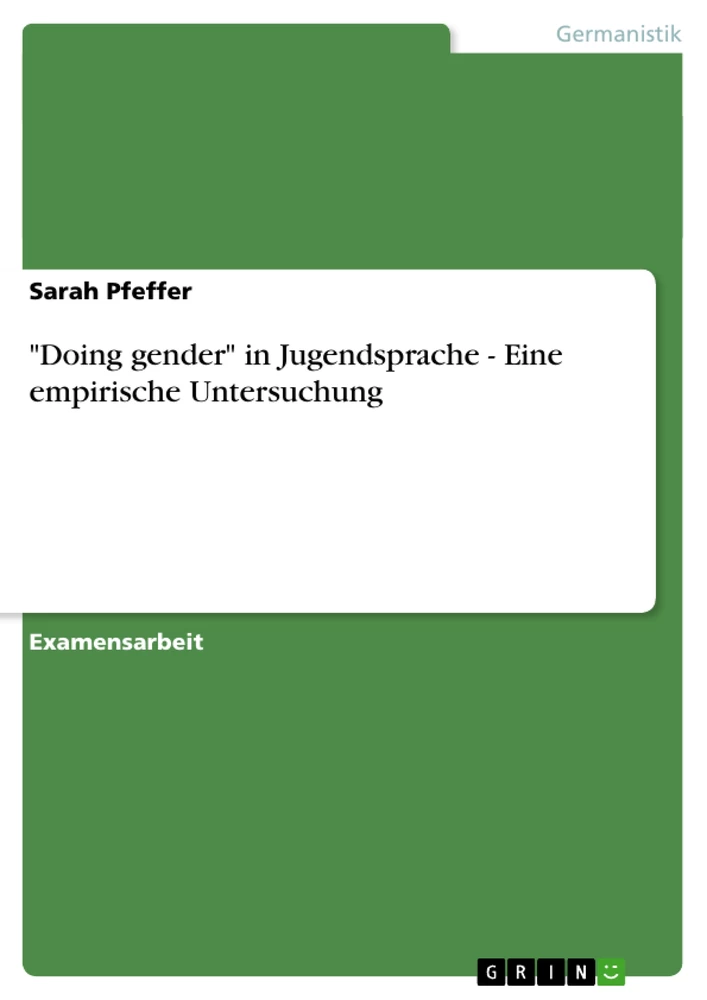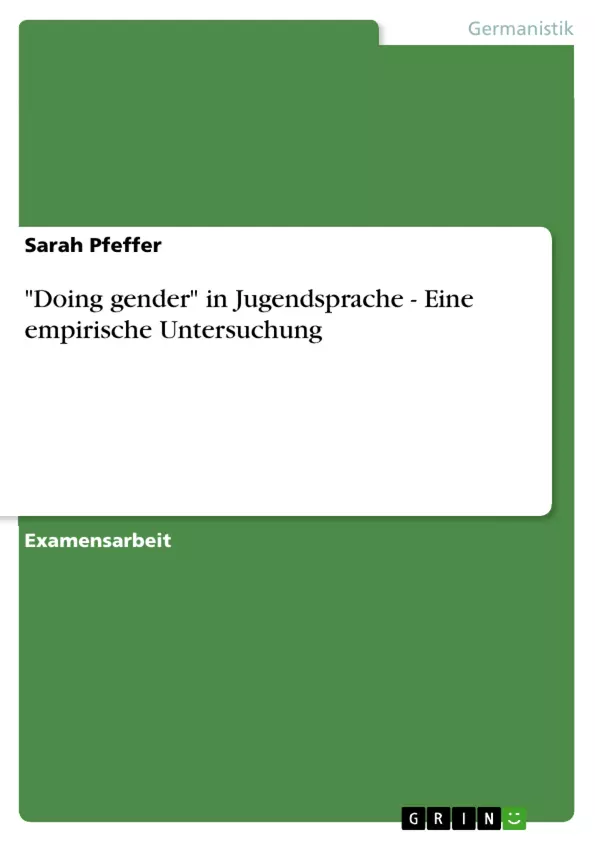Wo Jugendliche sind, ist Jugendsprache allgegenwärtig. Oft wird sie von Eltern und
Pädagogen mit Naserümpfen abgestraft. Werden sie Jugendsprache so gerecht? Was
macht sie unter Jugendlichen so beliebt? Diese Arbeit betrachtet Jugendsprache unter
einer anderen Prämisse: Als linguistischen Forschungsgegenstand, der ein kreatives
Sprachspiel Jugendlicher darstellt und dem ein nicht zu unterschätzender Einfluss auf
die Standard- und Umgangssprache eingeräumt werden muss.
Neben der Beschreibung und Analyse jugendsprachlicher Merkmale und deren
Funktionen rücken seit Ende der 80er Jahre auch „pragmatisch-diskursive
Besonderheiten“ (Spreckels 2005: 54) von Jugendsprache in den Fokus der Analysen.
Hierbei wird die Notwendigkeit eines empirisch-ethnographischen Ansatzes in Bezug
auf Jugendsprache in den letzten Jahren verstärkt vertreten (vgl. Androutsopoulos 1998:
592, Schlobinski et al. 1993: 40, Neuland 1987). Wenig Berücksichtigung findet in der
Forschung bislang die Frage nach der Existenz genderspezifischer Jugendsprache, die
im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht. Wird Jugendsprache genderspezifisch
generiert? Gibt es unterschiedliche Ausdrucksweisen von Mädchen und Jungen? Die
Frage nach genderspezifisch markierter Jugendsprache und die Analyse von
Einschätzungen Jugendlicher zu diesem Thema ist unter anderem deswegen so
interessant, weil die Jugendlichen sich in der Lebensphase der Adoleszenz befinden, in
der sich in besonderem Maß die Geschlechtsidentität und die Übernahme weiblichen
und männlichen Rollenverhaltens ausbildet (vgl. Spreckels 2005: 31). Deshalb soll die
folgende Hypothese in dieser Arbeit überprüft werden: Vor den empirischen Analysen
steht die Vermutung, dass sich unterschiedliche Entwürfe von Geschlechtsidentität in
jugendsprachlichen Daten manifestieren. Es ist zu erwarten, dass diese Entwürfe in
bedeutendem Maß sowohl Sprache als auch Gesprächsverhalten von Jungen und
Mädchen beeinflussen und so gewissermaßen genderspezifische Jugendsprache
mitbegründen.
Die Arbeit teilt sich in zwei Abschnitte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theoretischer Rahmen und zentrale Begriffe
- II.1. Jugend und Identität
- II.2. Jugendkultur
- II.3. Jugendsprache
- II.3.1. Funktionen von Jugendsprache
- II.3.2. Jugendsprachliche Merkmale
- II.3.2.1. Gegenseitige Anreden
- II.3.2.2. Vulgär- und Sexualsprache
- II.3.2.3. Vagheitsmarker
- II.3.2.4. Ethnolektgebrauch als jugendsprachliches Merkmal?
- II.4. Genderspezifische Kommunikation
- II.4.1. Stereotype
- II.4.2. Das konstruktivistische doing gender-Konzept
- II.4.3. Sprachgebrauch und Gesprächsverhalten von Frauen und Männern
- II.5. Sprachkonvergenz- und Sprachdivergenzprozesse
- III. Empirische Untersuchung
- III.1. Erhebung und Auswertung der Daten
- III.2. Teilnehmer
- III.3. Aufnahmebedingungen und Ablauf
- III.4. Diskussionsgrundlagen
- III.5. Fragebogen
- IV. Ergebnisse
- IV.1. Auswertung des Fragebogens
- IV.1.1. Jugendsprache und genderspezifische Jugendsprache
- IV.1.2. Ethnolekt - Kenntnis und Gebrauch
- IV.2. Thematisierung von Geschlechter-Stereotypen im Gespräch
- IV.3. Vulgär- und Sexualsprache
- IV.4. Vagheitsmarker
- IV.5. Gegenseitige Anreden
- IV.6. Ethnolektgebrauch
- IV.7. Konvergenz- oder Divergenzprozesse in der gemischtgeschlechtlichen Probandengruppe?
- IV.7.1. Vulgär- und Sexualsprache
- IV.7.2. Vagheitsmarker
- IV.7.3. Gegenseitige Anreden
- IV.7.4. Ethnolektgebrauch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und wie sich genderspezifische Aspekte in Jugendsprache manifestieren. Sie untersucht, ob sich unterschiedliche Entwürfe von Geschlechtsidentität in jugendsprachlichen Daten widerspiegeln und wie diese Entwürfe Sprache und Gesprächsverhalten von Jungen und Mädchen beeinflussen.
- Analyse genderspezifischer Merkmale in Jugendsprache
- Untersuchung der Funktionen von Jugendsprache
- Bedeutung von Jugendsprache für die Entwicklung der Standard- und Umgangssprache
- Einfluss von Geschlechtsidentität auf Sprachgebrauch und Gesprächsverhalten
- Konvergenz- und Divergenzprozesse in der Kommunikation von Jungen und Mädchen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Jugendsprache ein und stellt die Forschungsfrage nach der Existenz genderspezifischer Jugendsprache. Der theoretische Rahmen beleuchtet die Konzepte von Jugend, Identität, Jugendkultur und Jugendsprache sowie die Bedeutung von genderspezifischer Kommunikation und dem „doing gender"-Konzept. Die empirische Untersuchung beschreibt die Erhebung und Auswertung der Daten, die Teilnehmer und die Vorgehensweise. Die Ergebnisse analysieren die Auswertung des Fragebogens, die Thematisierung von Geschlechter-Stereotypen im Gespräch, Vulgär- und Sexualsprache, Vagheitsmarker, gegenseitige Anreden, Ethnolektgebrauch und Konvergenz- oder Divergenzprozesse in der gemischtgeschlechtlichen Probandengruppe.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, genderspezifische Kommunikation, doing gender, Geschlechtsidentität, Sprachgebrauch, Gesprächsverhalten, Konvergenz, Divergenz, Vulgärsprache, Sexualsprache, Vagheitsmarker, Ethnolekt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Forschungsgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Jugendsprache unter linguistischen Gesichtspunkten, insbesondere als kreatives Sprachspiel und deren Einfluss auf die Standard- und Umgangssprache.
Welche Rolle spielt das Geschlecht in der Jugendsprache?
Im Zentrum steht die Frage nach der Existenz genderspezifischer Jugendsprache und ob Mädchen und Jungen unterschiedliche Ausdrucksweisen verwenden.
Was bedeutet das Konzept des „Doing Gender“ in diesem Kontext?
Es beschreibt die soziale Konstruktion von Geschlecht durch Sprache und Gesprächsverhalten, was besonders in der Adoleszenz zur Ausbildung der Geschlechtsidentität beiträgt.
Welche sprachlichen Merkmale werden empirisch untersucht?
Untersucht werden unter anderem gegenseitige Anreden, Vulgär- und Sexualsprache, Vagheitsmarker sowie der Gebrauch von Ethnolekten.
Welcher methodische Ansatz wird in der Untersuchung verfolgt?
Die Arbeit nutzt einen empirisch-ethnographischen Ansatz, der Daten durch Fragebögen und Gesprächsanalysen erhebt.
Was wird unter Sprachkonvergenz und -divergenz verstanden?
Es wird analysiert, ob sich die Sprache von Jungen und Mädchen in gemischtgeschlechtlichen Gruppen angleicht (Konvergenz) oder voneinander entfernt (Divergenz).
- Arbeit zitieren
- Sarah Pfeffer (Autor:in), 2009, "Doing gender" in Jugendsprache - Eine empirische Untersuchung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147734