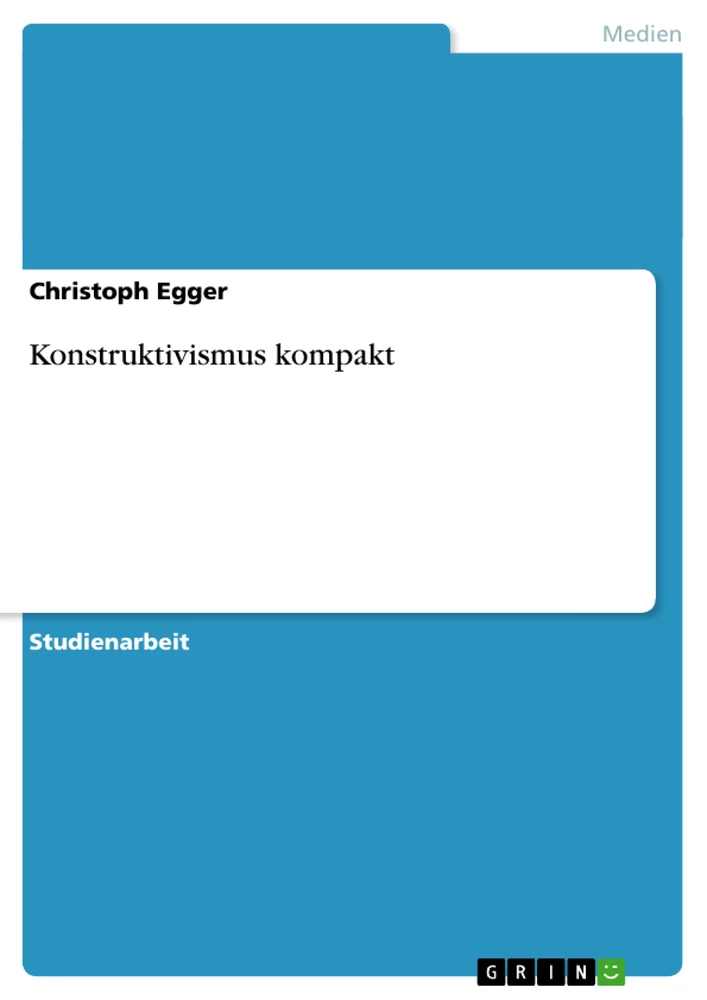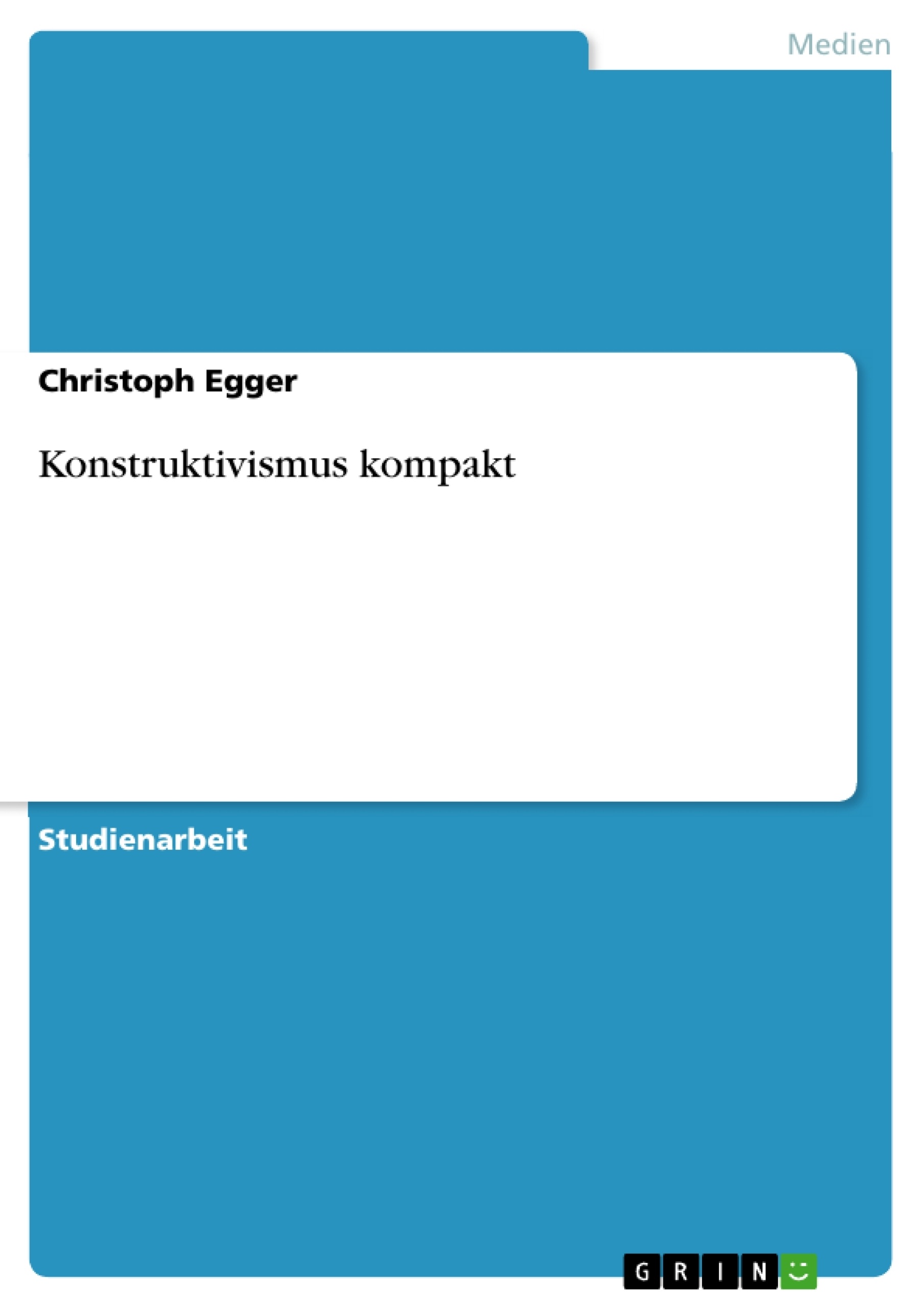„Ich seh´ etwas, was du nicht siehst …“
Diese Arbeit bietet neben einer Textreflexion einen kurzen Ausflug in die Welt des Konstruktivismus – kurz, kompakt und einfach konstruiert.
Inhaltsverzeichnis
Textreflexion „Konstruktivistische Medientheorien“
Das Individuum und seine Umwelt
Konstruktivismus und andere Theorien
Konstruktivismus im Kontext der Medienwirklichkeit
Literatur
Textreflexion „Konstruktivistische Medientheorien“
Mit dem Text „Konstruktivistische Medientheorien“ erstellt der Autor Stefan Weber einen übersichtlichen Abriss zur Theorie und Entwicklung des Konstruktivismus. Zu Beginn des Textes wird anhand der Vertreter vom Konstruktivismus auf die geschichtliche Entwicklung eingegangen und der Grundgedanke skizziert: Wird die Realität von uns gebildet oder ist sie bereits vorhanden? In diesem Zusammenhang stellt er den Realismus (Theorie des Gegebenen) gegenüber dem Konstruktivismus (Theorie des Erzeugten). Als wichtigste Vertreter werden Wissenschaftler aus den Bereichen Philosophie, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften genannt.
Im nächsten Teil des Textes setzt sich Weber mit den Grundbegriffen und Modellen auseinander. Zu den Grundbegriffen zählt er: „Beobachter, Wirklichkeit versus Realität, Konstruktion“ (Weber 2003, 184) und ergänzt diese weiterführend mit „Autopoiesis, Autokonstitution, strukturelle Kopplung, operationale Geschlossenheit, semantische Selbstreferentialität, Viabilität “ (Weber 2003, 185). Bei den Modellen greift er unter anderem das Erkenntnismodell von Gerhard Roth auf, das aus Körperwelt, Ichwelt und Umwelt besteht, die, von einem als realen gegebenen Gehirn aus, differenziert werden. Abschließend beschäftigt sich Weber mit der theoretischen und empirischen Anwendung in der Medienwissenschaft und differenziert dabei interpersonelle Kommunikation, Journalistik und Massenmedien. (Vgl. Weber 2003, 180-197)
Nach diesem Abstract wird jetzt anhand des Basistheorems vom Konstruktivismus: „Menschen konstruieren ihre Wirklichkeit subjektiv und eigenverantwortlich“ (Merten 1995, 9) der Bereich vom Individuum und seiner Umwelt näher behandelt. Anschließend werden Verbindungen zu anderen Theorien erstellt und Vergleiche gezogen. Am Ende wird der Konstruktivismus im Kontext der Medienwirklichkeit reflektiert. Die daraus entstehenden Fragen werden in dieser Arbeit Antwort finden – oder auch nicht.
Das Individuum und seine Umwelt
Ist der Konstruktivismus ein Fluch oder ein Segen?
Grundsätzlich hat jeder Mensch die Möglichkeit seine eigene Wirklichkeit zu bilden – diese zu erweitern, ergänzen oder zu verändern. Durch diese Annahme könnten Menschen drei Eigenschaften besitzen: Erstens wären sie frei. Denn mit dem Wissen über die Wirklichkeit bestimmen zu können, kann man sie jederzeit ändern. Damit ergibt sich automatisch die zweite Eigenschaft: Verantwortung. Wenn jemand begriffen hat, dass er seine eigene Wirklichkeit bestimmt – bestimmt er zugleich den Pfad seines Gewissens. (Vgl. Watzlawick 1994, 74f) Als Autohersteller wäre es beispielsweise einfacher und kostensparend, wenn man auf langwierige Sicherheitstests verzichten würde. Erst der ethische Grundgedanke wird den Konstrukteur anspornen, mit größtem Einsatz ein sicheres Auto zu bauen; hängt doch von seiner Verantwortung das Leben andere ab. Die dritte Eigenschaft wäre ein versöhnliches, auf Harmonie ausgerichtetes Verhalten, nach der ständigen Suche des gemeinsamen Konsenses (vgl. Watzlawick 1994, 75). Diese Annahme von Watzlawick entspricht ungefähr der des wahren Konsenses von Habermas: Theoretisch ist es möglich; es lässt sich praktisch kaum finden. Watzlawick ist dieser Umstand bewusst: „Natürlich gibt es solche Menschen sehr, sehr selten. Ich habe in meinem Leben zwei getroffen, die vermutlich an dem Punkt angekommen waren.“ (Watzlawick 1994, 75)
Die Frage, ob der Umstand – wenn jemand begriffen hat, dass er seine eigene Wirklichkeit konstruieren kann – zum Fluch oder ein Segen wird, hängt somit von der Wirklichkeit ab, die er sich zum Zeitpunkt der gestellten Frage konstruiert.
Konstruktivismus und andere Theorien
„Im Scheitern einer Hypothese über die Wirklichkeit erfahren wir, daß diese Hypothese falsch ist.“ (Watzlawick 1991, 34) Diese Aussage Watzlawicks bezieht sich auf die Theorie von Glasersfeld bei der man bestenfalls über die Wirklichkeit das wissen kann, was sie nicht ist. Aus der Sicht der Evolutionstheorie stirbt eine Gattung dann aus, wenn sie sich an die Begebenheit ihrer Wirklichkeit nicht mehr anpassen kann. Damit bezieht sich Glasersfeld auf Darwins Begriff: „survival of the fittest“ und stellt fest, dass nicht der Tüchtigste – wie angenommen – überlebt, sondern derjenige, der sich anpassen kann; „fit“ im Sinne von „passen“. (Vgl. Watzlawick 1991, 34f) Das bedeutet: Konstruktionen bleiben so lange erhalten, bis sie nicht mehr passen. Oder anders: Wirklichkeiten verändern sich erst, wenn sie keinem Geltungsanspruch mehr nachkommen. Womit sich eine längst überfällige Frage stellt: Kann man etwas über die wirkliche Wirklichkeit erfahren?
Das Falsifikationsprinzip von Popper beschreibt in diesem Zusammenhang, dass man nur dann über die wirkliche Wirklichkeit etwas erfahren kann, wenn die Methode zur Erforschung dieser Wirklichkeit zusammenbricht – womit gemeint ist, dass die wissenschaftliche Erkenntnissuche stehen bleibt. (Vgl. Girgensohn-Marchand 1992, 88) Um hier nicht in einer Sackgasse zu landen, sollten wir nach der Voraussetzung fragen, die es uns überhaupt ermöglicht, eine Wirklichkeit zu konstruieren.
Ein Aspekt des Konstruktivismus in diesem Kontext ist die Selektivität (vgl. Merten 1995, 8). Erst wenn man in der Lage ist etwas Auszuwählen ist man auch in der Lage etwas zu konstruieren. Das führt weitergehend zu kognitiven Mechanismen (Einstellung, Erwartung, Erinnerung) und zur Kognitionstheorie. Diese beschäftigt sich damit, wie Menschen zu ihren Erkenntnissen kommen – die Erkenntnistheorie hingegen wie man damit umgehen sollte (vgl. Girgensohn-Marchand 1992, 90).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Textreflexion „Konstruktivistische Medientheorien“?
Die Textreflexion von Stefan Weber bietet einen Überblick über die Theorie und Entwicklung des Konstruktivismus, wobei der Fokus auf der Frage liegt, ob Realität von uns konstruiert wird oder bereits existiert. Der Text stellt den Realismus (Theorie des Gegebenen) dem Konstruktivismus (Theorie des Erzeugten) gegenüber und nennt wichtige Vertreter aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen.
Welche Grundbegriffe des Konstruktivismus werden im Text erläutert?
Zu den Grundbegriffen zählen: Beobachter, Wirklichkeit versus Realität, Konstruktion, Autopoiesis, Autokonstitution, strukturelle Kopplung, operationale Geschlossenheit, semantische Selbstreferentialität und Viabilität. Der Text greift auch das Erkenntnismodell von Gerhard Roth auf, das aus Körperwelt, Ichwelt und Umwelt besteht.
Wie wird der Konstruktivismus im Kontext der Medienwissenschaft betrachtet?
Der Text differenziert die Anwendung des Konstruktivismus in der Medienwissenschaft in Bezug auf interpersonelle Kommunikation, Journalistik und Massenmedien.
Welche Rolle spielt die subjektive Wirklichkeitskonstruktion im Konstruktivismus?
Der Text betont, dass Menschen ihre Wirklichkeit subjektiv und eigenverantwortlich konstruieren. Dies führt zu Überlegungen über Freiheit, Verantwortung und das Streben nach Harmonie.
Ist der Konstruktivismus eher ein Fluch oder ein Segen?
Ob der Konstruktivismus ein Fluch oder ein Segen ist, hängt von der konstruierten Wirklichkeit der Person ab. Wenn jemand sich der Möglichkeit der eigenen Wirklichkeitskonstruktion bewusst ist, ist sein Verhalten davon abhängig, welche Wirklichkeit er sich zu dem Zeitpunkt konstruiert hat.
Wie hängt der Konstruktivismus mit anderen Theorien zusammen?
Der Text stellt Verbindungen zur Evolutionstheorie (Anpassungsfähigkeit), zum Falsifikationsprinzip von Popper (Erkenntnis durch Scheitern), zur Kognitionstheorie (Erkenntnisgewinnung), zur Theorie "Tabula rasa" (unbeschriebenes Blatt) und zur Systemtheorie von Luhmann (geschlossene Systeme) her. Die Selektivität wird als wichtiger Aspekt für die Konstruktion von Wirklichkeit hervorgehoben.
- Quote paper
- Christoph Egger (Author), 2006, Konstruktivismus kompakt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147744