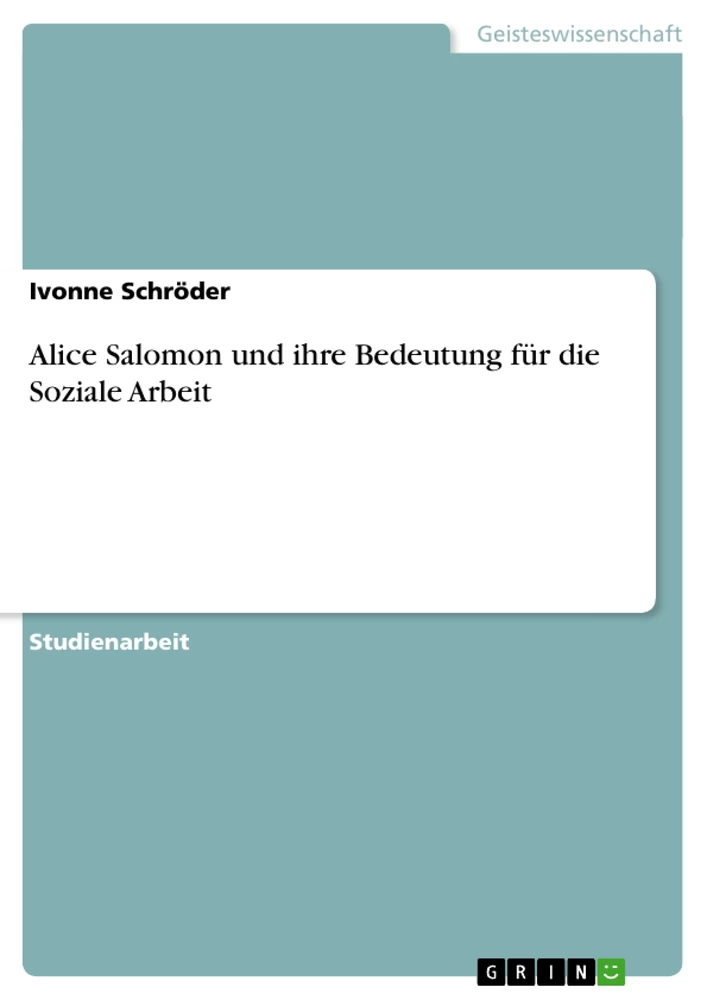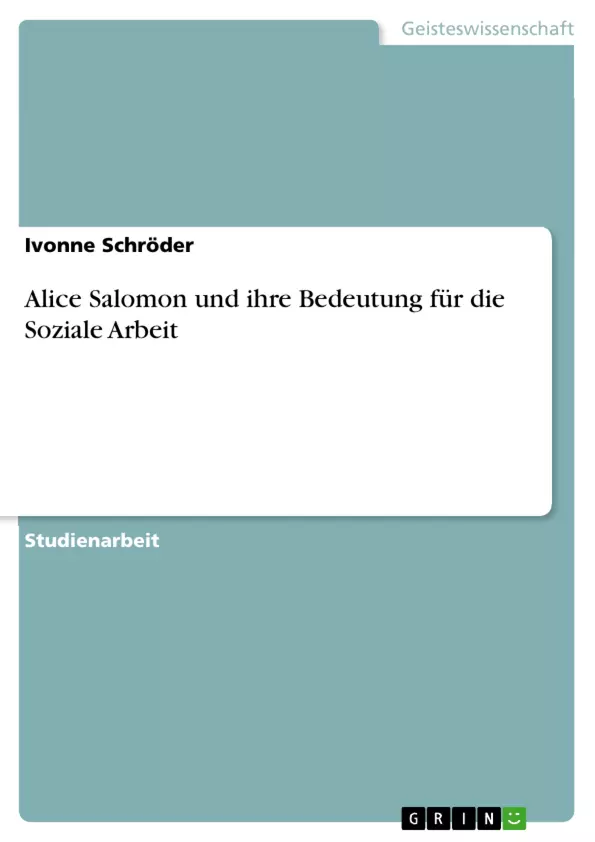Alice Salomon ist eine der bekanntesten Frauen, die die Soziale Arbeit als Wissenschaft geprägt hat. Ihre Werke beschäftigen sich mit der Professionalisierung Sozialer Arbeit und der Frauenbewegung. Außerdem war sie eine der ersten deutschen Frauen, die promovierte und dennoch wird sie oft vernachlässigt. Ich möchte mich in dieser Arbeit näher mit ihr auseinandersetzen. Mein Thema lautet: Alice Salomon und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit.
Im ersten Teil meiner Arbeit werde ich mich mit Alice Salomons Biografie auseinandersetzen. Dabei gehe ich als erstes auf ihr Elternhaus, ihre Kindheit und Jugend ein. Zweitens beschreibe ich den Wendepunkt in ihrem Leben. Drittens widme ich mich ihrem Studium und ihrer Promotion. Viertens gehe ich auf Alice Salomons Soziale Frauenschule und ihre internationale Karriere ein. Als fünften und letzten Punkt betrachte ich dann ihre Entlassung aus allen öffentlichen Ämtern und ihre Emigration bis zu ihrem Tod.
Im zweiten Teil meiner Arbeit gehe ich dann auf Alice Salomons Bedeutung für die Soziale Arbeit ein. Dabei werde ich als erstes die Netzwerke von Alice Salomon betrachten. Zweitens gehe ich auf den Zeitgeist ein. Drittens wende ich mich der Theorie der Chicagoer Schule und ihre Bedeutung für Alice Salomon zu. Als vierten Punkt betrachte ich dann genauer ihren Beitrag für die Entwicklung der Wissenschaft, wobei ich auf ihre Theorie des Helfens, ihre theoretischen und ethischen Grundlagen eingehen
werden, sowie auf Soziale Arbeit und Geschlecht und Soziale Arbeit als Profession. Im dritten Teil meiner Arbeit, der Schlussbetrachtung, werde ich zusammenfassend und abschließend Alice Salomons Bedeutung für die Soziale Arbeit darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Biografie Alice Salomon
- 1.1 Elternhaus, Kindheit und Jugend (1872-1892)
- 1.2 Der Wendepunkt (1893-1901)
- 1.3 Studium und Promotion (1902-1907)
- 1.4 Soziale Frauenschule und internationale Karriere (1908-1932)
- 1.5 Entlassung aus allen öffentlichen Ämtern und Emigration bis zu ihrem Tod (1933-1948)
- 2. Alice Salomons Bedeutung für die Soziale Arbeit
- 2.1 Netzwerke von Alice Salomon
- 2.2 Zeitgeist
- 2.3 Theorie der Chicagoer Schule
- 2.4 Beitrag für die Entwicklung der Wissenschaft
- 2.4.1 Zur Theorie des Helfens
- 2.4.2 Theoretische und ethische Grundlagen in Alice Salomons Begriff von Sozialer Arbeit
- 2.4.3 Soziale Arbeit und Geschlecht
- 2.4.4 Soziale Arbeit als Profession
- 3. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Leben und Wirken von Alice Salomon und ihren Einfluss auf die Soziale Arbeit. Ziel ist es, Salomons Bedeutung für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit und ihre Rolle im Kontext des damaligen Zeitgeistes zu beleuchten. Die Arbeit analysiert ihre Biografie, ihre Netzwerke und ihren Beitrag zur Theoriebildung in der Sozialen Arbeit.
- Alice Salomons Biografie und ihre persönlichen Entwicklungen
- Salomons Beitrag zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit
- Der Einfluss des Zeitgeistes auf Salomons Wirken
- Salomons theoretische und ethische Grundlagen der Sozialen Arbeit
- Die Bedeutung von Netzwerken für Salomons Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Biografie Alice Salomon: Dieses Kapitel skizziert das Leben von Alice Salomon, beginnend mit ihrer wohlhabenden, jüdischen Familie in Berlin. Es beschreibt ihre Kindheit, die geprägt war von dem frühen Tod des Vaters und dem daraus resultierenden Verlust des gewohnten Lebensstandards. Der Abschnitt beleuchtet ihren schwierigen Übergang ins Erwachsenenalter, die Enttäuschung über fehlende Berufsmöglichkeiten für Frauen und die Suche nach persönlicher Erfüllung außerhalb der traditionellen Geschlechterrollen. Der Wendepunkt ihres Lebens wird durch ihre Beteiligung an der Gründung der „Mädchen- und Frauengruppen“ markiert, ein Ereignis, welches ihren Weg in die Soziale Arbeit ebnete. Das Kapitel schildert auch ihr Studium und ihre Promotion, bahnbrechende Leistungen für eine Frau zu dieser Zeit, sowie ihren Aufbau der Sozialen Frauenschule und ihre internationale Karriere. Schließlich wird auch ihre Entlassung aus allen öffentlichen Ämtern und ihre Emigration bis zu ihrem Tod behandelt, ein trauriges Ende einer außergewöhnlichen Karriere.
2. Alice Salomons Bedeutung für die Soziale Arbeit: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit dem Erbe von Alice Salomon im Bereich der Sozialen Arbeit. Es analysiert ihre weitreichenden Netzwerke und ihren Einfluss auf die Entwicklung der Profession. Der Zeitgeist der damaligen Epoche, der die Entstehung und Gestaltung der Sozialen Arbeit stark beeinflusste, wird eingehend betrachtet. Das Kapitel untersucht die Relevanz der Theorie der Chicagoer Schule für Salomons Denken und Handeln. Zentraler Bestandteil ist die detaillierte Auseinandersetzung mit Salomons Beitrag zur Entwicklung der Sozialen Arbeit als Wissenschaft. Hier werden ihre Theorie des Helfens, ihre theoretischen und ethische Grundlagen der Sozialen Arbeit sowie die Aspekte von Geschlecht und Profession im Kontext ihrer Arbeit diskutiert. Das Kapitel beleuchtet, wie Salomon theoretische Konzepte entwickelt und in die Praxis umgesetzt hat, und wie diese bis heute relevant sind.
Schlüsselwörter
Alice Salomon, Soziale Arbeit, Professionalisierung, Frauenbewegung, Zeitgeist, Chicagoer Schule, Theorie des Helfens, ethische Grundlagen, Geschlecht, Netzwerke.
Häufig gestellte Fragen zu: Alice Salomon - Leben, Werk und Bedeutung für die Soziale Arbeit
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Leben und Wirken von Alice Salomon und ihren Einfluss auf die Soziale Arbeit. Sie beinhaltet eine Biografie Salomons, analysiert ihren Beitrag zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit und untersucht ihren Einfluss im Kontext des damaligen Zeitgeistes. Die Arbeit beleuchtet ihre Netzwerke, ihre theoretischen und ethischen Grundlagen der Sozialen Arbeit und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Sozialen Arbeit als Wissenschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 1 befasst sich mit der Biografie Alice Salomons, von ihrer Kindheit bis zu ihrem Tod im Exil. Kapitel 2 analysiert Salomons Bedeutung für die Soziale Arbeit, ihre Netzwerke, den Einfluss des Zeitgeistes und ihren Beitrag zur Theoriebildung. Kapitel 3 bietet eine Schlussbetrachtung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Alice Salomons Biografie und persönliche Entwicklung, ihren Beitrag zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit, den Einfluss des Zeitgeistes auf ihr Wirken, ihre theoretischen und ethischen Grundlagen der Sozialen Arbeit und die Bedeutung ihrer Netzwerke.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Salomons Bedeutung für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit und ihre Rolle im Kontext des damaligen Zeitgeistes zu beleuchten. Sie analysiert ihre Biografie, ihre Netzwerke und ihren Beitrag zur Theoriebildung in der Sozialen Arbeit.
Welche Aspekte von Alice Salomons Biografie werden behandelt?
Die Biografie umfasst ihre Kindheit und Jugend in einer wohlhabenden jüdischen Familie in Berlin, den frühen Tod ihres Vaters und den damit verbundenen Verlust des gewohnten Lebensstandards, ihren schwierigen Übergang ins Erwachsenenalter, ihre Suche nach persönlicher Erfüllung außerhalb traditioneller Geschlechterrollen, ihr Studium und ihre Promotion, den Aufbau der Sozialen Frauenschule, ihre internationale Karriere und schließlich ihre Emigration und ihren Tod im Exil.
Wie wird Salomons Beitrag zur Sozialen Arbeit dargestellt?
Die Arbeit analysiert Salomons weitreichende Netzwerke, ihren Einfluss auf die Entwicklung der Profession, die Relevanz der Theorie der Chicagoer Schule für ihr Denken und Handeln, ihre Theorie des Helfens, ihre theoretischen und ethischen Grundlagen der Sozialen Arbeit sowie die Aspekte von Geschlecht und Profession in ihrem Kontext. Es wird beleuchtet, wie Salomon theoretische Konzepte entwickelt und in die Praxis umgesetzt hat und wie diese bis heute relevant sind.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Alice Salomon, Soziale Arbeit, Professionalisierung, Frauenbewegung, Zeitgeist, Chicagoer Schule, Theorie des Helfens, ethische Grundlagen, Geschlecht, Netzwerke.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse kurz und prägnant darstellen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich für die Geschichte der Sozialen Arbeit, die Biografie von Alice Salomon und den Einfluss von Frauen auf die Entwicklung der Sozialen Arbeit interessieren. Sie eignet sich besonders für Studierende der Sozialen Arbeit und verwandter Disziplinen.
- Citation du texte
- Ivonne Schröder (Auteur), 2010, Alice Salomon und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147765