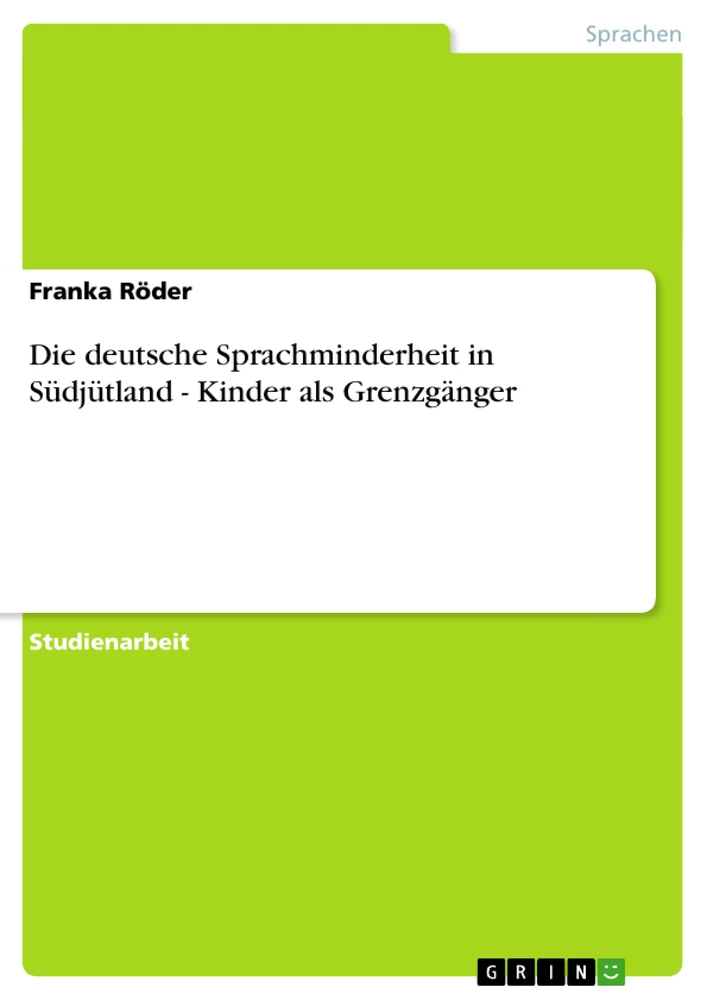Kinder sind ein kleines Phänomen was Auffassungsgabe und Umsetzung beim Erlernen von Sprachen angeht. Einem normalen Erwachsenen ist es oftmals nicht möglich, mit einem Kind in diesem Bereich Schritt zu halten, denn Kinder lernen eine Zweitsprache so mühelos wie die erste. Doch stellt sich erst einmal die Frage, warum ein Kind in einem so frühen Alter eine Zweitsprache erlernt beziehungsweise erlernen sollte. Was allgemein bekannt ist, ist die Tatsache, dass Bilingualität flexibles Denken fördert sowie auch das Erlernen einer weiteren Fremdsprache vereinfacht. Darüber hinaus jedoch spielt der kulturelle Hintergrund eine entscheidende Rolle. Kindern, die einer Minderheit zugehörig sind, ist es üblicherweise vorherbestimmt, die Muttersprache der Eltern zu erlernen. Des Weiteren aber auch die Sprache des jeweiligen Landes, welches als neue Heimat dient. Ein Beispiel für die Zweisprachigkeit von Kindern ist im Grenzraum der deutschen und dänischen Minderheit zu finden. In dieser Arbeit werde ich mich mit mehrsprachigen Kindern in Südjütland beschäftigen und aufzeigen, inwiefern sich die Sprachen in zwei verschiedenen Altersstufen ausprägen und welche regionalen Ausdrücke für Grenzgänger zwischen Deutschland und Dänemark typisch sind.
Inhaltsverzeichnis
- Kinder zwischen Sprachen und Kulturen.
- Wie kam es zu den sprachlichen Grenzgängern?
- Mehrsprachigkeit in deutschen Kindergärten und Schulen in Südjütland
- Südjütisch - Die „deutsche“ Sprache der Deutsch-Dänen in Dänemark?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Mehrsprachigkeit von Kindern in Südjütland, die der deutschen Minderheit angehören. Sie untersucht, wie sich die Sprachen in verschiedenen Altersstufen ausprägen und welche regionalen Ausdrücke für Grenzgänger zwischen Deutschland und Dänemark typisch sind.
- Mehrsprachigkeit und Sprachentwicklung von Kindern in einem zweisprachigen Umfeld
- Einfluss des Südjütischen auf Deutsch und Dänisch
- Regionale sprachliche Besonderheiten und Interferenzen
- Unterschiede in der Sprachverwendung von Kindergartenkindern und Schülern
- Die Rolle der Muttersprache und der Minderheitensprache im Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung der Minderheiten in Nord- und Südschleswig und die historischen Ereignisse, die zu ihrer Entwicklung führten. Es wird die Bedeutung des Vertrags von Ribe von 1460 sowie die Rolle des Herzogtums Schleswig im Kontext der deutsch-dänischen Beziehungen erörtert. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Mehrsprachigkeit in deutschen Kindergärten und Schulen in Südjütland. Es wird die Bedeutung der deutschen Minderheit in Dänemark und die drei Sprachen, mit denen Kinder in Südjütland konfrontiert sind (Dänisch, Deutsch und Südjütisch), beleuchtet. Das dritte Kapitel fokussiert auf die sprachliche Entwicklung von Kindern in Südjütland und untersucht, wie sie die verschiedenen Sprachen aufnehmen und anwenden. Es werden regionale Ausdrücke und Interferenzen zwischen den Sprachen analysiert, wobei sich der Fokus auf die Untersuchung von Kindergartenkindern und Schülern liegt.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Minderheiten, Südjütland, Deutsch-Dänische Region, Grenzgänger, Sprachentwicklung, Südjütisch, Interferenzen, Regionalsprachen, Kindergartenkinder, Schüler, Sprachverwendung, Muttersprache, Minderheitensprache.
Häufig gestellte Fragen
Warum lernen Kinder in Südjütland mehrere Sprachen?
Sie gehören oft der deutschen Minderheit in Dänemark an und lernen sowohl die Muttersprache der Eltern als auch die Landessprache Dänisch.
Welche Rolle spielt das „Südjütische“?
Südjütisch ist ein regionaler Dialekt, der neben Deutsch und Dänisch als dritte Sprachkomponente den Alltag und die Identität der Menschen prägt.
Was sind „Grenzgänger“ in diesem Kontext?
Menschen bzw. Kinder, die sich sprachlich und kulturell zwischen Deutschland und Dänemark bewegen und typische regionale Ausdrücke verwenden.
Welche Vorteile bietet diese Bilingualität?
Mehrsprachigkeit fördert flexibles Denken und vereinfacht das Erlernen weiterer Fremdsprachen in der Zukunft.
Wie unterscheiden sich die Sprachstufen bei Kindergartenkindern und Schülern?
Die Arbeit untersucht, wie sich die Sprachausprägung und die Interferenzen (Sprachmischungen) in diesen zwei verschiedenen Altersstufen entwickeln.
- Quote paper
- Franka Röder (Author), 2010, Die deutsche Sprachminderheit in Südjütland - Kinder als Grenzgänger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147821