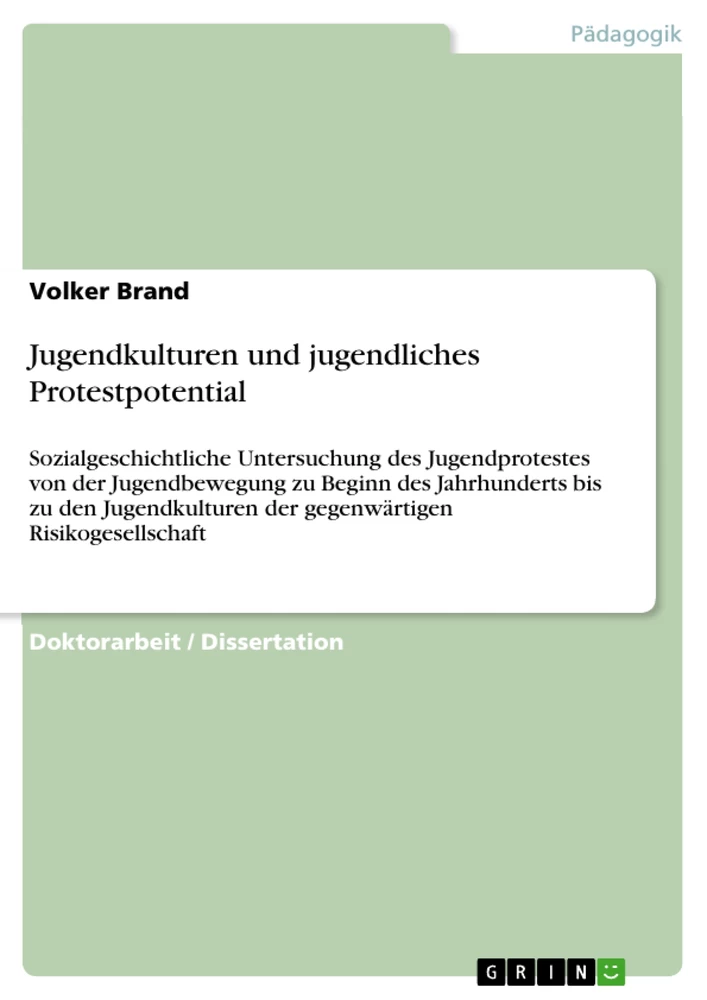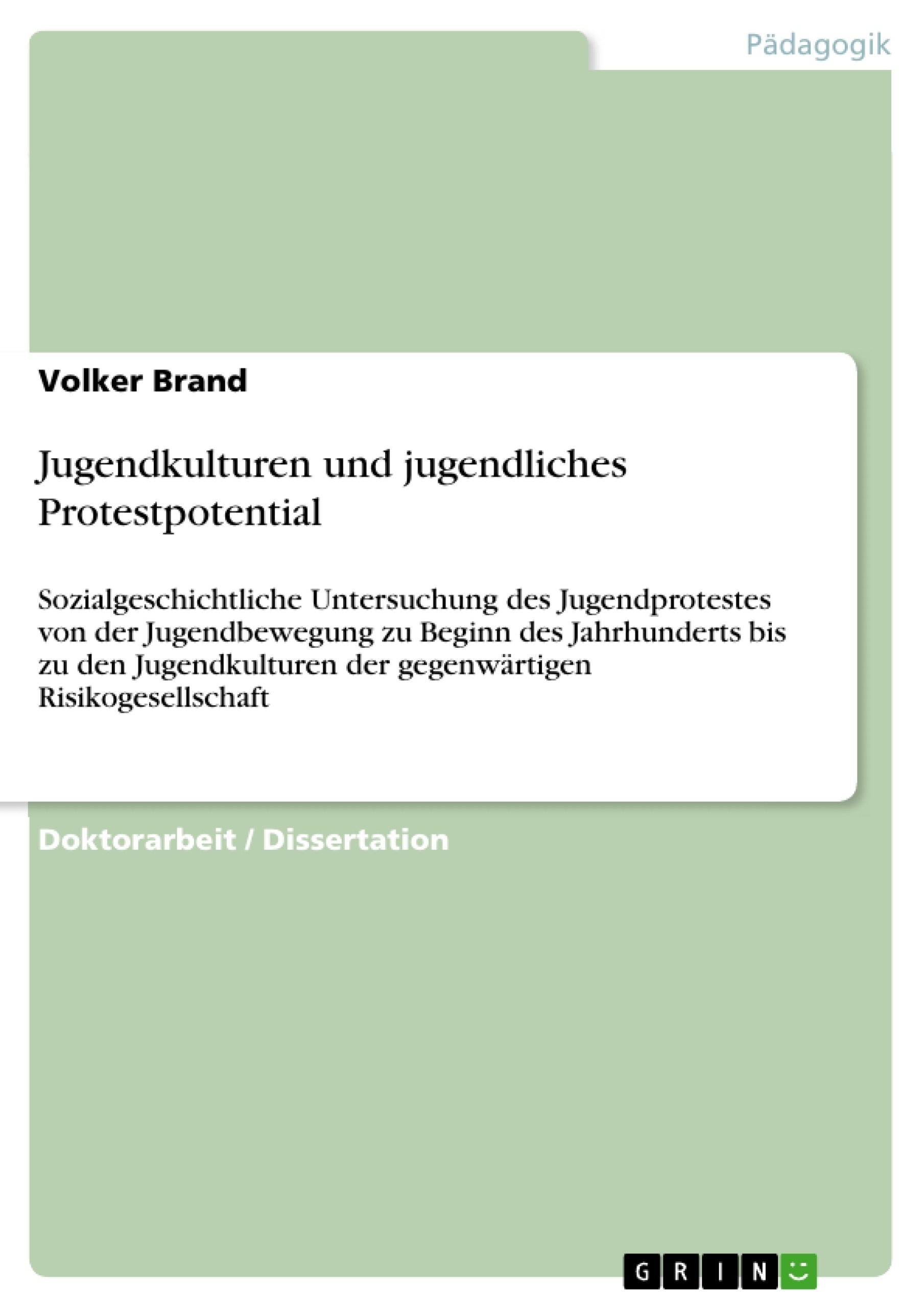Diese Arbeit geht den verschiedenen Ausformungen des jugendlichen Protestpotentials in Deutschland nach. Von der Jugendbewegung zu Beginn dieses Jahrhunderts bis zu den Jugendkulturen der Gegenwart zeichnet der Autor in seiner genetisch-chronologischen Untersuchung einen Überblick über das wechselseitige Bedingungsgefüge von Jugend und Gesellschaft. Neben Ursachen, Darstellung und Auswirkungen des Jugendprotestes in seinem jeweiligen historischen Kontext werden dabei die gesamtgesellschaftlichen Ambitionen zur Vermeidung des Jugendprotestes besonders thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel I: Einleitung
- 1. Jugend und Protest in der sozialwissenschaftlichen und jugendpsychologischen Forschung - Eine Einführung
- 1.1. Die klassische jugendpsychologische und kulturanthropologische Perspektive der Thematik
- 1.2. Zur Konflikthaftigkeit des Generationenverhältnisses und der Identitätsentwicklung
- 1.3. Jugend und Protest in der neueren sozialwissenschaftlichen Literatur
- 2. Die zugrunde liegende These
- 3. Kurzer Überblick über die Vorgehensweise
- Kapitel II: Vom Wandervogel bis zur Machtergreifung - Jugendliches Protestpotential zwischen Jugendbewegung und Anpassung
- 1. Die Genese des Wandervogels bis 1914
- 2. Der Wandervogel - eine Protestbewegung?
- 3. Die weitere Entwicklung der deutschen Jugendbewegung bis 1933.
- 3.1. Der erste Weltkrieg - eine Wendemarke in der Geschichte der Jugendbewegung
- 3.2. Jugend zu Beginn der Weimarer Republik im Zeichen des Neuanfangs
- 3.3. Die 'bündische Jugend'
- 3.4. Die Arbeiterjugendbewegung bis 1933
- 3.5. Die deutsche Jugendbewegung unter dem Blickwinkel des Scheiterns der Demokratie
- Kapitel III: Jugend und Protest im Dritten Reich
- 1. Jugendbewegung und Nationalsozialismus
- 2. Jugend im NS-Staat
- 3. Jugendprotest im Dritten Reich
- 3.1. Jugendprotest aus dem Arbeitermilieu
- 3.2. Jugendprotest aus den "Bünden"
- 3.3. Widerstand aus den Reihen der konfessionellen Jugend
- 3.4. Der kulturelle Protest der wilden 'Swing' Gruppen
- 4. Die Gegenmaßnahmen des NS-Staates
- 5. Abschließende Anmerkungen zu Jugend und Protest im Dritten Reich
- Kapitel IV: Jugendkulturen in der Nachkriegszeit
- 1. Jugendnot- und Jugendschutzkultur
- 2. Die 'Halbstarken' - Kultur
- 3. Rocker und Existentialisten
- 4. Die gesellschaftskonforme jugendliche Mehrheit
- Kapitel V: Die 'anti-autoritäre' Jugend- und Studentenbewegung
- 1. Die Vorboten einer neuen Zeit
- 2. Jugend und Gesellschaft Mitte der 60er Jahre
- 3. Entwicklung und Verlauf der Studentenbewegung
- 4. Die soziokulturellen Auswirkungen der 68er Bewegung
- Kapitel VI: Die weitere Entwicklung in den 70er und frühen 80er Jahren - Jugendkulturen im Zeichen von Diversifizierung und Heterogenität
- 1. Der Weg in den 'Deutschen Herbst' - Von der Utopie zur Frustration
- 2. Jugendunruhen und Alternativkultur zu Beginn der 80er Jahre - ein Zwischenspiel
- Kapitel VII: Jugendkulturen und jugendliches Protestpotential in der Risikogesellschaft der Gegenwart
- 1. Unübersichtlichkeit als dominierendes Merkmal von Jugendkulturen und Jugendforschung
- 2. Jugend unter dem Blickwinkel gegenwärtiger Gesellschaftsdeskriptionen
- 2.1. Jugend im Zeichen eines Strukturwandels
- 2.2. Jugend und Postmoderne
- 2.3. Jugend in der Risikogesellschaft
- 3. Jugend und Protest in der Gegenwart
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das jugendliche Protestpotential in Deutschland von Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Ziel ist es, die Entwicklung des Jugendprotestes im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen zu analysieren und die verschiedenen Ausdrucksformen jugendlicher Rebellion zu beleuchten. Dabei werden sowohl die organisierten Jugendbewegungen als auch die informellen Jugendkulturen berücksichtigt.
- Entwicklung des Jugendprotestes im historischen Kontext
- Vergleich verschiedener Jugendbewegungen und -kulturen
- Der Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf jugendliches Protestpotential
- Die Rolle von Politik und Gesellschaft in der Reaktion auf Jugendprotest
- Jugendprotest als Ausdruck von Identitätsfindung und gesellschaftlicher Kritik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I: Einleitung: Dieses einführende Kapitel legt den Grundstein für die gesamte Arbeit. Es beleuchtet die Auseinandersetzung der sozialwissenschaftlichen und jugendpsychologischen Forschung mit dem Thema Jugend und Protest. Es werden unterschiedliche Perspektiven vorgestellt, beginnend mit klassischen Ansätzen der Jugendpsychologie und Kulturanthropologie, die die Konflikthaftigkeit des Generationenverhältnisses und die Bedeutung der Identitätsentwicklung hervorheben. Weiterführend werden neuere sozialwissenschaftliche Ansätze diskutiert, bevor die zentrale These der Arbeit vorgestellt und die Methodik erläutert wird. Das Kapitel schafft somit einen umfassenden Rahmen für die anschließende historische Analyse.
Kapitel II: Vom Wandervogel bis zur Machtergreifung - Jugendliches Protestpotential zwischen Jugendbewegung und Anpassung: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der deutschen Jugendbewegung vom Wandervogel bis 1933. Es untersucht die Genese des Wandervogels, die Frage nach seinem Charakter als Protestbewegung, und die weitere Entwicklung im Kontext des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Republik. Die Rolle der "bündischen Jugend" und der Arbeiterjugendbewegung wird beleuchtet, und schließlich wird die deutsche Jugendbewegung unter dem Aspekt des Scheiterns der Weimarer Demokratie betrachtet. Der Fokus liegt auf dem Wandel des jugendlichen Protestpotentials zwischen Idealismus, Anpassung und politischer Instrumentalisierung.
Kapitel III: Jugend und Protest im Dritten Reich: Das Kapitel widmet sich der komplexen Beziehung zwischen Jugend und Protest während der NS-Zeit. Es untersucht die Instrumentalisierung der Jugendbewegung durch den Nationalsozialismus, die Unterdrückung von Protest, und die verschiedenen Formen des Widerstands, die sich dennoch entwickelten. Der Jugendprotest aus Arbeitermilieus, den "Bünden", und konfessionellen Kreisen wird ebenso analysiert wie der kulturelle Protest von Swing-Gruppen. Die Reaktionen des NS-Staates auf diesen Protest und die abschliessenden Bemerkungen zeichnen ein differenziertes Bild von Jugend und Widerstand im Dritten Reich.
Kapitel IV: Jugendkulturen in der Nachkriegszeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung von Jugendkulturen in der Nachkriegszeit. Es beschreibt den Übergang von der Jugendnot- und Jugendschutzkultur zu den "Halbstarken", Rockern und Existentialisten. Gleichzeitig wird die gesellschaftskonforme Mehrheit der Jugendlichen beleuchtet, wodurch ein komplexes Bild der verschiedenen Jugendkulturen und ihrer Beziehung zur Gesellschaft entsteht. Das Kapitel analysiert die unterschiedlichen Ausdrucksformen jugendlicher Identität und ihres Verhältnisses zur dominanten Kultur.
Kapitel V: Die 'anti-autoritäre' Jugend- und Studentenbewegung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die anti-autoritäre Jugend- und Studentenbewegung der 1960er Jahre. Es analysiert die Vorboten dieser Bewegung, ihre Entwicklung und ihren Verlauf, sowie ihre soziokulturellen Auswirkungen. Die umfassende Analyse betrachtet den Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und den Einfluss dieser Bewegung auf Politik, Kultur und die Gesellschaft insgesamt. Der Fokus liegt auf dem Ausmaß und der Tragweite der Studentenbewegung als Ausdruck tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche.
Kapitel VI: Die weitere Entwicklung in den 70er und frühen 80er Jahren - Jugendkulturen im Zeichen von Diversifizierung und Heterogenität: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung von Jugendkulturen in den 1970er und frühen 1980er Jahren, gekennzeichnet durch Diversifizierung und Heterogenität. Es analysiert den "Deutschen Herbst" und den Übergang von Utopie zu Frustration, sowie die Jugendunruhen und die Alternativkultur zu Beginn der 1980er Jahre. Die Zusammenfassung betont den Wandel in den Ausdrucksformen des Jugendprotestes und die wachsende Komplexität jugendlicher Identitäten in dieser Phase.
Schlüsselwörter
Jugendprotest, Jugendkulturen, Jugendbewegung, Risikogesellschaft, Protestpotential, Identitätsentwicklung, Generationenkonflikt, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, Studentenbewegung, 68er Bewegung, Soziale Bewegungen, Historische Sozialforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Jugend und Protest in Deutschland"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das jugendliche Protestpotential in Deutschland vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Sie analysiert die Entwicklung des Jugendprotestes im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und beleuchtet verschiedene Ausdrucksformen jugendlicher Rebellion, sowohl in organisierten Jugendbewegungen als auch in informellen Jugendkulturen.
Welche Zeiträume werden behandelt?
Die Arbeit umfasst einen Zeitraum von Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Sie betrachtet die Entwicklung des Jugendprotestes in verschiedenen historischen Epochen, darunter die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, das Dritte Reich, die Nachkriegszeit, die 68er Bewegung und die Entwicklungen in den 70er und 80er Jahren bis hin zur Gegenwart.
Welche Jugendbewegungen und -kulturen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert eine Vielzahl von Jugendbewegungen und -kulturen, darunter der Wandervogel, die "bündische Jugend", die Arbeiterjugendbewegung, Jugendkulturen der Nachkriegszeit ("Halbstarken", Rocker, Existentialisten), die anti-autoritäre Studentenbewegung der 60er Jahre und Jugendkulturen der 70er und 80er Jahre. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der verschiedenen Bewegungen und Kulturen und deren Kontextualisierung innerhalb der jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Jugendprotestes im historischen Kontext, vergleicht verschiedene Jugendbewegungen und -kulturen, analysiert den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf das jugendliche Protestpotential, beleuchtet die Rolle von Politik und Gesellschaft in der Reaktion auf Jugendprotest und betrachtet Jugendprotest als Ausdruck von Identitätsfindung und gesellschaftlicher Kritik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Kapitel I bietet eine Einleitung und stellt die These und Methodik vor. Die Kapitel II bis VI behandeln die Entwicklung des Jugendprotestes in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit der Jugendbewegung um 1900 bis hin zu den Jugendkulturen der 70er und 80er Jahre. Kapitel VII analysiert Jugendkulturen und jugendliches Protestpotential in der Gegenwart unter Berücksichtigung aktueller Gesellschaftsbeschreibungen.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, welche die wichtigsten Ergebnisse und Argumente jedes Kapitels zusammenfassen. Diese Zusammenfassungen erleichtern das Verständnis des Gesamtkontextes und der Argumentationslinie der Arbeit. Jedes Kapitel wird kurz beschrieben, um einen Überblick über den Inhalt zu liefern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter zur Beschreibung des Inhalts sind: Jugendprotest, Jugendkulturen, Jugendbewegung, Risikogesellschaft, Protestpotential, Identitätsentwicklung, Generationenkonflikt, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, Studentenbewegung, 68er Bewegung, Soziale Bewegungen, Historische Sozialforschung.
- Citar trabajo
- Dr. Volker Brand (Autor), 1992, Jugendkulturen und jugendliches Protestpotential, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147824