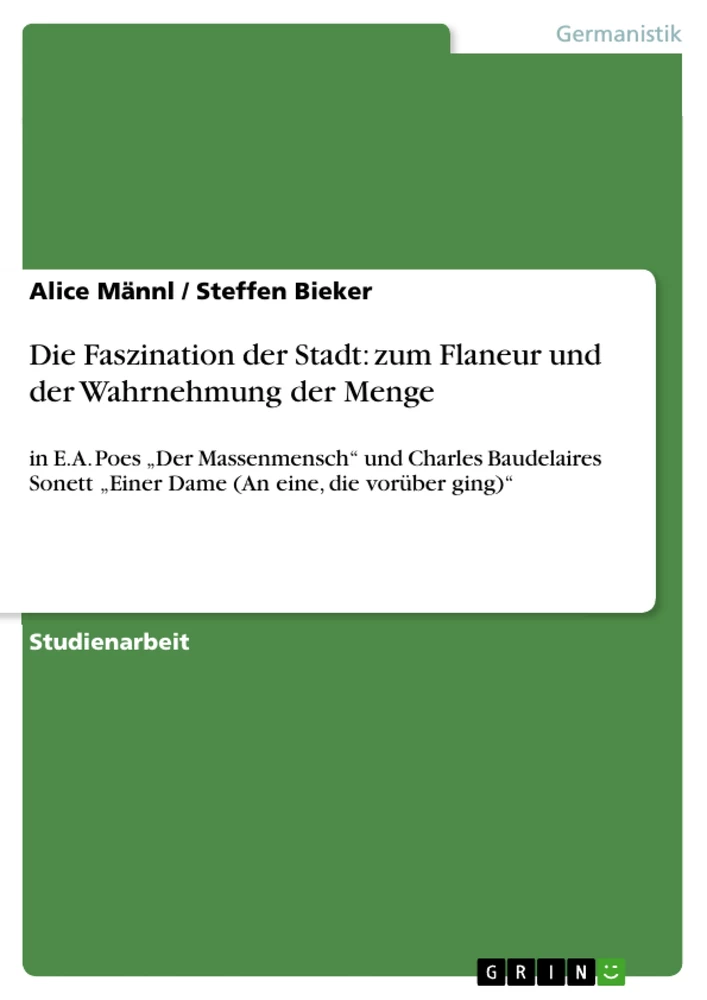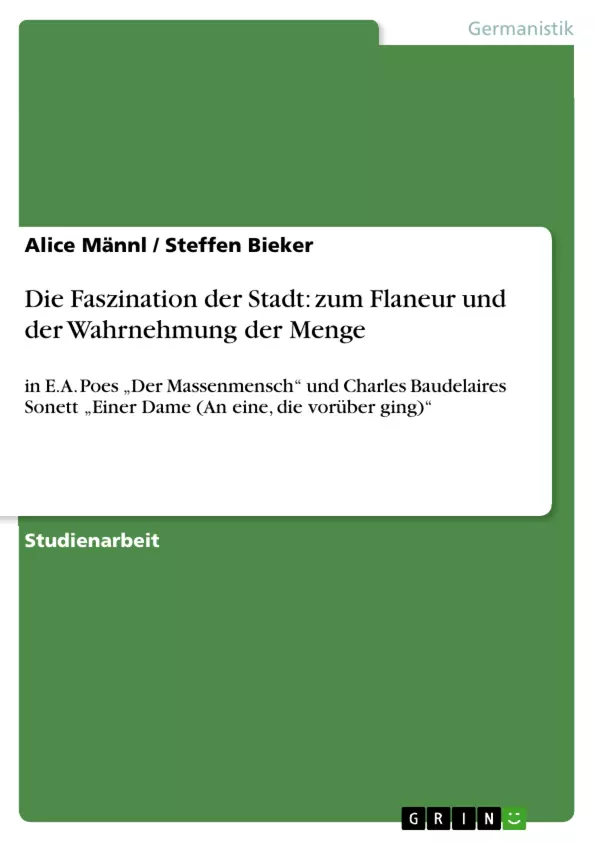Im 19. Jahrhundert begannen einige große Städte sich von den restlichen dadurch zu unterscheiden, daß ein äußerer und innerer Urbanisierungsprozeß stattfand und aus der großen Stadt eine Großstadt wurde. Dieser Urbanisierungsprozeß bewirkte in den Menschen eine Veränderung in der Wahrnehmung, welche wiederum, so soll im folgenden gezeigt werden, eine Veränderung in den künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten forderte. An der großstädtischen Realität wird exemplarisch die Moderne erfahren, so daß sich urbane Erfahrung als die Erfahrung der Moderne schlechthin definieren läßt. Diese Gleichsetzung der Modernität mit dem urbanen Bewußtsein markiert den Beginn einer „Literatur der Moderne“. Im Unterschied zu einer Literatur über die Großstadt (z.B. sozialer Roman), wie sie im Naturalismus anzutreffen war, versucht die Literatur der Moderne die Großstadt „selbst zum Sprechen zu bringen“, als das Produkt einer formalen Gestaltung urbaner Erfahrung und Wahrnehmung.
Inhaltsverzeichnis
- Urbanisierung und veränderte Wahrnehmung
- Der Flaneur
- Annäherungen an BAUDELAIRE
- Zu POES,,Der Massenmensch❝
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Faszination der Stadt im 19. Jahrhundert, insbesondere die Wahrnehmung der Menge durch den Flaneur, anhand von E.A. Poes „Der Massenmensch“ und Charles Baudelaires Sonett „Einer Dame (An eine, die vorüber ging)“. Sie analysiert die Veränderungen in der Wahrnehmung, die durch den Urbanisierungsprozess hervorgerufen wurden, und die Rolle des Flaneurs als Beobachter und Interpret der modernen Großstadt.
- Urbanisierung und ihre Auswirkungen auf die Wahrnehmung
- Die Figur des Flaneurs als Repräsentant der modernen Erfahrung
- Die Rolle der Menge in der städtischen Wahrnehmung
- Die literarische Darstellung der Stadt in der frühen Moderne
- Die Verbindung von Poesie und urbaner Erfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Veränderungen in der Wahrnehmung, die durch den Urbanisierungsprozess im 19. Jahrhundert hervorgerufen wurden. Es wird die Unterscheidung zwischen äußerer und innerer Urbanisierung erläutert und die Herausforderungen der Reizüberflutung in der Großstadt thematisiert. Das Kapitel analysiert die Mechanismen der selektiven Wahrnehmung und die Entstehung des Schockerlebnisses als neue Form der städtischen Erfahrung.
Das zweite Kapitel widmet sich der Figur des Flaneurs als einer spezifischen Form der Wahrnehmung und Verarbeitung der Stadt. Es wird die Ambivalenz seiner Beziehung zur Menge und die Rolle der Reflexion in seiner Wahrnehmung beleuchtet. Der Flaneur wird als ein Beobachter der modernen Großstadt dargestellt, der die flüchtigen Eindrücke der Stadt in seinen Träumen und Fantasien verarbeitet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der literarischen Darstellung der Stadt in der frühen Moderne. Es wird die Prosagedichte Baudelaires als ein literarisches Verfahren vorgestellt, das der Flüchtigkeit und dem Vorübergehenden der modernen Erfahrung gerecht werden soll. Der Flaneur wird als die Figur dargestellt, die diese Modernität erfahren und ausdrücken kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Urbanisierung, die Wahrnehmung der Menge, den Flaneur, die moderne Großstadt, die Prosagedichte, E.A. Poe, Charles Baudelaire, „Der Massenmensch“, „Einer Dame (An eine, die vorüber ging)“, die Literatur der Moderne, die Erfahrung der Moderne, die städtische Erfahrung, die Reizüberflutung, die selektive Wahrnehmung, das Schockerlebnis, die Ambivalenz, die Reflexion, die Träume, die Fantasie, die Flüchtigkeit, das Vorübergehende, das Einmalige, die literarische Darstellung der Stadt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem „Flaneur“ in der Literatur?
Der Flaneur ist ein Beobachter der modernen Großstadt, der ziellos durch die Straßen streift und die flüchtigen Eindrücke der Menge wahrnimmt und interpretiert.
Wie veränderte die Urbanisierung im 19. Jahrhundert die Wahrnehmung?
Der Prozess führte zu einer Reizüberflutung, die selektive Wahrnehmung und das Erleben von „Schocks“ als neue Formen der städtischen Erfahrung erforderte.
Welche Werke von Poe und Baudelaire werden analysiert?
Analysiert werden E.A. Poes Erzählung „Der Massenmensch“ und Charles Baudelaires Sonett „Einer Dame (An eine, die vorüber ging)“.
Was bedeutet „Literatur der Moderne“ in diesem Kontext?
Es ist eine Literatur, die nicht nur über die Großstadt schreibt, sondern versucht, die urbane Erfahrung durch formale Gestaltung selbst „zum Sprechen zu bringen“.
Warum ist die „Menge“ für den Flaneur so faszinierend?
Die Menge bietet Anonymität und gleichzeitig eine unerschöpfliche Quelle flüchtiger, einmaliger Eindrücke, die der Flaneur reflektiert und verarbeitet.
Wie hängen Modernität und urbanes Bewusstsein zusammen?
Die Arbeit definiert urbane Erfahrung als die Erfahrung der Moderne schlechthin, da sich in der Großstadt die radikalen Veränderungen der Lebenswelt manifestieren.
- Quote paper
- Magistra Artium Alice Männl (Author), Steffen Bieker (Author), 1995, Die Faszination der Stadt: zum Flaneur und der Wahrnehmung der Menge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147884