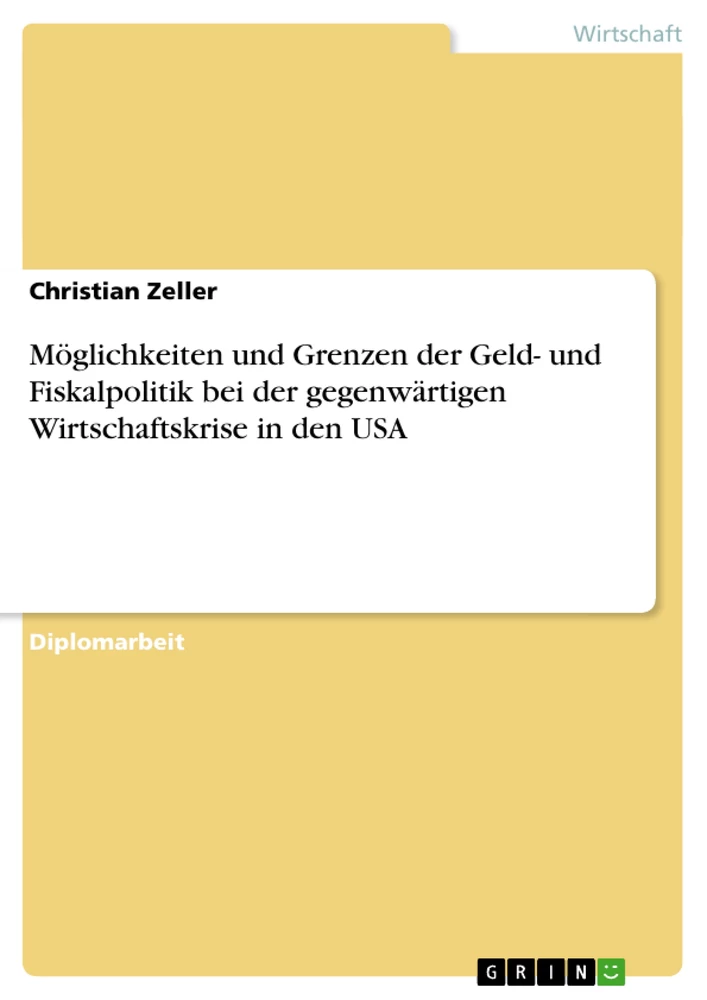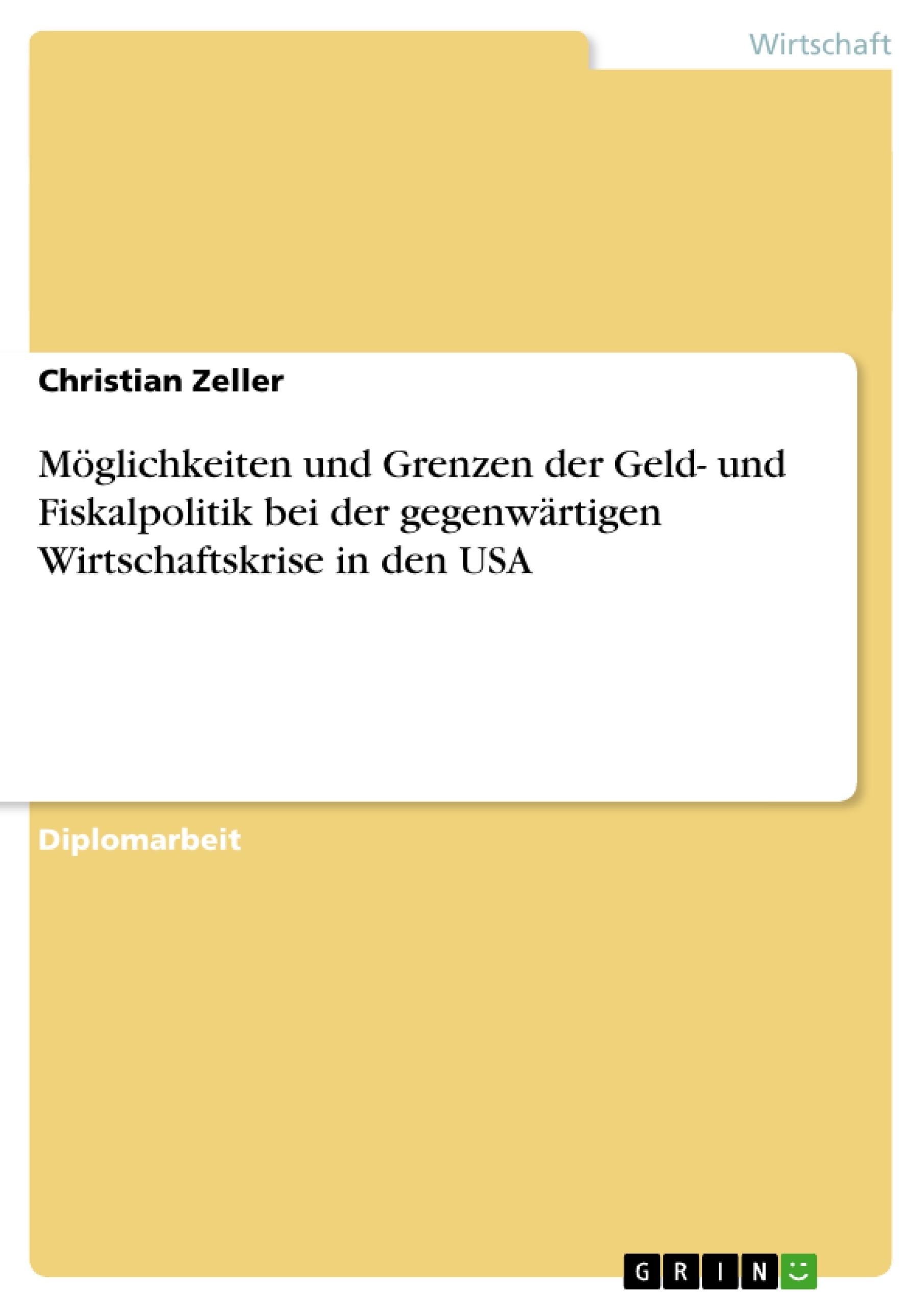“[The] problem of depression-prevention has been solved, for all practical purposes.” (Robert Lucas 2003, S. 1)
Mit dieser Meinung war Robert Lucas wohl nicht allein bis zum Jahr 2007. Hinsichtlich der makroökonomischen Stabilität, die man seit dem Ende der letzten größeren Rezession im Jahr 1984 in den USA beobachten konnte sprach man von der „Great Moderation“. Im Jahr 2004 gab Ben Bernanke, der derzeitige Notenbankchef der USA, drei mögliche Gründe für die Erscheinung dieses Phänomens an: Erstens eine verbesserte Geldpolitik, zweitens strukturelle Veränderungen wie die Computerisierung, die bspw. effizientere Lagerhaltung ermöglichte und drittens Glück. In seinen weiteren Ausführungen betonte Bernanke dann eine verbesserte Geldpolitik als wesentliche Ursache der Great Moderation.1 Seit dem Platzen der Vermögensblase im Jahr 2007 gibt es gute Gründe dieser Einschätzung skeptisch gegenüber zu stehen. Die USA sehen sich dem massivsten Nachfrageeinbruch seit der großen Depression der 1930er gegenüber. Als adäquate Antwort hat die US-amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, den Leitzins im Dezember 2008 bis auf Null gesenkt2 und befindet sich damit in der Liquiditätsfalle. Das Land, das sich als letztes in solch einer Situation befand, war Japan während der 1990er Jahre. Damals ist es Japan trotz eines Nominalzinses von Null und einer aggressiven Fiskalpolitik nicht gelungen, die Nachfrage merkbar anzuregen; auch eine Deflation konnte nicht vermieden werden. Heute spricht man von Japans verlorener Dekade und nicht wenige sorgen sich darüber, dass der USA Ähnliches bevorsteht.3 Jedoch ist man heute auch gemeinhin der Ansicht Japan habe nicht all seine Möglichkeiten (vor allem seine geldpolitischen) zur Verbesserung der Lage genutzt.4 In der vorliegenden Arbeit werden makroökonomische Maßnahmen vorgestellt, die den USA in ihrer jetzigen Situation helfen können. Ein wesentliches Ergebnis wird die Einsicht sein, dass die Federal Reserve selbst nachdem sie den Leitzins auf Null gesetzt hat, noch lange nicht ihre gesamten Interventionsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Einige dieser Maßnahmen lassen die Grenzen von Geld- und Fiskalpolitik verwischen, aber es wird auch gezeigt, dass die Nullnominalzinsgrenze ein starkes Argument für klassische, diskretionäre Fiskalpolitik beinhaltet. Darüber hinaus wird dargelegt, wie man expansive Fiskalpolitik auch ohne auch ohne Budgetdefizite betreiben kann...
Inhaltsverzeichnis
- 1 Das Ende der „,Great Moderation“
- 2 Ursachen und Folgen einer Liquiditätsfalle und Deflation
- 2.1 Warum beobachten wir keine negativen Zinsen?
- 2.2 Besonderheiten einer Deflation
- 3 Geldpolitik in der Liquiditätsfalle
- 3.1 Beeinflussung der Zinserwartungen mit mündlichen Versprechen
- 3.1.1 Ankündigung eines Inflationsziels
- 3.1.2 Ankündigung eines Preisniveaupfads
- 3.2 Ausweitung der Geldmenge
- 3.2.1 Portfolio- und Vermögenseffekte
- 3.2.2 Effekte durch erhöhte Liquidität
- 3.2.3 Effekte durch Erwartungen
- 3.2.4 Effekte über den Kredit-Kanal
- 3.3 Geldpolitik mit langfristigen Anleihen und Optionen auf Anleihen
- 3.3.1 Offenmarktgeschäfte mit Treasury Bonds
- 3.3.1.1 Der Signalling-Kanal
- 3.3.1.2 Der Portfoliokanal
- 3.3.2 Optionen auf Staatsanleihen
- 3.3.2.1 Übersicht
- 3.3.2.2 Optionen schreiben und bewerten
- 3.3.2.3 Optionen als Mittel zur Beeinflussung von Markterwartungen
- 3.4 Beeinflussung des Wechselkurses
- 3.4.1 Der Signalling-Kanal
- 3.4.2 Der Portfoliokanal
- 3.4.3 Wechselkursänderung ohne Signalling- und Portfoliokanal
- 3.4.4 Effekte auf andere Länder
- 3.5 Zahlung negativer Zinsen auf Bankreserven
- 3.6 Kauf von Anleihen und anderen Papieren des Privatsektors
- 3.7 Vergabe von Krediten an den Privatsektor
- 3.8 Was immer wirkt: Friedmans Hubschrauber
- 3.9 Inflationsgefahr und Exit Strategie
- 3.9.1 Politische Hürden
- 3.9.2 Technische Hürden
- 3.9.3 Lösungsvorschlag
- 4 Fiskalpolitik in der Rezession
- 4.1 Wann Fiskalpolitik a priori unwirksam ist
- 4.1.1 Steuererleichterungen und Ricardianische Äquivalenz
- 4.1.1.1 Vererbungsmotiv dürfte irrelevant sein
- 4.1.1.2 Bevölkerung kann liquiditätsbeschränkt sein
- 4.1.1.3 Schuldner und Gläubiger können verschiedene Diskontraten haben
- 4.1.1.4 Vorsorgesparen kann abnehmen
- 4.1.1.5 Konsumausgaben können höher sein als der Konsum
- 4.1.1.6 Die Budgetrestriktion des Staates ist in der Praxis irrelevant
- 4.1.2 Staatsausgaben und Crowding Out
- 4.1.2.1 Das Saysche Theorem oder I=S
- 4.1.2.2...und was damit nicht stimmt
- 4.1.2.3 Optimale Höhe der Staatsausgaben in der Liquiditätsfalle ein Modell
- 4.2 Weitere mögliche Hindernisse für Fiskalpolitik
- 4.2.1 Einheitswurzel-Hypothese
- 4.2.2 Zeitliche Verzögerungen der Fiskalpolitik
- 4.2.3 Sektorale Verschiebungen, Arbeitslosigkeit und die NAIRU
- 4.2.3.1 Sektorale Ungleichgewichte
- 4.2.3.2 Die Beveridge-Kurve
- 4.2.3.3 Dispersion des Beschäftigungswachstums
- 4.2.3.4 Ausblick
- 4.2.4 Höhe der Staatsschuld
- 4.3 Fiskaler Stimulus mit budgetneutralen Steueränderungen
- 4.3.1 Budgetneutrale Steueränderungen mit Substitutionseffekt
- 4.3.1.1 Anregung der Investitionsnachfrage der Unternehmen
- 4.3.1.2 Anregung der Konsumnachfrage der privaten Haushalte
- 4.3.2 Budgetneutrale Steueränderungen mit Einkommenseffekt
- 4.3.2.1 Ausnutzung unterschiedlicher Diskontraten
- 4.3.2.2 Erfolgsaussichten in den USA
- 4.4 Optimale Zusammensetzung des Stimulus
- 4.5 Exkurs: Eine alternative Evaluierung expansiver Fiskalpolitik
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Geld- und Fiskalpolitik im Kontext der aktuellen Wirtschaftskrise in den USA. Der Fokus liegt dabei auf den spezifischen Herausforderungen, die sich aus der Liquiditätsfalle und der Deflation ergeben.
- Die Funktionsweise der Geldpolitik in einer Liquiditätsfalle
- Die Wirksamkeit verschiedener geldpolitischer Maßnahmen
- Die Rolle der Fiskalpolitik in der Rezession
- Die Grenzen der Fiskalpolitik im Kontext der Ricardianischen Äquivalenz und des Crowding Out
- Die optimale Zusammensetzung des fiskalpolitischen Stimulus
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einführung in die „Great Moderation“ und deren Ende. Kapitel 2 analysiert die Ursachen und Folgen einer Liquiditätsfalle und Deflation. Kapitel 3 untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Geldpolitik in einer Liquiditätsfalle. Es werden verschiedene geldpolitische Maßnahmen diskutiert, wie z.B. die Beeinflussung von Zinserwartungen, die Ausweitung der Geldmenge, die Verwendung von langfristigen Anleihen und Optionen auf Anleihen, die Beeinflussung des Wechselkurses, die Zahlung negativer Zinsen auf Bankreserven, der Kauf von Anleihen des Privatsektors, die Vergabe von Krediten an den Privatsektor sowie Friedmans Hubschrauber-Geldpolitik. Weiterhin werden die Inflationsgefahr und die Exit-Strategie der Geldpolitik beleuchtet. Kapitel 4 befasst sich mit der Fiskalpolitik in der Rezession. Es wird untersucht, wann Fiskalpolitik a priori unwirksam ist, insbesondere im Kontext der Ricardianischen Äquivalenz und des Crowding Out. Außerdem werden weitere mögliche Hindernisse für Fiskalpolitik diskutiert, wie z.B. die Einheitswurzel-Hypothese, zeitliche Verzögerungen, sektorale Verschiebungen, die Höhe der Staatsschuld und die optimale Zusammensetzung des fiskalpolitischen Stimulus. Kapitel 5 fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Geldpolitik, Fiskalpolitik, Liquiditätsfalle, Deflation, Rezession, Ricardianische Äquivalenz, Crowding Out, Einheitswurzel-Hypothese, sektorale Verschiebungen, Arbeitslosigkeit, NAIRU, Staatsverschuldung, Exit-Strategie, Inflationsgefahr, Zinserwartungen, Wechselkurs, Portfolio- und Vermögenseffekte, Kredit-Kanal, Optionen auf Anleihen, Friedman's Hubschrauber-Geldpolitik, budgetneutrale Steueränderungen, optimale Zusammensetzung des Stimulus.
- Citar trabajo
- Christian Zeller (Autor), 2009, Möglichkeiten und Grenzen der Geld- und Fiskalpolitik bei der gegenwärtigen Wirtschaftskrise in den USA, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147971