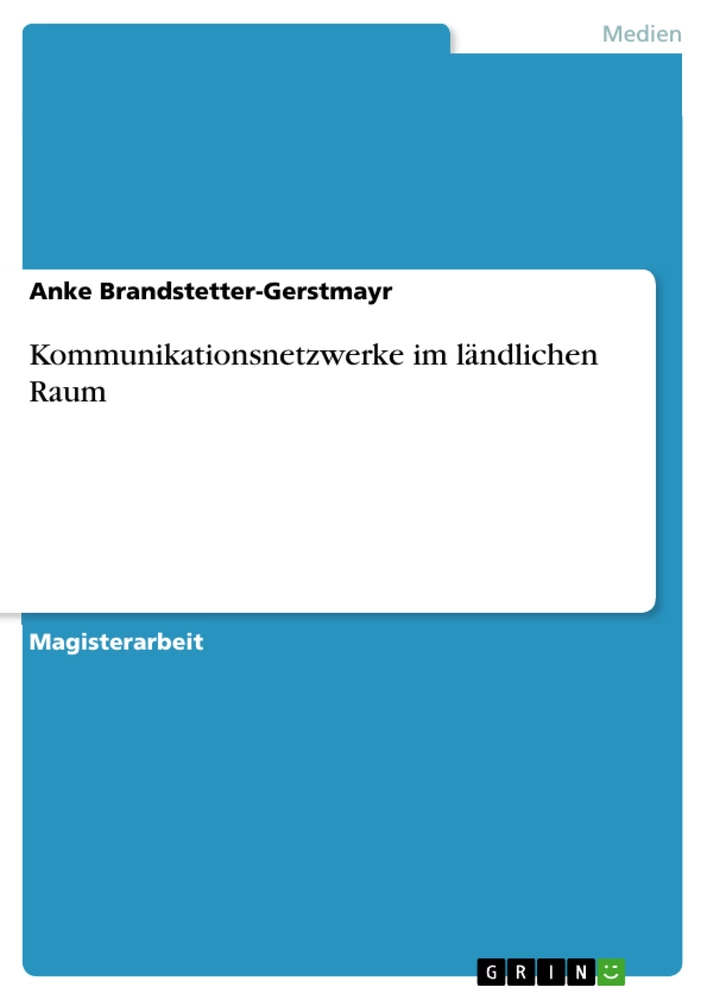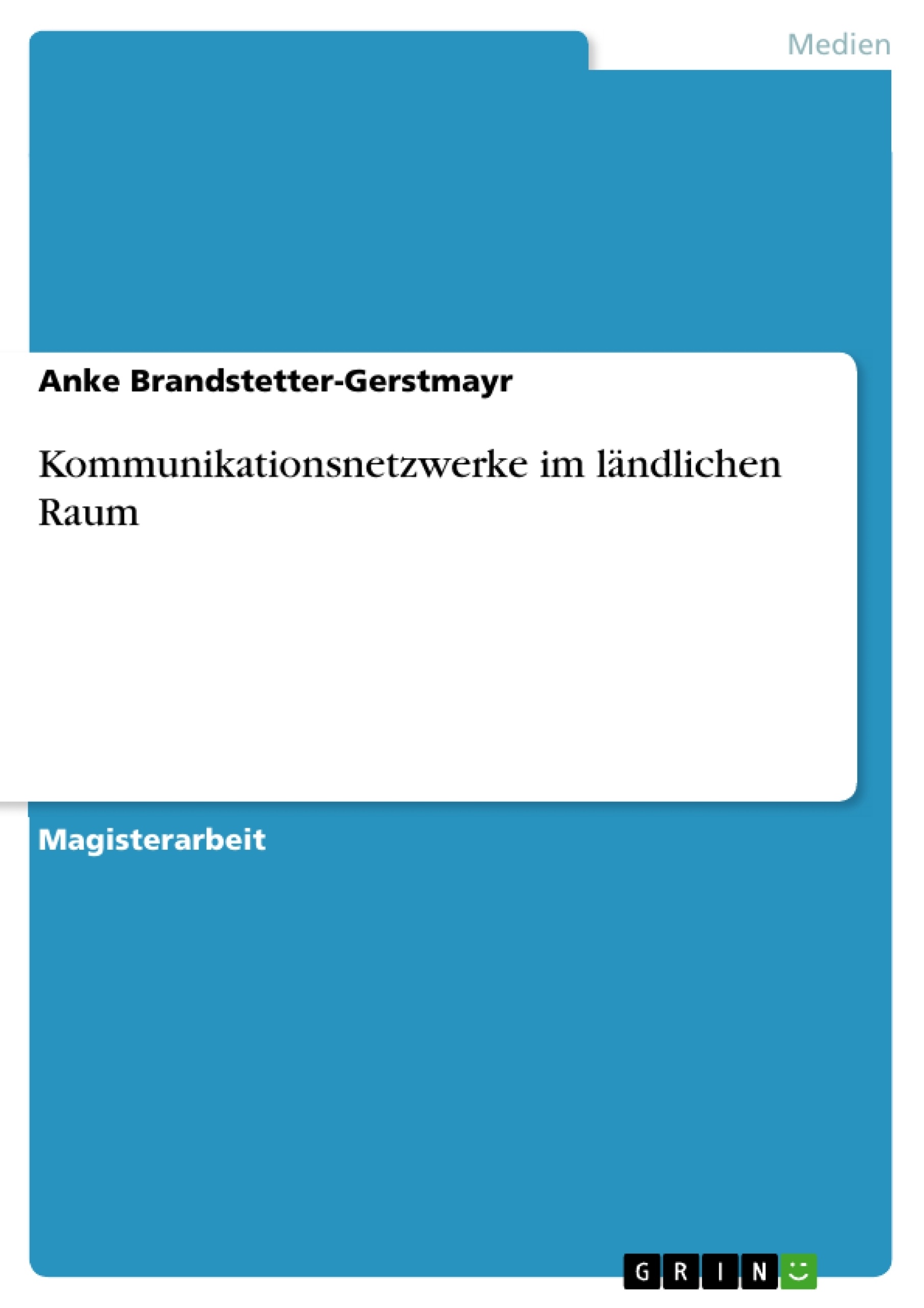Einleitung
Die empirische Sozialforschung beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit, untersucht die Menschen und ihr Zusammenleben, ihren Alltag und berücksichtigt dabei auch Verhaltens- und Handlungsabläufe.(1) Auch die Kommunikationswissenschaft als Sozialwissenschaft leistet wichtige Beiträge zur Theoriefindung, Forschung, Diskussion der Ergebnisse und zur Frage nach dem Verhältnis von Medien und Realität. Die Medienwirkungsforschung kann dabei sicher als zentrales Untersuchungsfeld der Kommunikationswissenschaft bezeichnet werden. Die Forschungsergebnisse zeigen, daß das Publikum nicht nur über Mediennutzungsprozesse und die Aufnahme der vermittelten Inhalte
beeinflußt wird, eine Annahme, die in der Medienwirkungsforschung lange Bestand hatte. Vielmehr sind die Medien „nur ein Teil der sinnstiftenden, symbolischen Umwelt des Menschen und ihr Stellenwert wird wesentlich determiniert von den jeweiligen Gegebenheiten der sozialen Situation und der Persönlichkeit der Rezipienten.“(2) Besonderes Augenmerk muß daher auch auf die Grundlage jeglichen sozialen In-Beziehung-Tretens gelegt werden, auf „die Keimzelle aller Verständigungsprozesse“(3), wie Satke anschaulich formuliert,
nämlich die interpersonale Kommunikation.
Gerade in dörflichen Gemeinschaften stellt die interpersonale Kommunikation traditionsgemäß einen wichtigen sozialen Faktor dar. Durch die steigende Mobilität der Dorfbewohner hat sich allerdings auch eine Veränderung in der infrastrukturellen und sozialen Struktur kleinerer Ortschaften ergeben. Dennoch bleiben die Gesprächskreise der Dorfgemeinschaft neben der Informationsvermittlung durch die Medien das wichtigste meinungsbildende Muster. Diese Annahme ist gleichzeitig auch die Grundidee der folgenden Untersuchung, die zum Ziel hat, Kommunikationsprozesse in dörflichen ihre Wirkung zu bestimmen.
[...]
______
1 Haas, Hannes: Empirischer Journalismus. Wien 1999. S. 21
2 Hunziker, Peter: Medien, Kommunikation und Gesellschaft. Darmstadt 1996. S. 76
3 Satke, Gerhard: Diskursive Konfliktbearbeitung in der interpersonalen Kommunikation. Konzeption,
Positionierung und Ansätze zu einer empirischen Analyse. Diplomarbeit. Wien 1995. S. 3
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kommunikationstheorie
- 2.1 Massenkommunikation
- 2.2 Interpersonale Kommunikation
- 2.3 Interdependenzen
- 2.3.1 Stimulus-Response-Theorie
- 2.3.2 Two-Step Flow of Communication
- 2.3.3 Kommunikationsrollen
- 2.3.3.1 Opinion Leader
- 2.3.3.2 Opinion Follower
- 2.3.4 Multi-Step Flow of Communication
- 2.3.4.1 Lokale und kosmopolitische Meinungsführer
- 2.3.4.2 Virtuelle Meinungsführer
- 2.3.4.3 Isolierte
- 2.3.5 Agenda Setting
- 2.3.6 Die Schweigespirale
- 3. Der ländliche Raum
- 3.1 Das Sozialsystem
- 3.2 Begriffsklärung
- 3.3 Interpersonale Kommunikation in dörflichen Gemeinschaften
- 3.3.1 Entstehung sozialer Kontakte
- 3.3.2 Entstehung sozialer Netzwerke
- 3.3.3 Die soziale Gruppe
- 3.4 Analyse durch Netzwerkanalyse
- 4. Netzwerkanalyse
- 4.1 Theorie der Netzwerkanalyse
- 4.1.1 Grundlagen und Elemente
- 4.1.2 Einteilung von Netzwerken
- 4.1.3 Burt- und Fischer-Instrument
- 4.1.4 Struktur und Qualität
- 4.1.5 Maßzahlen
- 4.2 Von der Gemeindestudie zur Netzwerkanalyse
- 4.2.1 Marienthal
- 4.2.2 Euskirchen
- 4.2.3 Studie „Mittlerer Neckar“
- 4.1 Theorie der Netzwerkanalyse
- 5. Studienkonzept
- 5.1 Die Entwicklung der Gemeinden Ardagger und Viehdorf
- 5.2 Methodenbeschreibung
- 5.2.1 Inhaltsanalyse
- 5.2.2 Interviews
- 6. Ergebnisse
- 6.1 Demographische Merkmale
- 6.2 Mediennutzung
- 6.3 Informationswege
- 6.4 Kommunikationsnetzwerke
- 6.4.1 Die Netzgröße
- 6.4.2 Homogenität und Heterogenität
- 6.4.3 Multiplexität
- 6.4.4 Qualität der Relationen
- 6.4.5 Politische Kommunikation
- 6.4.6 Meinungsführerschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Kommunikationsnetzwerke im ländlichen Raum anhand einer empirischen Studie in den Gemeinden Ardagger und Viehdorf. Ziel ist es, die Struktur und die Funktionsweise dieser Netzwerke zu analysieren und die Rolle von Kommunikation für die soziale Integration und den Informationsfluss zu beleuchten.
- Kommunikationsstrukturen im ländlichen Raum
- Rolle von Medien und persönlicher Kommunikation
- Soziale Netzwerke und ihre Auswirkungen
- Meinungsbildung und -verbreitung
- Anwendung der Netzwerkanalyse in der empirischen Sozialforschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Kommunikationsnetzwerke im ländlichen Raum ein und skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit. Es legt den Fokus auf die Bedeutung von Kommunikation für die soziale Kohäsion und den Informationsaustausch in ländlichen Gebieten, die oftmals durch eine geringere Bevölkerungsdichte und andere sozioökonomische Faktoren von städtischen Regionen unterschieden sind. Die Einleitung dient als Grundlage für die darauf folgenden Kapitel, indem sie den Kontext für die theoretischen Überlegungen und die empirische Untersuchung liefert.
2. Kommunikationstheorie: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über relevante Kommunikationstheorien, beginnend mit Massenkommunikation und interpersonalen Kommunikationsprozessen. Es werden verschiedene Modelle der Kommunikationsverbreitung, wie die Stimulus-Response-Theorie, der Two-Step Flow und der Multi-Step Flow, vorgestellt und analysiert. Besondere Beachtung finden die Rollen von Meinungsführern und -folgern innerhalb dieser Prozesse und die Dynamik der Meinungsbildung, unter Einbezug von Konzepten wie Agenda-Setting und der Schweigespirale. Die Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis und die Interpretation der Ergebnisse der empirischen Studie bereit.
3. Der ländliche Raum: Dieses Kapitel beleuchtet die spezifischen Charakteristika des ländlichen Raumes im Hinblick auf Kommunikation. Es beschreibt das soziale System ländlicher Gemeinschaften, klärt den Begriff des ländlichen Raums und analysiert die Besonderheiten der interpersonalen Kommunikation in dörflichen Strukturen. Die Entstehung sozialer Kontakte und Netzwerke wird detailliert betrachtet und der Einsatz der Netzwerkanalyse als Methode der Untersuchung wird begründet. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Faktoren, welche die Kommunikation in ländlichen Umgebungen prägen und von städtischen Kontexten unterscheiden.
4. Netzwerkanalyse: Dieses Kapitel führt in die Theorie und Methodik der Netzwerkanalyse ein. Es werden die Grundlagen und Elemente der Netzwerkanalyse erläutert und verschiedene Arten von Netzwerken vorgestellt. Das Kapitel beschreibt die Anwendung des Burt- und Fischer-Instruments sowie die Analyse von Netzwerkstruktur und -qualität anhand relevanter Kennzahlen. Es wird zudem ein Überblick über bestehende Gemeindestudien gegeben, welche die Netzwerkanalyse bereits angewendet haben (Marienthal, Euskirchen, Mittlerer Neckar), um den Kontext und den wissenschaftlichen Hintergrund der gewählten Methode aufzuzeigen.
5. Studienkonzept: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Studienkonzept, welches die empirische Untersuchung in Ardagger und Viehdorf leitet. Es beinhaltet die Darstellung der Entwicklung der beiden Gemeinden und detailliert die methodischen Ansätze, die für die Datenerhebung verwendet wurden. Die Kapitel erläutert die Anwendung von Inhaltsanalysen und Interviews als wichtige Forschungsinstrumente und begründet die Auswahl der Methode im Kontext der Forschungsfrage. Die Struktur des Studienkonzepts wird visuell mittels einer Abbildung dargestellt.
6. Ergebnisse (ohne Zusammenfassung der Unterkapitel 6.1 - 6.4.6): Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Studie. Die Daten der demographischen Merkmale, der Mediennutzung, der Informationswege und der Kommunikationsnetzwerke in den Gemeinden werden analysiert und ausgewertet. Die Ergebnisse dienen der Beantwortung der Forschungsfrage der Arbeit und werden in den darauffolgenden Kapiteln interpretiert und diskutiert.
Schlüsselwörter
Kommunikationsnetzwerke, ländlicher Raum, Netzwerkanalyse, Interpersonale Kommunikation, Massenkommunikation, Meinungsführer, Opinion Leader, Agenda-Setting, Schweigespirale, empirische Studie, Ardagger, Viehdorf, Soziale Netzwerke, Informationswege, Mediennutzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Kommunikationsnetzwerke im ländlichen Raum - Eine empirische Studie in Ardagger und Viehdorf
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht Kommunikationsnetzwerke im ländlichen Raum anhand einer empirischen Studie in den Gemeinden Ardagger und Viehdorf. Der Fokus liegt auf der Analyse der Struktur und Funktionsweise dieser Netzwerke sowie der Rolle der Kommunikation für die soziale Integration und den Informationsfluss.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie Kommunikationsstrukturen im ländlichen Raum aufgebaut sind, welche Rolle Medien und persönliche Kommunikation spielen, wie soziale Netzwerke funktionieren und welche Auswirkungen sie haben, wie Meinungsbildung und -verbreitung verlaufen und wie die Netzwerkanalyse in der empirischen Sozialforschung angewendet werden kann.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Kommunikationstheorien, darunter Massenkommunikation, interpersonale Kommunikation, Stimulus-Response-Theorie, Two-Step Flow, Multi-Step Flow, die Rollen von Meinungsführern und -folgern, Agenda-Setting und die Schweigespirale. Die Netzwerkanalyse dient als methodische Grundlage.
Welche Methoden wurden eingesetzt?
Die Datenerhebung erfolgte mittels Inhaltsanalyse und Interviews. Die Netzwerkanalyse wurde zur Auswertung der Daten verwendet. Die Arbeit bezieht sich auf bestehende Gemeindestudien wie Marienthal, Euskirchen und die Studie „Mittlerer Neckar“, um die gewählte Methode zu kontextualisieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Kommunikationstheorie, Der ländliche Raum, Netzwerkanalyse, Studienkonzept und Ergebnisse. Die Ergebnisse umfassen demographische Merkmale, Mediennutzung, Informationswege und eine detaillierte Analyse der Kommunikationsnetzwerke (Netzgröße, Homogenität/Heterogenität, Multiplexität, Qualität der Relationen, politische Kommunikation, Meinungsführerschaft).
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die empirischen Befunde zu demographischen Merkmalen, Mediennutzung, Informationswegen und Kommunikationsnetzwerken in Ardagger und Viehdorf. Die detaillierte Auswertung der Kommunikationsnetzwerke umfasst Aspekte wie Netzgröße, Homogenität und Heterogenität, Multiplexität, Qualität der Relationen, politische Kommunikation und Meinungsführerschaft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kommunikationsnetzwerke, ländlicher Raum, Netzwerkanalyse, Interpersonale Kommunikation, Massenkommunikation, Meinungsführer, Opinion Leader, Agenda-Setting, Schweigespirale, empirische Studie, Ardagger, Viehdorf, Soziale Netzwerke, Informationswege, Mediennutzung.
Wo finde ich einen detaillierten Überblick über die Kapitel?
Das Inhaltsverzeichnis der Arbeit bietet eine detaillierte Übersicht über alle Kapitel und Unterkapitel. Zusätzlich enthält die Arbeit Kapitelzusammenfassungen, die jeden Abschnitt im Detail beschreiben.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Kommunikationswissenschaft, Sozialforschung und ländlicher Entwicklung beschäftigen. Sie ist auch für Praktiker im Bereich der regionalen Entwicklung und kommunalen Politik von Interesse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Struktur und Funktionsweise von Kommunikationsnetzwerken im ländlichen Raum zu analysieren und die Rolle der Kommunikation für die soziale Integration und den Informationsfluss zu beleuchten.
- Arbeit zitieren
- Anke Brandstetter-Gerstmayr (Autor:in), 2000, Kommunikationsnetzwerke im ländlichen Raum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147