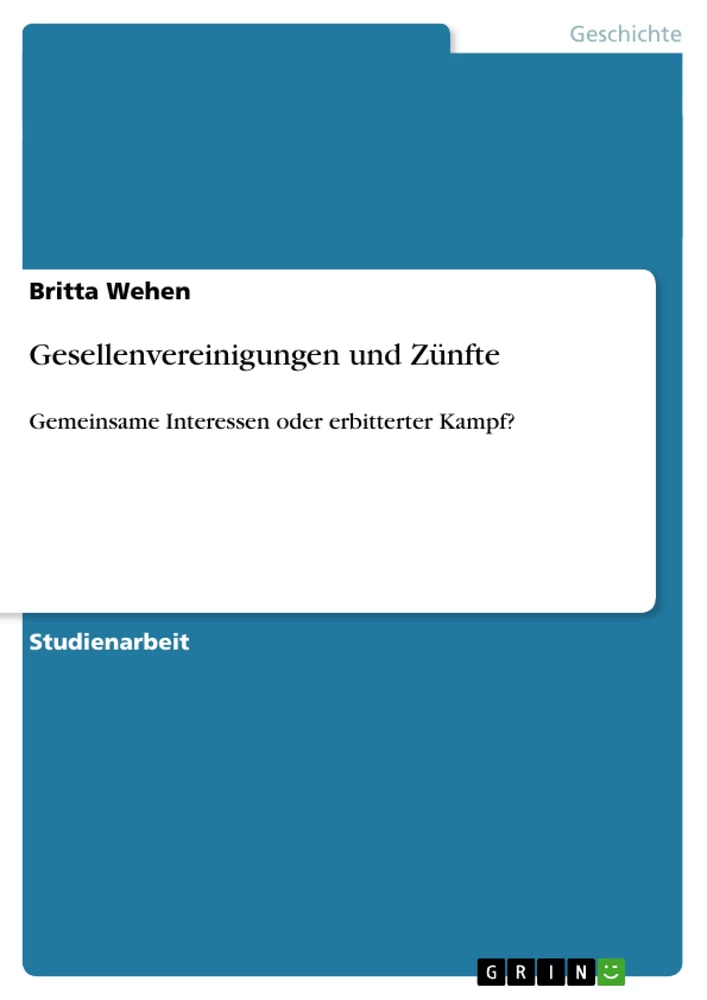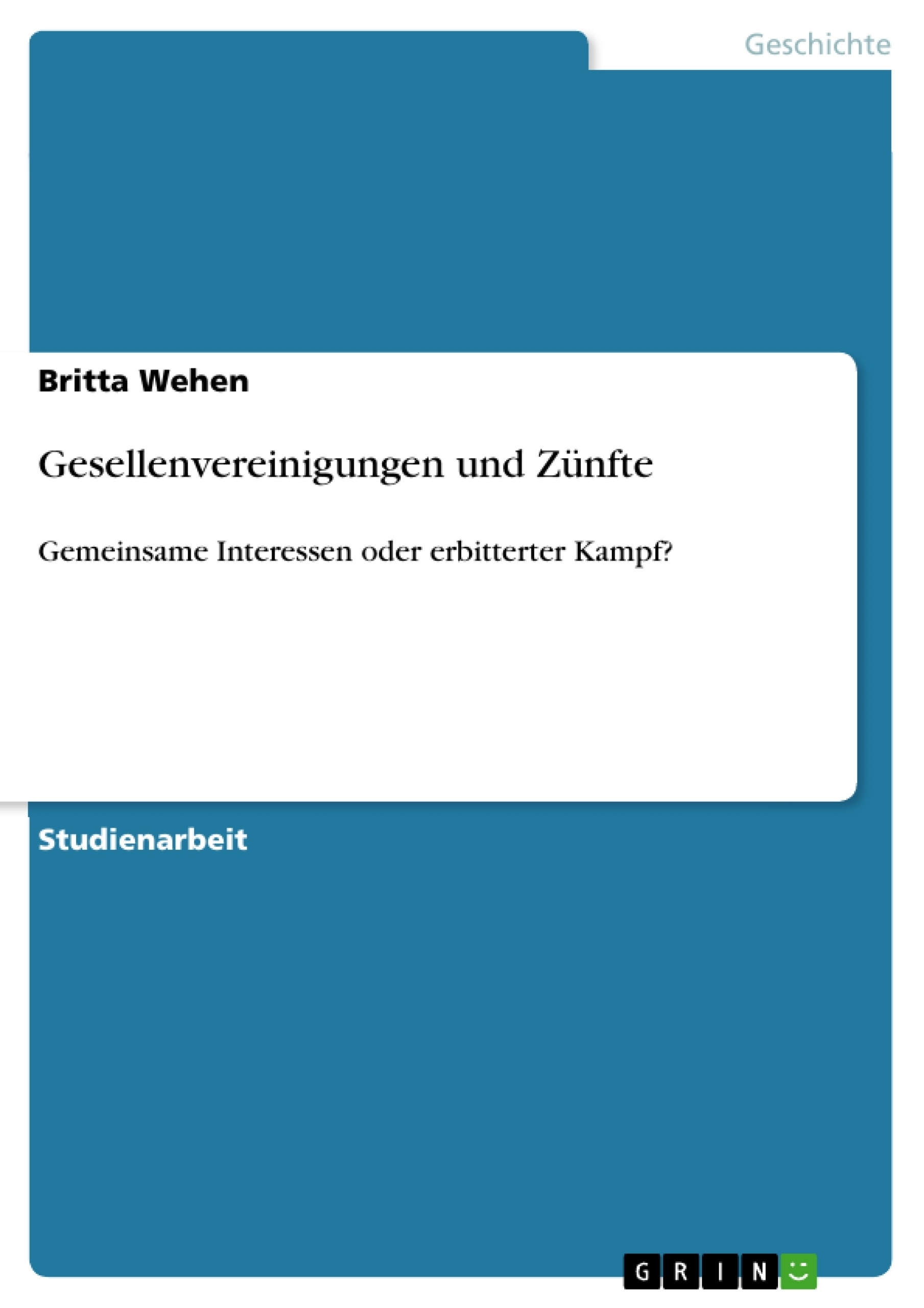„Die Gesellenschaften wurden nicht nur nach dem Vorbild der Zünfte organisiert, sie blieben diesen auch stets eng verbunden.“
Mit diesem Zitat ist eine der Positionen benannt, die sich mit dem Verhältnis von Gesellenvereinigungen und Zünften beschäftigt. Bereits seit dem 14. Jahrhundert verbanden sich Gesellen in lokalen Vereinigungen von 10 bis 50 Mitgliedern, wobei regionale Schwerpunkte bis in das 15. Jahrhundert am Oberrhein und in den Hansestädten lagen. In größeren Städten konnten sich neben den Zünften auch die Gesellenvereinigungen leichter etablieren, da es hier zahlenmäßig größere und vor allem viele verschiedene Gewerbe gab. Solche Zusammenschlüsse von Meistern einerseits und Gesellen andererseits sprechen immer für zweierlei Tatsachen: zum einen schließen sich Personen aus Gründen der Geselligkeit zusammen, um soziale Kontakte zu schließen und ähnliche Interessen auszuleben. Zum anderen spricht eine solche Vereinigung auch immer dafür, dass unterschiedliche Vereinigungen auch unterschiedliche Ziele verfolgen und somit in Spannungen zueinander geraten können, wobei diese Konflikte in differenter Ausprägung eskalieren können.
In diesem Spannungsfeld zweier verschiedener personeller Zusammenschlüsse, den Zünften einerseits und den Gesellenvereinigungen andererseits, sowie ihren Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten, aber auch möglichem Konfliktpotential, ist diese Arbeit angesiedelt. Die Erforschung der mittelalterlichten Zunftgeschichte wurde in den letzten Jahrzehnten sehr umfassend betrieben. Bei der Betrachtung der Zünfte stehen jedoch meist die Zunftordnungen sowie die Wahrung der gemeinsamen Interessen, mitunter auch Zunftzwang und Konkurrenzvermeidung, also meist wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund. Oftmals geht es auch um politische Dimensionen, wenn der Versuch der politischen Einflussnahme und die Auseinandersetzungen mit dem städtischen Rat um Mitbestimmungsrechte in der Stadt betrachtet werden.
Weitaus weniger umfangreich ist die Untersuchung speziell der Gesellenvereinigungen, die nahezu zeitgleich mit der zünftischen Organisation entstanden.
Weitaus weniger umfangreich ist die Untersuchung speziell der Gesellenvereinigungen, die nahezu zeitgleich mit der zünftischen Organisation entstanden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gründe zur Entstehung von Gesellenorganisationen
- Konfliktlinien: Gesellen vs. Meister
- Lebens- und Arbeitsbedingungen der Gesellen
- Forderungen der Gesellen
- Mittel des „Arbeitskampfes“ zur Durchsetzung der Forderungen
- Verruf
- Streik
- Gemeinsame Interessen von Zunft und Gesellen
- Die Zunft als Vorbild
- Ideale
- Organisationsstruktur
- Gesellenschaft
- Bruderschaft
- Die selbständige Arbeitsvermittlung der Gesellen
- Die Gesellen als zukünftige Zunftmeister
- Die Zunft als Vorbild
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Gesellenvereinigungen und Zünften im Mittelalter (14.-16. Jahrhundert). Sie hinterfragt die gängige Darstellung von vorwiegend konfliktreichen Beziehungen und beleuchtet auch gemeinsame Interessen und gegenseitige Beeinflussungen. Die Arbeit analysiert die Entstehung von Gesellenorganisationen, deren Konfliktlinien mit den Meistern, sowie die Gemeinsamkeiten und Parallelen zwischen beiden Gruppen.
- Konfliktlinien zwischen Gesellen und Meistern/Zünften
- Lebens- und Arbeitsbedingungen der Gesellen im Mittelalter
- Gemeinsamkeiten und Interessen von Gesellen und Zünften
- Organisationsstrukturen von Gesellenvereinigungen und deren Vorbildfunktion der Zünfte
- Die Rolle der Gesellenvereinigungen im Kontext des frühbürgerlichen Umfelds
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert die zentrale Fragestellung der Arbeit: das Verhältnis zwischen Gesellenvereinigungen und Zünften im Mittelalter. Sie hebt die bisherige Forschungslage hervor, die sich stark auf Konflikte konzentriert, und kündigt eine differenziertere Betrachtung an, die sowohl Konflikte als auch Gemeinsamkeiten einbezieht. Die Arbeit konzentriert sich auf das 14.-16. Jahrhundert und verwendet die gängige Definition der Zunft als Vereinigung von Handwerkern desselben Gewerbes mit gemeinsamen sozialen und wirtschaftlichen Interessen. Die Einleitung benennt die begrenzte Forschung zu Gesellenvereinigungen und kündigt eine Untersuchung der gegenseitigen Beeinflussung und Unterstützung an, statt sich nur auf Konflikte zu konzentrieren.
Gründe zur Entstehung von Gesellenorganisationen: Dieses Kapitel skizziert verschiedene Theorien zur Entstehung von Gesellenvereinigungen. Es präsentiert Georg Schanz' "Abschließungsthese", die argumentiert, dass die Vereinigungen teilweise von den Meistern selbst zur Organisation und sozialen Absicherung der Gesellen gegründet wurden, anstatt einen direkten Kampf gegen die Zunft darzustellen. Dies deutet auf eine mögliche Übereinstimmung der Interessen zwischen Gesellen und Meistern hin und bildet einen Gegenpunkt zu den Konflikttheorien.
Schlüsselwörter
Gesellenvereinigungen, Zünfte, Mittelalter, Arbeitskampf, Konflikte, Gemeinsamkeiten, Handwerkswesen, frühbürgerliche Revolution, Arbeitsbedingungen, Gesellen, Meister, soziale Absicherung, Organisationsstrukturen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelalterliche Gesellenvereinigungen und Zünfte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das komplexe Verhältnis zwischen Gesellenvereinigungen und Zünften im Mittelalter (14.-16. Jahrhundert). Sie geht über die gängige, konfliktbetonte Darstellung hinaus und beleuchtet sowohl die Konflikte als auch die Gemeinsamkeiten und gegenseitigen Beeinflussungen beider Gruppen.
Welche Aspekte werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert die Entstehung von Gesellenorganisationen, die Konfliktlinien zwischen Gesellen und Meistern/Zünften, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Gesellen, Gemeinsamkeiten und Interessen beider Gruppen, die Organisationsstrukturen der Gesellenvereinigungen und deren Vorbildfunktion durch die Zünfte, sowie die Rolle der Gesellenvereinigungen im frühbürgerlichen Kontext.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den Gründen der Entstehung von Gesellenorganisationen, ein Kapitel zu den Konfliktlinien zwischen Gesellen und Meistern, ein Kapitel zu gemeinsamen Interessen von Zunft und Gesellen und ein Fazit. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeschlüsselt.
Welche zentralen Konfliktlinien zwischen Gesellen und Meistern werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Gesellen, die Forderungen der Gesellen und die Mittel ihres "Arbeitskampfes" (z.B. Verruf und Streik) zur Durchsetzung dieser Forderungen.
Welche Gemeinsamkeiten und Interessen zwischen Gesellen und Zünften werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Zunft als Vorbild für die Gesellenvereinigungen hinsichtlich Idealen und Organisationsstrukturen (Gesellenschaft und Bruderschaft), die selbständige Arbeitsvermittlung der Gesellen und die Perspektive der Gesellen, zukünftige Zunftmeister zu werden.
Welche Theorien zur Entstehung von Gesellenorganisationen werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert unter anderem Georg Schanz' "Abschließungsthese", die argumentiert, dass Gesellenvereinigungen teilweise von Meistern zur Organisation und sozialen Absicherung der Gesellen gegründet wurden, was auf eine Übereinstimmung von Interessen hindeutet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gesellenvereinigungen, Zünfte, Mittelalter, Arbeitskampf, Konflikte, Gemeinsamkeiten, Handwerkswesen, frühbürgerliche Revolution, Arbeitsbedingungen, Gesellen, Meister, soziale Absicherung, Organisationsstrukturen.
Welche Zeitperiode steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Der Fokus liegt auf dem Mittelalter, genauer gesagt dem 14. bis 16. Jahrhundert.
Wie wird die Zunft in dieser Arbeit definiert?
Die Arbeit verwendet die gängige Definition der Zunft als Vereinigung von Handwerkern desselben Gewerbes mit gemeinsamen sozialen und wirtschaftlichen Interessen.
Welche Forschungslücke schließt diese Arbeit?
Die Arbeit schließt die Forschungslücke der einseitigen Fokussierung auf Konflikte zwischen Gesellen und Zünften, indem sie auch die Gemeinsamkeiten und gegenseitige Beeinflussung beider Gruppen untersucht.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Britta Wehen (Author), 2009, Gesellenvereinigungen und Zünfte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148110