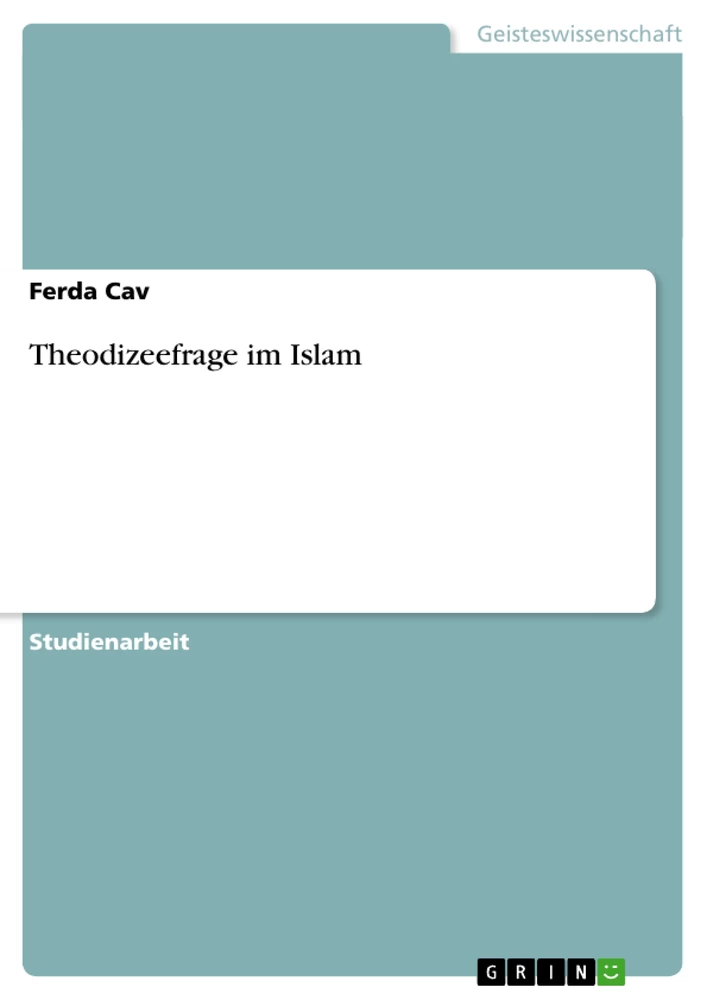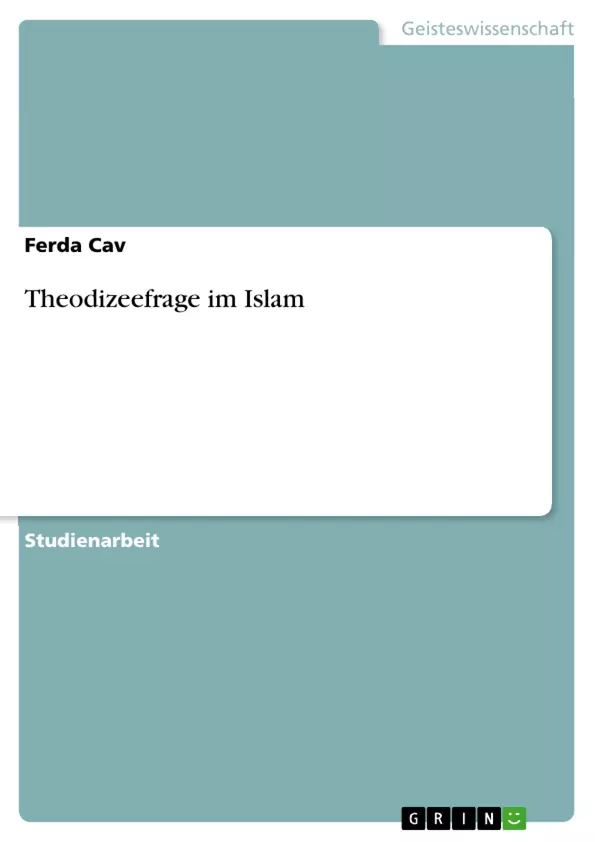Der Glaube an die Allmacht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes ist ein zentraler wie fundamentaler Teil des islamischen Bekenntnisses. Die stets größere Gerechtigkeit Gottes zu bejahen und auf sie zu vertrauen entspricht der gläubigen Grundhaltung eines jeden Muslims. Was könnte aber der Islam z.B. einer trauernden Frau überhaupt noch versprechen, wenn ihre Frömmigkeit quasi mit dem Tod der 4 jährigen Tochter durch die Flutkatastrophe 2009 in Istanbul bestraft wurde?
Dieses Ereignis ist beispielhaft für viele andere Situationen, in denen Gottes Gerechtigkeit hinterfragt werden könnte.
In diesem Kontext ist es unerlässlich, den Ursprung des Leids zu suchen: Bei Gott oder beim Menschen selber? Um die letztgenannte Frage beantworten zu können, müsste vorher geklärt werden, ob der Mensch frei handeln kann, d.h. aus eigener Kraft, Verantwortung und eigenem Willen oder ob all seine Taten letztendlich auf Gott zurückzuführen ist. Herrscht eine Handlungsfreiheit des Menschen, so sollte auch der Mensch für Böses verantwortlich sein. Doch was wenn man Böses erfährt ohne es verdient zu haben? Wie ist unverschuldetes Leid mit der Barmherzigkeit Gottes zu vereinbaren?
Ist der Mensch jedoch in seinem Handeln von Gott bestimmt, müsste dann nicht jede leidvolle Widerfahrnis und jedes existierende Übel ebenfalls göttlichen Ursprungs sein? Doch so würde die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes in Frage gestellt werden.
Während in der christlichen Tradition die Fragen nach dem Verhältnis von der Gerechtigkeit Gottes und der Freiheit des Menschen vielfältig diskutiert werden und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Frage nach offenbar unverschuldetem Leid, das dem Menschen widerfährt, gerichtet ist, misst der Islam dieser Themenstellung kaum Bedeutung bei. Die islamische Theologie hat die Frage nach dem Leid stets im größeren Fragenzusammenhang der Allmacht und Gerechtigkeit Gottes und des freien Willens des Menschen verortet. Diese Problematik zu ergründen, soll Gegenstand dieser der vorliegenden Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Allgemeines
- Die Beziehung zwischen Gott und Mensch im Islam
- Das Böse
- Geduld
- Schluss
- Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Theodizeefrage im Islam. Sie analysiert die Frage, wie das Leid und das Böse in der Welt mit der Allmacht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes vereinbar sind. Dabei wird die Beziehung zwischen Gott und Mensch im Islam beleuchtet, die Rolle des freien Willens des Menschen im Kontext des Leids diskutiert und die Bedeutung von Geduld im islamischen Kontext hervorgehoben.
- Die Theodizeefrage im Islam
- Die Beziehung zwischen Gott und Mensch im Islam
- Die Rolle des freien Willens im Kontext des Leids
- Das Konzept der Geduld im Islam
- Die Frage nach dem Ursprung des Leids
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Theodizeefrage anhand eines aktuellen Ereignisses, der Flutkatastrophe in Istanbul, vor. Sie beleuchtet die Frage, wie gläubige Muslime mit dem Leid und dem Tod umgehen, insbesondere wenn es sich um unverschuldetes Leid handelt.
Der Hauptteil der Arbeit beginnt mit einer allgemeinen Einführung in die Theodizeefrage. Anschließend wird die Beziehung zwischen Gott und Mensch im Islam betrachtet, wobei die Frage nach dem freien Willen des Menschen im Kontext des Leids im Vordergrund steht. Das Kapitel "Das Böse" untersucht die Ursachen und die Rolle des Bösen in der Welt aus islamischer Perspektive. Schließlich widmet sich das Kapitel "Geduld" der Bedeutung von Geduld im Umgang mit Leid und Schicksal.
Schlüsselwörter
Theodizee, Islam, Leid, Böse, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Gott, Mensch, freier Wille, Geduld, Schicksal, Glaube, Religion, Allmacht, Theologie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Theodizeefrage im Kontext des Islam?
Sie untersucht, wie das Vorhandensein von Leid und Bösem mit der Allmacht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes vereinbar ist.
Wie wird der Ursprung des Leids im Islam erklärt?
Es wird diskutiert, ob Leid direkt von Gott bestimmt ist oder aus der Handlungsfreiheit und Verantwortung des Menschen resultiert.
Welche Rolle spielt der freie Wille des Menschen?
Der freie Wille ist zentral: Wenn der Mensch frei handelt, trägt er die Verantwortung für das Böse; ist er vorbestimmt, stellt sich die Frage nach Gottes Gerechtigkeit neu.
Was bedeutet „Geduld“ (Sabr) im islamischen Glauben?
Geduld ist eine fundamentale Tugend im Umgang mit Schicksalsschlägen und unverschuldetem Leid, um die gläubige Grundhaltung zu bewahren.
Unterscheidet sich die islamische Sichtweise von der christlichen?
Ja, während das Christentum die Theodizee oft isoliert diskutiert, verortet der Islam sie meist im größeren Zusammenhang von Gottes Allmacht und dem menschlichen Willen.
- Quote paper
- Ferda Cav (Author), 2009, Theodizeefrage im Islam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148152