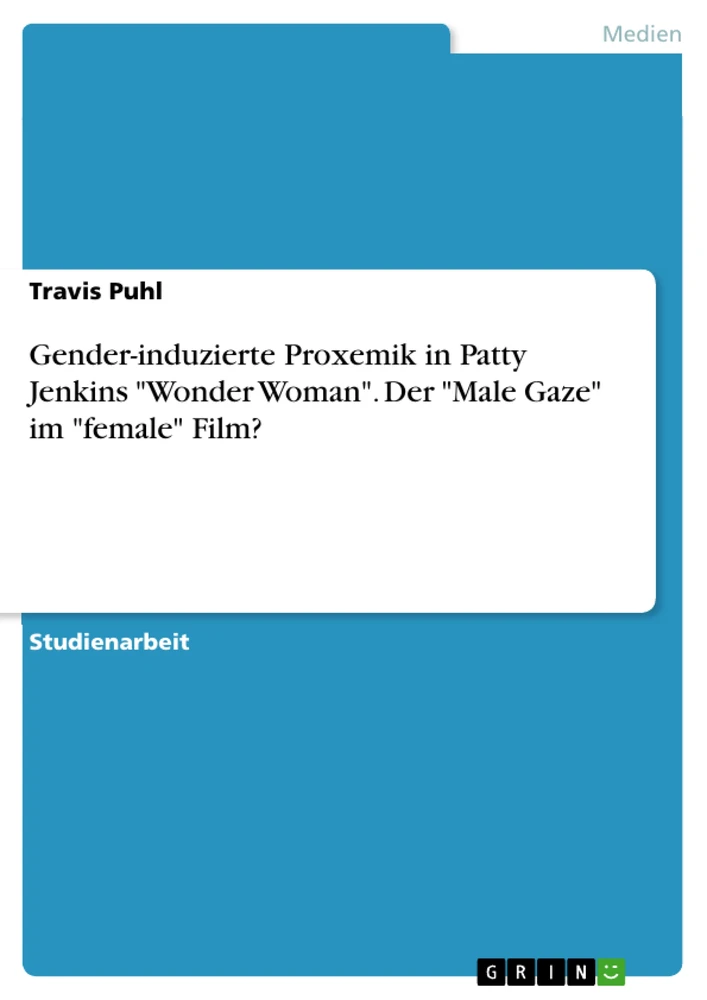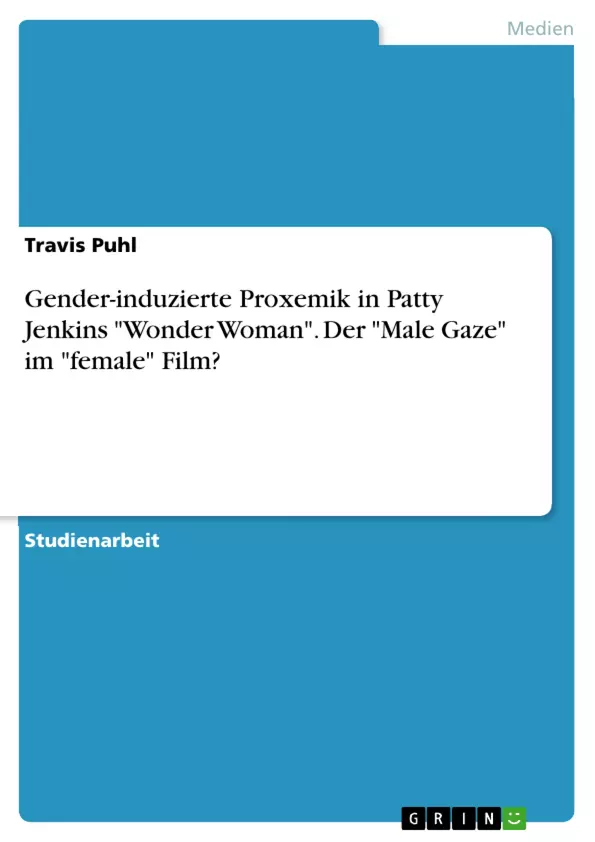In dieser Arbeit wird die vermeintlich feministische Inszenierung einer "Wonder Woman" im Jahr 2017 auf der Leinwand in Frage gestellt. Warum dies durchaus so gesehen werden kann, wird zuerst in Kapitel 2 zur Filmkonzeption dargelegt. Anschließend soll in Kapitel 3 auf die Proxemik der Figur "Wonder Woman" und auch zum Teil "Steve Trevor" eingegangen werden, da jene, im Film mit Kameraperspektive und -sicht arbeitend, ein gender-camoufliertes Zerrbild evoziert, das die gender-theoretische Filmkonzeption an manchen Stellen tarnt, an anderen wiederum den "male gaze" erst gar nicht verbergen möchte. Gezeigt wird das exemplarisch an mehreren Filmszenen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur gender-theoretischen Filmkonzeption oder warum Wonder Woman nicht feministisch ist
- 2.1. Diana und Steve Trevor - ein Pygmalion-Stoff?
- 2.2. Die Frau in der Männerwelt und der Mann in der Frauenwelt
- 3. Die Proxemik als gender-Camouflage
- 3.1. Frauen- vs. Männer-Rat:
- 3.2. Höhe und Tiefe: Wer oben ist, gewinnt - wer unten ist, verliert.
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Gender im Film "Wonder Woman" (2017), insbesondere im Hinblick auf den "male gaze". Ziel ist es, zu analysieren, inwieweit der Film trotz weiblicher Hauptrolle und Regisseurin von traditionellen gender-theoretischen Konzepten abweicht oder diese sogar reproduziert. Die Arbeit hinterfragt die vermeintlich feministische Inszenierung und untersucht die Rolle der Proxemik in der Konstruktion von Gender im Film.
- Der "male gaze" in einem Film mit weiblicher Hauptrolle und Regisseurin
- Die Anwendung gender-theoretischer Konzepte auf "Wonder Woman"
- Die Rolle der Proxemik (räumliche Beziehungen) in der Darstellung von Gender
- Analyse der Beziehung zwischen Diana und Steve Trevor im Kontext des Pygmalion-Mythos
- Die Frage nach der Authentizität einer feministischen Filmgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert statistische Daten über die Unterrepräsentation von Frauen im Film und diskutiert Laura Mulveys Konzept des "male gaze". Sie führt in die Problematik ein und stellt die These auf, dass "Wonder Woman" (2017), trotz weiblicher Hauptrolle und Regisseurin, nicht frei von den Mechanismen des "male gaze" ist. Die Arbeit kündigt die Analyse der gender-theoretischen Filmkonzeption und der Proxemik im Film an.
2. Zur gender-theoretischen Filmkonzeption oder warum Wonder Woman nicht feministisch ist: Dieses Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Diana und Steve Trevor im Kontext des Pygmalion-Mythos. Es argumentiert, dass Dianas Entwicklung zwar als Selbstfindungsprozess dargestellt wird, aber dennoch Elemente der männlichen Führung und des Erziehungsaspekts beinhaltet. Die Frage, ob Dianas Entwicklung tatsächlich eine feministische ist, wird kritisch hinterfragt, indem der Film im Kontext bereits existierender gender-theoretischer Ansätze betrachtet wird. Die Integration von Dianas Handlungsmotivationen und das Bemühen um eine unabhängige Darstellung der Figur im Kontext des gesamten Films wird ausführlich besprochen.
3. Die Proxemik als gender-Camouflage: Kapitel 3 untersucht die Proxemik im Film als Mittel der Gender-Darstellung. Anhand ausgewählter Szenen wird analysiert, wie Kameraperspektive und -führung zur Konstruktion von Gender-Stereotypen beitragen und den "male gaze" teilweise verschleiern oder verstärken. Der Fokus liegt darauf, wie räumliche Beziehungen zwischen den Figuren die Genderdynamik im Film beeinflussen und wie subtil diese Mechanismen eingesetzt werden. Die Analyse berücksichtigt verschiedene Aspekte der Kameraperspektive und räumlichen Anordnung und deren Wirkung auf das Publikum.
Schlüsselwörter
Wonder Woman, Gender, Film, male gaze, Proxemik, feministische Filmtheorie, Pygmalion-Mythos, Gender-Stereotypen, Kameraperspektive, Patty Jenkins, Gal Gadot
Häufig gestellte Fragen zu: Genderdarstellung in "Wonder Woman" (2017)
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Gender im Film "Wonder Woman" (2017), insbesondere im Hinblick auf den "male gaze". Sie untersucht, inwieweit der Film trotz weiblicher Hauptrolle und Regisseurin traditionelle gender-theoretische Konzepte reproduziert oder von ihnen abweicht. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle der Proxemik (räumliche Beziehungen) in der Konstruktion von Gender im Film.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit will analysieren, ob "Wonder Woman" (2017) eine tatsächlich feministische Inszenierung bietet oder ob traditionelle Muster des "male gaze" erkennbar sind. Es wird untersucht, wie gender-theoretische Konzepte auf den Film angewendet werden können und welche Rolle die Proxemik dabei spielt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den "male gaze" in einem Film mit weiblicher Hauptrolle und Regisseurin, die Anwendung gender-theoretischer Konzepte auf "Wonder Woman", die Rolle der Proxemik in der Darstellung von Gender, die Analyse der Beziehung zwischen Diana und Steve Trevor im Kontext des Pygmalion-Mythos und die Frage nach der Authentizität einer feministischen Filmgestaltung.
Wie wird die Beziehung zwischen Diana und Steve Trevor analysiert?
Die Beziehung zwischen Diana und Steve Trevor wird im Kontext des Pygmalion-Mythos analysiert. Es wird untersucht, ob Dianas Entwicklung als Selbstfindungsprozess tatsächlich feministisch ist oder ob Elemente männlicher Führung und Erziehung erkennbar sind.
Welche Rolle spielt die Proxemik in der Analyse?
Die Proxemik (räumliche Beziehungen) wird als Mittel der Gender-Darstellung analysiert. Es wird untersucht, wie Kameraperspektive und -führung zur Konstruktion von Gender-Stereotypen beitragen und den "male gaze" verschleiern oder verstärken. Der Fokus liegt auf dem Einfluss räumlicher Beziehungen zwischen den Figuren auf die Genderdynamik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur gender-theoretischen Filmkonzeption und "Wonder Woman", ein Kapitel zur Proxemik als gender-Camouflage und einen Schluss. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die These auf, dass "Wonder Woman" nicht frei von den Mechanismen des "male gaze" ist. Kapitel 2 analysiert die Beziehung Diana/Steve Trevor und hinterfragt Dianas Entwicklung im Hinblick auf feministische Kriterien. Kapitel 3 untersucht die Proxemik als Mittel der Gender-Darstellung im Film.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wonder Woman, Gender, Film, male gaze, Proxemik, feministische Filmtheorie, Pygmalion-Mythos, Gender-Stereotypen, Kameraperspektive, Patty Jenkins, Gal Gadot.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass "Wonder Woman", trotz weiblicher Hauptrolle und Regisseurin, nicht frei von den Mechanismen des "male gaze" ist und traditionelle gender-theoretische Konzepte reproduziert. Die detaillierte Schlussfolgerung ist im Kapitel "Schluss" der Arbeit beschrieben.
- Arbeit zitieren
- Travis Puhl (Autor:in), 2024, Gender-induzierte Proxemik in Patty Jenkins "Wonder Woman". Der "Male Gaze" im "female" Film?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1481635