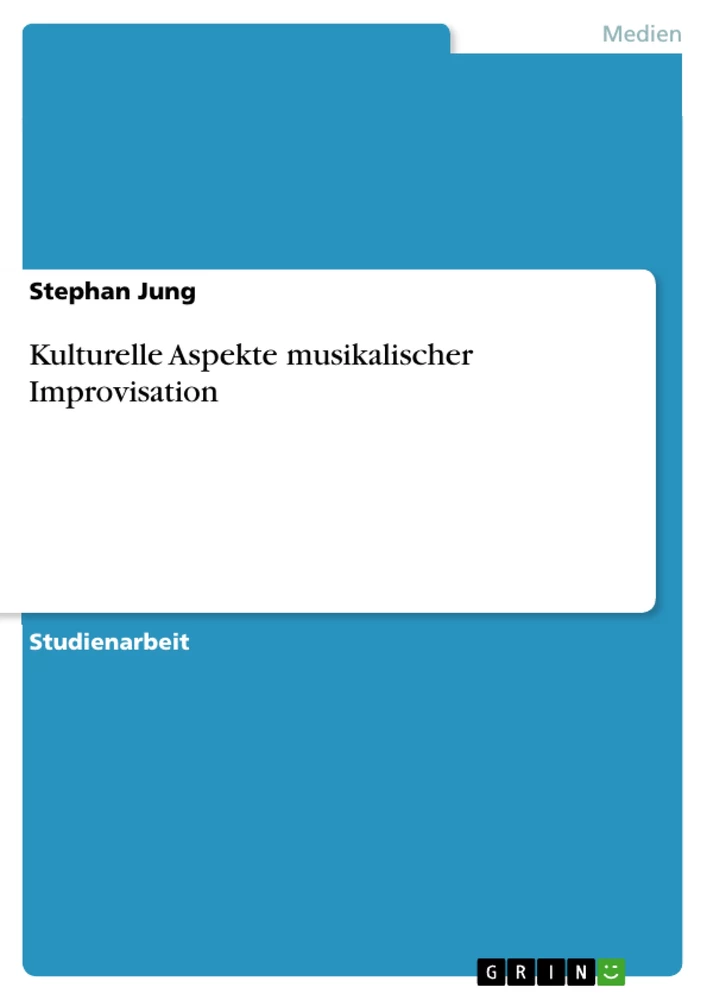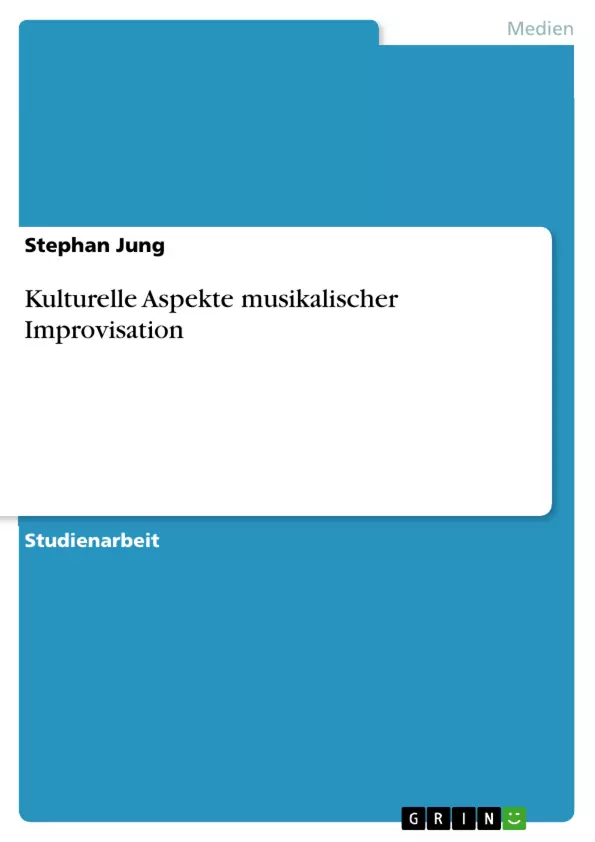Improvisation begegnet uns in allen Lebensbereichen. In der Musik jedoch hat sie eine oft unterschätzte Bedeutung. Jeder Musiker wird Situationen kennen, in denen er freiwillig oder aber auch von äußeren Umständen gezwungen improvisiert hat, je nachdem, wie eng der Begriff Improvisation gesteckt ist. Viele Abhandlungen gehen von einem strengen Improvisationsbegriff als Gegensatz zur Komposition aus. Es ist aber hilfreich, eine offene Haltung einzunehmen und sich nicht zu eng an eine Definition zu binden. Ein Untersuchungsgegenstand der folgenden Seiten soll die Komplexität dieses Themas sein und es soll die Problematik einer solchen antithetischen Sichtweise reflektiert werden.
In Anbetracht der Kürze dieser Arbeit kann diese aber nicht dem Kriterium der Vollständigkeit genügen. Es handelt sich hierbei um eine kursorische Beleuchtung des Improvisationsbegriffs in einer Vielzahl seiner Facetten - bei weitem können aber nicht alle relevanten Aspekte behandelt werden. Der Schwerpunkt soll bei dem Verhältnis von Improvisation und dem Kulturbegriff liegen. Sowohl das europäische Verständnis als auch Musikpraktiken in außereuropäischen schriftlosen Kulturen sollen Berücksichtigung finden und insbesondere soll die Schwierigkeit, mit dem Begriffspaar Improvisation – Komposition kulturübergreifend zu arbeiten in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt werden. Dabei wird im weiteren Verlauf der Forschung ständig die Frage ein Begleiter sein, welche Bedeutung Kultur für die Improvisation hat beziehungsweise ob Improvisation überhaupt frei von Kultur sein kann. Eine noch zentralere Bedeutung soll der hier aufgestellten These zukommen, Kompositionen seien Kultur prägend, Improvisation hingegen sei kulturgeprägt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kulturbegriff
- Improvisation – Komposition
- Kurzer geschichtlicher Abriss der Improvisation
- Improvisation und Kultur
- Kontextuelles Verständnis von Kultur und Improvisation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der komplexen Beziehung zwischen musikalischer Improvisation und Kultur. Ziel ist es, den Improvisationsbegriff in seinen vielfältigen Facetten zu beleuchten und die Problematik einer rein antithetischen Sichtweise gegenüber der Komposition zu reflektieren. Dabei soll der Fokus auf das Verhältnis zwischen Improvisation und dem Kulturbegriff gelegt werden, sowohl im europäischen Kontext als auch in außereuropäischen schriftlosen Kulturen. Die Arbeit untersucht die Schwierigkeit, mit dem Begriffspaar Improvisation – Komposition kulturübergreifend zu arbeiten, und stellt die Frage nach der Bedeutung von Kultur für die Improvisation.
- Das Verhältnis von Improvisation und Kultur in verschiedenen Kontexten
- Die Problematik einer rein antithetischen Sichtweise von Improvisation und Komposition
- Die Rolle von Kultur für die Entstehung und Entwicklung musikalischer Improvisation
- Die Frage nach der Möglichkeit kulturfreier Improvisation
- Die These, dass Kompositionen kulturprägend sind, während Improvisation kulturgeprägt ist
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand und die Zielsetzung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Bedeutung von Improvisation in verschiedenen Lebensbereichen, insbesondere in der Musik. Dabei wird die Problematik einer strengen Definition von Improvisation als Gegensatz zur Komposition aufgezeigt und die Notwendigkeit einer offenen Haltung betont. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Komplexität des Themas zu untersuchen und die Problematik einer antithetischen Sichtweise zu reflektieren. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verhältnis von Improvisation und Kultur, wobei sowohl europäische als auch außereuropäische Musikpraktiken berücksichtigt werden.
Kulturbegriff
Dieses Kapitel bietet eine kurze Einführung in den Kulturbegriff, der für das weitere Verständnis der Arbeit relevant ist. Es werden verschiedene Kriterien des Kulturbegriffs beleuchtet, wie z.B. die Wiederholung, die Schaffung von Ordnung und Sinn sowie die automatische Weitergabe und Überlieferung durch den Prozess der Aneignung.
Improvisation – Komposition
Dieses Kapitel setzt sich mit dem Verhältnis von Improvisation und Komposition auseinander. Es wird die traditionelle Sichtweise, die Improvisation als das Gegenteil von Komposition betrachtet, kritisch beleuchtet und die Komplexität des Themas aufgezeigt. Die Arbeit stellt verschiedene Facetten von Improvisation vor, wie z.B. die meditative Selbsterfahrung und die Selbstbeschäftigung der Improvisatoren. Es wird die Bedeutung des Moments und der Situation für die Improvisation hervorgehoben sowie die Einmaligkeit und Neuartigkeit jeder Darbietung betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Musiksoziologie und Musikpsychologie, insbesondere mit dem Verhältnis von Improvisation und Kultur. Im Vordergrund stehen Begriffe wie Improvisation, Komposition, Kultur, Kontext, Tradition, Innovation, Selbstreflexion, Selbsterfahrung und die Analyse verschiedener Musikpraktiken in verschiedenen kulturellen Kontexten.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen musikalische Improvisation und Kultur zusammen?
Improvisation ist stark kulturgeprägt; sie nutzt vorhandene kulturelle Muster und Kontexte, um im Moment Neues zu schaffen.
Was ist der Unterschied zwischen Improvisation und Komposition?
Oft werden sie als Gegensätze betrachtet (festgeschrieben vs. spontan), doch die Arbeit hinterfragt diese Trennung und betont die Komplexität beider Formen.
Gibt es "kulturfreie" Improvisation?
Die Arbeit stellt die These auf, dass Improvisation kaum frei von kulturellen Einflüssen sein kann, da der Musiker stets in seinem kulturellen Umfeld verwurzelt ist.
Was besagt die These "Kompositionen sind kulturprägend, Improvisation ist kulturgeprägt"?
Diese These legt nahe, dass Kompositionen neue kulturelle Standards setzen können, während Improvisation eher auf bestehenden kulturellen Werten aufbaut.
Welche Rolle spielt Improvisation in schriftlosen Kulturen?
In außereuropäischen, schriftlosen Kulturen ist Improvisation oft die zentrale Form der Musikpraxis und eng mit Tradition und Aneignung verknüpft.
- Arbeit zitieren
- Stephan Jung (Autor:in), 2009, Kulturelle Aspekte musikalischer Improvisation , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148176